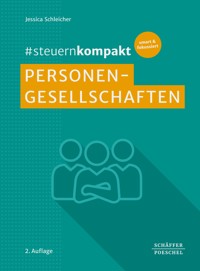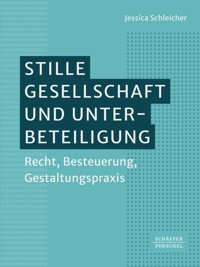
119,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Werk ist ein kompaktes Kompendium zu den zivil-, gesellschafts- und handelsrechtlichen und insbesondere steuerlichen Fragestellungen bei typischen und atypischen stillen Gesellschaften sowie bei typischen und atypischen Unterbeteiligungsgesellschaften. Es richtet sich an die Praktiker:innen in Beratung, Unternehmenssteuerabteilungen und Finanzverwaltung. Die große praktische Bedeutung der typischen und atypischen stillen Gesellschaft liegt in ihrer weitreichenden Gestaltungsfreiheit. Da die gesetzlichen Regelungen in den §§ 705 ff. BGB und §§ 230-236 HGB weitgehend disponibel sind, können stille Beteiligungen sowohl von Unternehmen als auch Investoren als flexibles Gestaltungsmittel der Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden. Durch die gezielte Gestaltung rechtlicher und steuerlicher Gegebenheiten lassen sich diverse Beteiligungs- und Finanzierungsziele erreichen. Eine ebenfalls weit verbreitete Beteiligungsform ist die typische und atypische Unterbeteiligung; hier erfolgt jedoch keine Beteiligung an einem Handelsgewerbe, sondern lediglich eine Beteiligung an einem Gesellschaftsanteil. Diese Beteiligungsform wird in der Praxis gewählt, um beispielsweise potenzielle Nachfolger in einem ersten Schritt an das Unternehmen heranzuführen oder um Einkünfte aus der Hauptbeteiligung auf Kinder zu verlagern. Unterbeteiligungen eines Gesellschafters können zudem verdeckt gegenüber den Mitgesellschaftern gestaltet sein. Zahlreiche Beispiele, Praxistipps, Tabellen und Übersichten erleichtern die Umsetzung im Tagesgeschäft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1068
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumVorwortAbkürzungsverzeichnisA Stille GesellschaftI Zivilrecht1 Rechtsnatur bzw. Wesen der stillen Gesellschaft1.1 Die stille Gesellschaft als Personengesellschaft1.2 Die stille Gesellschaft als Innengesellschaft1.3 Kein Gesellschaftsvermögen2 Gründe für und gegen eine stille Gesellschaft2.1 Gründe für den Geschäftsinhaber2.2 Gründe für den stillen Gesellschafter2.3 Gründe gegen eine stille Gesellschaft3 Gründung einer stillen Gesellschaft3.1 Legaldefinition des Begriffs »Gesellschaft«3.2 Abschluss eines Gesellschaftsvertrags3.2.1 Vertragliches Schuldverhältnis3.2.2 Zeitpunkt der Entstehung einer stillen Gesellschaft3.2.3 Formvorschriften3.2.3.1 Formvorschrift gemäß § 311b Abs. 1 BGB3.2.3.2 Formvorschrift gemäß § 15 Abs. 4 GmbHG3.2.3.3 Formvorschrift gemäß § 518 Abs. 1 Satz 1 BGB3.2.3.3.1 Formbedürftigkeit3.2.3.3.2 Heilung des Formmangels gemäß § 518 Abs. 2 BGB3.2.3.4 Formvorschrift gemäß § 293 Abs. 3 AktG3.2.3.4.1 AG & (a)typisch Still bzw. KGaA & (a)typisch Still3.2.3.4.2 GmbH & (a)typisch Still3.2.4 Mitwirkung von Vertretern3.2.4.1 Rechtsgeschäftliche – gewillkürte – Vertretungsmacht gemäß §§ 164 ff. BGB3.2.4.2 Prokura gemäß § 49 bis § 54 HGB3.2.4.3 Handlungsvollmacht gemäß § 54 bis § 58 HGB3.2.4.4 Gesetzliche Vertretungsmacht3.2.4.4.1 Abwesenheitspfleger gemäß § 1884 BGB3.2.4.4.2 Nachlasspfleger gemäß § 1960 BGB3.2.4.4.3 Betreuung unter Einwilligungsvorbehalt (§ 1825 BGB)3.2.4.5 Organschaftliche Vertretungsmacht3.2.4.6 Personengesellschaften3.2.4.7 Beschränkung der Vertretungsmacht durch § 181 BGB3.2.5 Mitwirkung von Minderjährigen3.2.5.1 Minderjährige als stille Gesellschafter?3.2.5.1.1 Rechtsfähigkeit von Minderjährigen3.2.5.1.2 Vertretungsregelungen3.2.5.1.2.1 Geschäftsunfähigkeit von Minderjährigen3.2.5.1.2.2 Beschränkte Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen3.2.5.1.3 Genehmigungsvorbehalt des Familiengerichts3.2.5.2 Minderjährige als Geschäftsinhaber?3.2.5.2.1 Vertretungsregelungen3.2.5.2.2 Selbstständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts (§ 112 BGB)3.2.5.2.3 Genehmigungsvorbehalt des Familiengerichts3.2.5.3 Vormundschaft gemäß §§ 1773 ff. BGB3.2.6 Mitwirkung von volljährigen Geschäftsunfähigen3.2.7 Erlaubnispflicht nach dem KWG3.2.8 Berufsrechtliche Vorgaben und Schranken3.2.9 Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft3.2.9.1 Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft – Grundsätze3.2.9.2 Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft – Stille Gesellschaft3.2.9.2.1 Höchstrichterliche Rechtsprechung3.2.9.2.2 Meinungen in der Literatur3.2.9.3 Überwiegende schutzwürdige Interessen3.3 Mindestinhalt des Gesellschaftsvertrags3.4 Tracking-Stock-Strukturen3.5 Inhaltskontrolle4 Rechte und Pflichten aus dem Gesellschaftsverhältnis4.1 Rechte und Pflichten des Geschäftsinhabers4.1.1 Betrieb eines Handelsgewerbes4.1.1.1 Beitragspflicht4.1.1.1.1 Allgemeine Ausführungen zur Beitragspflicht des Geschäftsinhabers4.1.1.1.2 Vor Aufnahme der Geschäftstätigkeit4.1.1.1.3 Laufende Geschäftstätigkeit4.1.1.1.4 Wirtschaftliche Schwierigkeiten4.1.2 Geschäftsführung4.1.3 Vergütung für die Geschäftsführertätigkeit4.1.4 Vertretung4.1.5 Haftung4.1.6 Informationspflicht4.1.7 Treuepflichten4.1.8 Wettbewerbsverbot4.1.9 Gewinn- und Verlustbeteiligung4.1.10 Pflicht zur Rechnungslegung4.2 Rechte und Pflichten des stillen Gesellschafters4.2.1 Beitragspflicht4.2.2 Geschäftsführung4.2.3 Vergütung für die Geschäftsführertätigkeit4.2.4 Vertretung4.2.5 Haftung4.2.6 Informationsrecht4.2.7 Treuepflichten4.2.8 Wettbewerbsverbot4.2.9 Gewinn- und Verlustbeteiligung4.2.9.1 Gewinnbeteiligung4.2.9.2 Verlustbeteiligung4.2.9.3 Verteilungsschlüssel4.2.9.4 Maßgebliches Geschäftsergebnis4.2.9.5 Auszahlungsanspruch5 Beteiligte einer stillen Gesellschaft5.1 Derjenige, der Handelsgewerbe betreibt5.1.1 Kaufmannseigenschaft5.1.1.1 Istkaufmann5.1.1.2 Kannkaufmann5.1.1.3 Land- und Forstwirte5.1.1.4 Scheinkaufmann – also Kaufmann kraft Eintragung5.1.1.5 Formkaufleute5.1.2 Kein Geschäftsinhaber5.1.2.1 Natürliche Person5.1.2.2 Stille Gesellschaft5.1.2.3 Gesellschaft des bürgerlichen Rechts5.1.2.3.1 Rechtsfähige GbR5.1.2.3.2 Nicht rechtsfähige GbR5.1.2.4 Partnerschaft5.1.3 Geschäftsinhaber5.1.3.1 Einzelkaufmann5.1.3.2 Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)5.1.3.3 Aktiengesellschaft5.1.3.4 Kommanditgesellschaft auf Aktien5.1.3.5 Europäische Aktiengesellschaft (SE)5.1.3.6 Eingetragener Verein5.1.3.7 Eingetragene Genossenschaft5.1.3.8 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit5.1.3.9 Personenhandelsgesellschaften5.1.3.10 Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung5.1.3.11 Juristische Personen des öffentlichen Rechts5.1.3.12 Erbengemeinschaft5.2 Stille Gesellschafter5.2.1 Kein stiller Gesellschafter5.2.1.1 Stille Gesellschaft5.2.1.2 Einzelkaufmann gleichzeitig als Geschäftsinhaber und stiller Gesellschafter5.2.1.3 Nicht rechtsfähige Gesellschaft des bürgerlichen Rechts5.2.2 Stiller Gesellschafter5.2.2.1 Natürliche Person5.2.2.2 Juristische Personen5.2.2.3 Rechtsfähige GbR5.2.2.4 Personenhandelsgesellschaften5.2.2.5 Partnerschaft5.2.2.6 EWIV5.2.2.7 Gesellschafter des Geschäftsinhabers6 Beitrag und Einlage des stillen Gesellschafters6.1 Unterscheidung zwischen Beitrag und Einlage6.2 Bedeutung für die stille Gesellschaft6.3 Art der Beitragsleistung6.3.1 Geldeinlage6.3.2 Sacheinlage6.3.3 Erbringung einer Dienstleistung6.3.4 Unterlassungspflichten6.3.5 Arbeitskraft6.3.6 Sonstige Beiträge6.4 Ausweis der Einlage des stillen Gesellschafters6.4.1 Ausweis als Fremdkapital in der Handelsbilanz6.4.2 Ausweis als Eigenkapital in der Handelsbilanz6.5 Einlagekonto6.6 Gutschrift auf dem Einlagekonto7 Erscheinungsformen der stillen Gesellschaft7.1 Typische und atypische stille Gesellschaft7.1.1 Typisch stille Gesellschaft7.1.2 Atypisch stille Beteiligungsformen7.2 Zweigliedrige oder mehrgliedrige stille Gesellschaft7.2.1 Zweigliedrige stille Gesellschaft7.2.2 Mehrgliedrige stille Gesellschaft7.2.3 Stille Publikumsgesellschaft7.3 GmbH & (a)typisch Still7.4 Stille Familiengesellschaften7.5 Stille Gesellschaft des bürgerlichen Rechts8 Abgrenzung der stillen Gesellschaft von anderen Gesellschaftsformen und Rechtsverhältnissen8.1 Abgrenzung zum partiarischen Darlehen8.2 Abgrenzung zum Metageschäft8.3 Abgrenzung zum partiarischen Dienstvertrag8.4 Abgrenzung zu Genussrechten8.5 Abgrenzung zu den Personenhandelsgesellschaften OHG und KG8.6 Abgrenzung zur Unterbeteiligung9 Auflösung der stillen Gesellschaft9.1 Hinweise zur Auflösung von rechtsfähigen Personengesellschaften9.2 Beendigungsverfahren bei der stillen Gesellschaft9.3 Auflösungsgründe9.3.1 Kündigung durch einen Gesellschafter (§ 234 Abs. 1 Alt. 1 HGB)9.3.1.1 Ordentliche Kündigung9.3.1.2 Außerordentliche Kündigung9.3.1.2.1 Außerordentliche Kündigung bei Gesellschaftsverhältnis auf Zeit9.3.1.2.2 Kündigung durch einen Gläubiger des stillen Gesellschafters9.3.1.2.3 Kündigung bei Eintritt der Volljährigkeit9.3.1.3 Kündigung zur Unzeit9.3.1.4 Kündigungserklärung9.3.2 Tod des stillen Gesellschafters9.3.3 Tod des Geschäftsinhabers9.3.4 Sonstige Auflösungsgründe9.3.4.1 Auflösung durch Zeitablauf9.3.4.2 Auflösungsbeschluss9.3.4.3 Eröffnung des Insolvenzverfahrens9.3.4.4 Zweckerreichung oder Unmöglichkeit der Zweckerreichung9.3.4.5 Eintritt auflösende Bedingung9.3.4.6 Konfusion9.3.4.7 Gesellschaftsvertragliche Vereinbarungen10 Auseinandersetzung10.1 Ermittlung des Auseinandersetzungsguthabens10.1.1 Der typisch stille Gesellschafter10.1.2 Der atypisch stille Gesellschafter10.1.3 Besonderheiten10.1.3.1 Anspruch auf Rückgabe von Gegenständen10.1.3.2 Sonstige Beiträge des stillen Gesellschafters10.2 Auszahlungsanspruch des stillen Gesellschafters10.2.1 Stichtag des Anspruchs auf Auszahlung10.2.2 Fälligkeit des Anspruchs auf Auszahlung10.3 Ansprüche des Geschäftsinhabers10.4 Abwicklung schwebender Geschäfte11 Handelsrechtliche BuchführungspflichtII Besteuerung im Zusammenhang mit einer typisch stillen Gesellschaft1 Steuerliche Anerkennung des Gesellschaftsvertrags2 Die Gründung einer typisch stillen Gesellschaft3 Die typisch stille Gesellschaft4 Der Geschäftsinhaber4.1 Einkünfte des Geschäftsinhabers4.2 Ermittlung der Einkünfte beim Geschäftsinhaber4.3 Beitrag des typisch stillen Gesellschafters4.4 Gewinnanteile des typisch stillen Gesellschafters4.5 Verlustanteile des typisch stillen Gesellschafters4.6 Anwendung der Zinsschranke5 Der typisch stille Gesellschafter5.1 Beteiligung im Privatvermögen5.1.1 Einkünfte des typisch stillen Gesellschafters5.1.2 Laufende Gewinnanteile5.1.2.1 Angemessenheit der Gewinnbeteiligung5.1.2.2 Zuflusszeitpunkt von laufenden Gewinnanteilen5.1.2.3 Mehrergebnisse aufgrund Außenprüfung5.1.2.4 Werbungskostenabzug5.1.2.5 Ausnahmeregelung § 32d Abs. 2 EStG5.1.2.5.1 Ausnahme § 32d Abs. 2 Nr. 1 lit. a) EStG5.1.2.5.2 Ausnahme § 32d Abs. 2 Nr. 1 lit. b) EStG5.1.2.5.3 Ausnahme § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG5.1.2.5.4 Rechtsfolgen aus § 32d Abs. 2 Nr. 1 EStG5.1.2.6 Kapitalertragsteuer bzgl. laufender Gewinnanteile5.1.2.6.1 Abgeltungswirkung5.1.2.6.2 Einbehalt der Kapitalertragsteuer5.1.2.6.3 Sonderregelung des § 32d Abs. 6 EStG5.1.3 Vorausleistungen und Abschlagszahlungen5.1.4 Laufende Verlustanteile5.1.4.1 Laufende Verlustanteile5.1.4.2 Zuflusszeitpunkt von laufenden Verlustanteilen5.1.4.3 Verlustabzugsbeschränkung des § 15 Abs. 4 Satz 6 bis Satz 8 EStG (typisch still)5.1.4.4 Sinngemäße Anwendung von § 15a EStG5.1.4.4.1 Grundtatbestand § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG i. V. m. § 15a Abs. 1 Satz 1 EStG sinngemäß5.1.4.4.2 Erweiterter Verlustausgleich gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG i. V. m. § 15a Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 EStG sinngemäß5.1.4.4.3 Nachträgliche Einlagen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG i. V. m. § 15a Abs. 1a EStG sinngemäß5.1.4.4.4 Einlageminderung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG i. V. m. § 15a Abs. 3 EStG sinngemäß5.1.4.4.5 Gesonderte Feststellung des verrechenbaren Verlustes gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG i. V. m. § 15a Abs. 4 EStG sinngemäß5.1.4.4.6 § 15a EStG im Zusammenhang mit Veräußerung oder Auflösung5.1.4.5 Negative Einkünfte mit Bezug zu Drittstaaten § 2a EStG5.1.5 Veräußerungsgewinne und Veräußerungsverluste5.1.5.1 Veräußerungsgewinne5.1.5.2 Ausnahmen des § 32d Abs. 2 Nr. 1 EStG5.1.5.3 Kapitalertragsteuer bzgl. Veräußerungsgewinne5.1.5.4 Veräußerungsverluste5.1.5.5 Sonderregelung § 20 Abs. 2 Satz 3 EStG5.1.6 Anwendung der Zinsschranke5.2 Beteiligung Betriebsvermögen5.2.1 Zuordnung zum Betriebsvermögen5.2.2 Qualifikation der Einkünfte5.2.3 Zuflusszeitpunkt5.2.3.1 Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich5.2.3.1.1 Gewinnanteile5.2.3.1.2 Verlustanteile5.2.3.1.3 Besonderheiten der GmbH & typisch Still5.2.3.2 Einnahmen-Überschuss-Rechnung5.2.4 Mehrergebnisse aufgrund Außenprüfung5.2.5 Anwendung der Verlustabzugsbeschränkungen5.2.6 Werbungskostenabzug5.2.7 Kapitalertragsteuer5.2.8 Anwendung der Vorschrift § 8b KStG5.2.9 Anwendung der Zinsschranke5.3 Verlustausgleich nach § 20 Abs. 6 EStG6 Umwandlungen6.1 Umstrukturierungsmaßnahmen auf Ebene der typisch stillen Gesellschaft6.1.1 Ausübung Optionswahlrecht durch die typisch stille Gesellschaft6.1.2 Umwandlung der typisch stillen Gesellschaft nach dem UmwG6.1.2.1 Verschmelzung6.1.2.2 Spaltung6.1.2.3 Formwechsel6.1.3 Einbringung gemäß § 20 UmwStG6.1.4 Einbringung gemäß § 24 UmwStG6.1.5 Umwandlung typisch stille Beteiligung in Beteiligung an Außenpersonengesellschaft6.1.6 Umwandlung Beteiligung an Außenpersonengesellschaft in typisch stille Beteiligung6.2 Umwandlung des Geschäftsinhabers7 Verfahrensrechtliche Hinweise zur typisch stillen Gesellschaft7.1 Nicht rechtsfähige Gesellschaften – § 14a AO7.2 Steuerpflichtiger gemäß § 33 Abs. 1 AO7.3 Bekanntgabe von Bescheiden7.4 Gesonderte und einheitliche Feststellung8 Die typisch stille Gesellschaft und sonstige Steuerarten8.1 Umsatzsteuer8.1.1 Unternehmereigenschaft8.1.1.1 Allgemeine Ausführungen8.1.1.2 Keine Unternehmereigenschaft der typisch stillen Gesellschaft8.1.1.3 Unternehmereigenschaft des Geschäftsinhabers8.1.1.4 Unternehmereigenschaft des stillen Gesellschafters8.2 Gewerbesteuer8.2.1 Sachliche Gewerbesteuerpflicht der typisch stillen Gesellschaft8.2.2 Persönliche Gewerbesteuerpflicht der typisch stillen Gesellschaft8.2.3 Gewerbesteuer beim Geschäftsinhaber8.2.3.1 Gewerbeertrag8.2.3.2 Hinzurechnung gemäß § 8 Nr. 1 lit. c) GewStG8.2.3.3 Freibetrag gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 GewStG8.2.4 Gewerbesteuer beim typisch stillen Gesellschafter8.3 GrunderwerbsteuerIII Besteuerung im Zusammenhang mit einer atypisch stillen Gesellschaft1 Steuerliche Anerkennung des Gesellschaftsvertrags2 Gründung einer atypisch stillen Gesellschaft2.1 Vorliegen einer Mitunternehmerschaft2.2 Zivilrechtliches Gesellschaftsvermögen2.3 Steuerliches Betriebsvermögen2.4 Gründung einer atypisch stillen Gesellschaft2.4.1 Einbringung gemäß § 24 UmwStG2.4.1.1 Verhältnis zu § 16 Abs. 1 Satz 1 EStG2.4.1.2 Abgrenzung Gesamtrechtsnachfolge zur Einzelrechtsnachfolge2.4.1.3 Einbringungsgegenstand2.4.1.4 Beteiligte der Einbringung2.4.1.5 Einbringungsvorgang2.4.1.6 Gewährung von Gesellschaftsrechten2.4.1.7 Rechtsfolgen2.4.1.8 § 24 Abs. 5 UmwStG2.5 Beispiel: Atypisch stille Beteiligung an Einzelunternehmen2.5.1 Handelsbilanzielle Umsetzung2.5.2 Steuerbilanzielle Umsetzung2.5.2.1 Lösungsalternative 12.5.2.2 Lösungsalternative 22.5.3 Sonstige Rechtsfolgen2.6 Beispiel: Atypisch stille Beteiligung an einer Personenhandelsgesellschaft2.6.1 Handelsbilanzielle Umsetzung2.6.2 Steuerbilanzielle Umsetzung2.6.2.1 Lösungsalternative 12.6.2.2 Lösungsalternative 22.6.3 Rechtsfolgen für die Einbringende X-OHG2.7 Übermittlungspflichten des Geschäftsinhabers2.8 Fehlbetrag gemäß § 10a GewStG2.8.1 Unternehmensidentität2.8.1.1 Einzelunternehmen2.8.1.2 Kapitalgesellschaft2.8.1.3 Personengesellschaft2.8.2 Unternehmeridentität2.8.2.1 Einzelunternehmen2.8.2.2 Personengesellschaft2.8.2.3 Kapitalgesellschaft2.8.3 Die atypisch stille Gesellschaft2.8.3.1 Atypisch stille Beteiligung an einem Einzelunternehmen2.8.3.2 Atypisch stille Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft2.8.3.2.1 Urteil des BFH vom 24.04.2014 – IV R 34/102.8.3.2.2 Nichtanwendungserlass2.8.3.2.3 Beispiel2.8.3.2.3.1 Lösung des Beispiels mit Rechtsauffassung des BFH2.8.3.2.3.2 Lösung des Beispiels mit Ansicht der Finanzverwaltung2.8.3.2.4 Beispiel2.8.3.3 Atypisch stille Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft2.8.3.3.1 Interessante Entscheidungen des BFH – Weitere Entwicklungen2.8.3.3.2 Urteil des BFH vom 17.01.2019 – III R 35/172.8.3.3.3 Urteil des BFH vom 01.02.2024 – IV R 26/212.8.3.3.4 Urteil des BFH vom 11.01.2024 – IV R 25/212.8.3.3.5 Beispiel3 Steuerliche Folgen aus dem Bestehen einer atypisch stillen Gesellschaft3.1 Transparenzprinzip3.2 Einkünftequalifikation3.2.1 Originär gewerbliche Betätigung3.2.1.1 Ebene der Gesellschaft3.2.1.1.1 Selbstständige Betätigung3.2.1.1.2 Nachhaltige Betätigung3.2.1.1.3 Gewinnerzielungsabsicht3.2.1.1.4 Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr3.2.1.1.5 Keine Ausübung von Land- und Forstwirtschaft3.2.1.1.6 Keine selbstständige Arbeit gemäß § 18 EStG3.2.1.1.7 Keine reine Vermögensverwaltung3.2.1.1.8 Atypisch stille Gesellschaft3.2.1.2 Ebene der Gesellschafter3.2.1.2.1 Zivilrechtlicher Gesellschafter3.2.1.2.2 Mitunternehmerinitiative3.2.1.2.3 Mitunternehmerrisiko3.2.1.2.4 Kommanditist als Leitbild3.2.1.2.5 Hinweise auf Entscheidungen des BFH3.2.1.2.5.1 BFH vom 11.12.1990 – VIII R 122/863.2.1.2.5.2 BFH vom 07.11.2006 – VIII R 5/043.2.1.2.6 Mitunternehmerstellung des stillen Gesellschafters3.2.1.2.6.1 Besonderheiten bei der GmbH & atypisch Still3.2.1.2.6.2 BFH vom 19.07.2018 – IV R 10/173.2.1.2.6.3 BFH vom 13.07.2017 – IV R 41/143.2.1.2.6.4 BFH vom 12.04.2021 – VIII R 46/183.2.1.2.6.5 Zusammenfassung3.2.1.2.7 Mitunternehmerstellung des Geschäftsinhabers3.2.2 Gewerbliche Infektion3.2.3 Gewerbliche Prägung3.2.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen3.3 Tracking-Stock-Strukturen3.4 Buchführungspflicht und Einkünfteermittlungsart3.4.1 Pflicht zur Erstellung einer Steuerbilanz3.4.2 Einnahmen-Überschuss-Rechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG3.4.3 Übermittlungspflicht des Geschäftsinhabers3.5 Additive Gewinnermittlung3.6 Kapitalkonto3.7 Korrespondierende Bilanzierung3.8 Ergänzungsbilanzen3.9 Sonderbetriebsvermögen3.9.1 Sonderbetriebsvermögen des Geschäftsinhabers3.9.2 Sonderbetriebsvermögen des atypisch stillen Gesellschafters3.9.3 Mehrstöckige Personengesellschaftsstrukturen3.10 Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne gemäß § 34a EStG3.11 Zinsschranke gemäß § 4h EStG3.12 Steuerermäßigung gemäß § 35 EStG4 Verlustverrechnungsbeschränkung des § 15a EStG4.1 Basics zum Grundtatbestand in § 15a Abs. 1 Satz 1 EStG4.2 Teilweise sinngemäße Anwendung der Vorschrift § 15a EStG auf atypisch stille Gesellschafter4.3 Maßgebliches Kapitalkonto für § 15a Abs. 1 Satz 1 EStG4.3.1 Allgemeine Ausführungen zum maßgeblichen Kapitalkonto4.3.2 Kapitalkonten des atypisch stillen Gesellschafters4.4 Erweiterter Verlustausgleich gemäß § 15a Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 EStG4.5 Aktivisches Gesellschafterverrechnungskonto bzw. aktivisches Gesellschafterkonto4.6 Einlagen und Entnahmen4.7 Einlageminderung4.8 Haftungsminderung5 Steuerstundungsmodelle gemäß § 15b EStG6 Übertragungsvorgänge6.1 Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern6.1.1 Überführung gemäß § 6 Abs. 5 Satz 1 EStG6.1.2 Überführung gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 EStG6.1.3 Übertragung gemäß § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG6.1.4 Sperrfrist gemäß § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG6.1.5 Körperschaftsklausel I des § 6 Abs. 5 Satz 5 EStG6.1.6 Körperschaftsklausel II gemäß § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG6.2 Unentgeltliche Übertragung6.3 Entgeltliche Übertragung des gesamten Mitunternehmeranteils6.4 Entgeltliche Übertragung eines Teils des Mitunternehmeranteils6.5 Realteilung6.6 Übertragungen des Geschäftsinhabers7 Auflösung der atypisch stillen Gesellschaft7.1 Ausscheiden des atypisch stillen Gesellschafters gegen Barabfindung7.2 Ausscheiden des atypisch stillen Gesellschafters gegen Sachwertabfindung7.2.1 Ins Privatvermögen7.2.2 Ins Betriebsvermögen7.2.2.1 Zweigliedrige atypisch stille Gesellschaft7.2.2.2 Mehrgliedrige atypisch stille Gesellschaft7.3 Übertragungen durch den atypisch stillen Gesellschafter auf den Geschäftsinhaber7.3.1 Geschäftsinhaberin in der Rechtsform einer GmbH7.3.2 Geschäftsinhaberin in der Rechtsform einer Mitunternehmerschaft7.4 Ausscheiden des Geschäftsinhabers8 Umwandlungen8.1 Ausübung Optionswahlrecht durch die atypisch stille Gesellschaft8.2 Umwandlungen nach dem UmwG8.2.1 Verschmelzung8.2.2 Spaltung8.2.3 Formwechsel8.3 Umwandlung der atypisch stillen Gesellschaft in eine Außenpersonengesellschaft9 Sonstige Steuerarten9.1 Umsatzsteuer9.1.1 Unternehmereigenschaft9.1.1.1 Keine Unternehmereigenschaft der atypisch stillen Gesellschaft9.1.1.2 Unternehmereigenschaft des Geschäftsinhabers9.1.1.3 Unternehmereigenschaft des stillen Gesellschafters9.2 Gewerbesteuer9.2.1 Sachliche Gewerbesteuerpflicht der atypisch stillen Gesellschaft9.2.2 Persönliche Gewerbesteuerpflicht der atypisch stillen Gesellschaft9.2.3 Freibetrag gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG9.2.4 Hinzurechnung gemäß § 8 Nr. 1 lit. c) GewStG9.2.5 Gewerbesteuerliche Organschaft9.2.6 Gewerbesteuerpflicht9.3 Grunderwerbsteuer10 Verfahrensrechtliche Hinweise zur atypisch stillen Gesellschaft10.1 Nicht rechtsfähige Gesellschaften – § 14a AO10.2 Steuerpflichtiger10.3 Bekanntgabe von Bescheiden10.4 Gesonderte und einheitliche Feststellung10.5 Einspruchsbefugnis gemäß § 352 AO10.6 Beteiligte eines finanzgerichtlichen Verfahrens10.7 Beiladung im finanzgerichtlichen VerfahrenIV GmbH & (a)typisch Still1 Steuersubjekt2 Rechtsbeziehungen zur GmbH2.1 Typisch stille Gesellschaft2.2 Atypisch stille Gesellschaft2.2.1 Beteiligung an der GmbH2.2.2 Darlehen und Nutzungsüberlassungen2.2.3 Sonderbetriebseinnahmen2.2.3.1 Geschäftsführungsgehalt2.2.3.2 Gewinnausschüttungen3 Vereinbarungen zwischen Familienangehörigen4 Verdeckte Gewinnausschüttungen4.1 Errichtung der stillen Gesellschaft4.2 Typisch stille Gesellschaft4.3 Atypisch stille Gesellschaft5 Körperschaftsteuerliche Organschaft5.1 Grundlagen zur körperschaftsteuerlichen Organschaft5.1.1 Typisch und atypisch stille Gesellschaft als Organgesellschaft5.1.2 Typisch und atypisch stille Gesellschaft als Organträgerin5.1.3 Kapitalgesellschaft, an der eine atypisch stille Beteiligung besteht5.1.3.1 Kapitalgesellschaft, an der eine atypisch stille Beteiligung besteht, als Organgesellschaft5.1.3.2 Kapitalgesellschaft, an der eine atypisch stille Beteiligung besteht, als Organträgerin5.2 Kapitalgesellschaft, an der eine typisch stille Beteiligung besteht5.2.1 Kapitalgesellschaft, an der eine typisch stille Beteiligung besteht, als Organträgerin5.2.2 Kapitalgesellschaft, an der eine typisch stille Beteiligung besteht, als Organgesellschaft6 Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften gemäß § 8c KStG6.1 Grundlagen zur Verlustabzugsbeschränkung des § 8c KStG6.2 GmbH & typisch Still6.3 GmbH & atypisch Still6.3.1 Verlustgesellschaft als stille Gesellschafterin6.3.2 Verlustgesellschaft als Geschäftsinhaberin6.3.3 Muttergesellschaft der Verlustgesellschaft als Geschäftsinhaberin7 Verlustabzugsbeschränkung § 15 Abs. 4 Satz 6 bis Satz 8 EStG7.1 GmbH & atypisch Still7.2 GmbH & typisch StillB UnterbeteiligungI Zivilrecht1 Rechtsnatur und Wesen der Unterbeteiligung2 Rechtsgrundlagen3 Erscheinungsformen3.1 Typische und atypische Unterbeteiligung3.2 Offene und verdeckte Unterbeteiligung3.3 Zweigliedrige und mehrgliedrige Unterbeteiligung4 Hauptbeteiligung5 Gesellschaftsvertrag5.1 Formvorschriften5.1.1 Formvorschrift gemäß § 311b Abs. 1 BGB5.1.2 Formvorschriften gemäß § 15 Abs. 3 und Abs. 4 GmbHG5.1.3 Formvorschrift gemäß § 518 Abs. 1 Satz 1 BGB5.2 Genehmigung durch die Mitgesellschafter oder die Hauptgesellschaft5.3 Mitwirkung von Minderjährigen5.3.1 Geschäftsunfähige Minderjährige5.3.2 Beschränkt geschäftsfähige Minderjährige5.3.3 Ergänzungspflegschaft5.3.4 Genehmigungsvorbehalt des Familiengerichts5.4 § 181 BGB5.5 Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft6 Rechte und Pflichten aus dem Unterbeteiligungsverhältnis6.1 Aus der Hauptbeteiligung6.2 Aus der Unterbeteiligung6.2.1 Vertretung6.2.2 Geschäftsführung6.2.3 Grundlagengeschäfte in der Hauptgesellschaft6.2.4 Informationspflicht6.2.5 Wettbewerbsverbot6.2.6 Gewinn- und Verlustbeteiligung7 Beteiligte einer Unterbeteiligungsgesellschaft8 Beiträge der BeteiligtenII Die steuerliche Behandlung der typischen Unterbeteiligung1 Der typische Unterbeteiligte1.1 Im Privatvermögen1.2 Im Betriebsvermögen2 Der Hauptbeteiligte3 Unterbeteiligung an einer GmbH4 Verfahrensrechtliche Hinweise5 Gewerbesteuer5.1 Sachliche Gewerbesteuerpflicht der typischen Unterbeteiligung5.2 Gewerbesteuerliche Hinzurechnung gemäß § 8 Nr. 1 lit. c) GewStGIII Die steuerliche Behandlung der atypischen Unterbeteiligung1 Unterbeteiligung an einer originär gewerblich tätigen Mitunternehmerschaft1.1 Beendigung der atypischen Unterbeteiligung1.2 Veräußerung der atypischen Unterbeteiligung1.3 Verfahrensrechtliche Besonderheiten1.4 Gewerbesteuer2 Unterbeteiligung an einer gewerblich geprägten Personengesellschaft3 Unterbeteiligung an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft4 Unterbeteiligung an einer GmbHLiteraturverzeichnisDie AutorinStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-5438-4
Bestell-Nr. 17213-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-5439-1
Bestell-Nr. 17213-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-5440-7
Bestell-Nr. 17213-0150
Jessica Schleicher
Stille Gesellschaft und Unterbeteiligung
1. Auflage, Dezember 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © Stoffers Grafik-Design, Leipzig
Produktmanagement: Rudolf Steinleitner
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort
In der Praxis bieten die stille Gesellschaft und die Unterbeteiligung eine Möglichkeit zur Gestaltung von Rechtsbeziehungen, um beispielsweise die Verlustnutzung oder die Gewinnverteilung zu optimieren. Die Gründung einer solchen Gesellschaft birgt aber nicht nur Vorteile, sondern auch diverse Nachteile. Diese sollten in den entsprechenden Entscheidungsprozess einbezogen werden.
Mit der stillen Gesellschaft und der Unterbeteiligung sind zudem spannende und vielfältige – zum Teil (höchst-)richterlich noch ungeklärte – Rechtsfragen verbunden. Insbesondere die steuerrechtlichen Folgen sind mannigfaltig und noch nicht abschließend geklärt. Dies wird bereits mit Blick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Mitunternehmerstellung des stillen Gesellschafters deutlich.
In diesem Buch wird die stille Gesellschaft gesellschaftsrechtlich und steuerrechtlich beleuchtet. Die steuerrechtlichen Folgen von der Gründung bis zur Beendigung der stillen Gesellschaft werden aufgezeigt. Auch die Unterbeteiligung, für die keine gesellschaftsrechtlichen Regelungen existieren, wird thematisiert.
Dabei wird nicht zwingend die herrschende Meinung oder die Meinung der Finanzverwaltung dargestellt, sondern ausschließlich die persönliche Ansicht der Verfasserin. Eine vollumfängliche Darstellung von Meinungsstreitigkeiten erfolgt nicht.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit habe im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.
Bergisch Gladbach im Oktober 2024,
Jessica Schleicher
Abkürzungsverzeichnis
a. A.
andere Ansicht
ABl L
Amtsblatt der Europäischen Union (bis Januar 2003: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften); Reihe »L« betrifft Rechtsvorschriften
Abs.
Absatz
Abschn.
Abschnitt
AcP
Archiv für die civilistische Praxis (Fachzeitschrift)
ADHGB
Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch vom 31. Mai 1861
a. E.
am Ende
a. F.
Alte Fassung
AG
Aktiengesellschaft
AktG
Aktiengesetz
Alt.
Alternative
AnwBl
Anwaltsblatt. Das Fachmagazin für Anwältinnen und Anwälte
AO
Abgabenordnung
ApoG
Gesetz über das Apothekenwesen – Apothekengesetz
Art.
Artikel
AStG
Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen
Az.
Aktenzeichen
BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
BB
Betriebs-Berater (Fachzeitschrift)
BeckVerw
Datenbank der Verwaltungserlasse in beck-online (Verlag C.H. Beck)
BeurkG
Beurkundungsgesetz
BFH
Bundesfinanzhof
BFHE
Sammlung der amtlichen Entscheidungen des Bundesfinanzhofes
BFH/NV
Sammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofes, die nicht in der amtlichen Sammlung des BFH (BFHE) veröffentlicht werden
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHZ
Sammlung der amtlichen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
BiRiLiG
Gesetz zur Durchführung der Vierten, Siebenten und Achten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts (Bilanzrichtlinien-Gesetz – BiRiLiG) vom 19.12.1985, BGBl I 1985, 2355
BRAO
Bundesrechtsanwaltsordnung
bspw.
beispielsweise
BStBl
Bundessteuerblatt
BT-Drucksache
Drucksache Deutscher Bundestag
bzw.
beziehungsweise
DB
Der Betrieb (Fachzeitschrift)
DNotZ
Deutsche Notar-Zeitschrift
DrittelbG
Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz – DrittelbG)
DStZ
Deutsche Steuer-Zeitung (Fachzeitschrift)
EFG
Entscheidungen der Finanzgerichte (Zeitschrift)
Einf.
Einführung
Einl.
Einleitung
EStDV
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
EStG
Einkommensteuergesetz
EStH
Amtliches Einkommensteuer-Handbuch
EStR
Einkommensteuer-Richtlinien
etc.
et cetera
EWIV
Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung
EWIV-AG
Gesetz zur Ausführung der EWG-Verordnung über die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV-Ausführungsgesetz)
EWIV-VO
Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des Rates vom 25. Juli 1985 über die Schaffung einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) – ABl EG Nr. L 199 S. 1
FamFG
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FamRZ
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
f. bzw. ff.
folgend(e)
FG
Finanzgericht
FR
FinanzRundschau – Zeitschrift für das gesamte Ertragsteuerrecht
GBO
Grundbuchordnung
GbR
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GenG
Genossenschaftsgesetz
GewO
Gewerbeordnung
GewStG
Gewerbesteuergesetz
GewStH
Gewerbesteuer-Hinweise
GewStR
Gewerbesteuer-Richtlinien
GG
Grundgesetz
GmbHG
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GrEStG
Grunderwerbsteuergesetz
GrS
Großer Senat
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz
GwG
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)
HGB
Handelsgesetzbuch
Hrsg.
Herausgeber
i. d. F.
in der Fassung
i. d. R.
in der Regel
InsO
Insolvenzordnung
i. S. v.
im Sinne von
i. V. m.
in Verbindung mit
JR
Juristische Rundschau
JZ
JuristenZeitung (Zeitschrift)
KG
Kommanditgesellschaft
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien
KÖSDI
Kölner Steuerdialog (Zeitschrift)
KStG
Körperschaftsteuergesetz
KStH
Amtliches Körperschaftsteuer-Handbuch
KStR
Körperschaftsteuer-Richtlinien
KWG
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz)
lit.
littera (Buchstabe)
LStDV
Lohnsteuer-Durchführungsverordnung
LStH
Amtliches Lohnsteuer-Handbuch
MDR
Monatszeitschrift für Deutsches Recht (Zeitschrift für Zivil- und Zivilverfahrensrecht)
MHdB GesR II
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 2, Kommanditgesellschaft, GmbH & Co. KG, Publikums-KG, Stille Gesellschaft (siehe Literaturverzeichnis)
MittBayNot
Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern (Fachzeitschrift)
MoPeG
Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG) vom 10.08.2021, BGBl I 2021, 3436
m. w. N.
mit weiteren Nachweisen
NJW
Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
NJW-RR
Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungs-Report (Zeitschrift)
NZG
Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
Rz.
Randziffer(n)
OFD
Oberfinanzdirektion
OHG
Offene Handelsgesellschaft
OLGZ
Entscheidungssammlung der Oberlandesgerichte in Zivilsachen
PartGG
Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe
RFH
Reichsfinanzhof
RG
Reichsgericht
RGZ
Entscheidungen des Reichgerichts in Zivilsachen
rkr.
rechtskräftig
RNotZ
Rheinische Notar-Zeitschrift
RPflG
Rechtspflegergesetz
S.
Seite(n)
SCE
Societas Cooperativa Europaea (Europäische Genossenschaft)
SCEAG
Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen Genossenschaft (SCE) (SCE-Ausführungsgesetz – SCEAG)
SCEVO
Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen Genossenschaft (SCE)
SE
Societas Europaea (Europäische Gesellschaft)
SEAG
Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 08. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Ausführungsgesetz – SEAG)
SEVO
Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 08. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), ABl L 294 vom 10.11.2001, S. 1
SolzG 1995
Solidaritätszuschlaggesetz 1995
SpkG NRW
Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen
SpkO
Verordnung über die Organisation und den Geschäftsbetrieb der Sparkassen (Sparkassenordnung – SpkO), Bayern
StFG
Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarkt- und eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Stabilisierungsfondsgesetz – StFG)
Ubg
Die Unternehmensbesteuerung (Fachzeitschrift)
UG (haftungsbeschränkt)
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
UmwG
Umwandlungsgesetz
UmwStG
Umwandlungssteuergesetz
UStAE
Umsatzsteuer-Anwendungserlass
UStG
Umsatzsteuergesetz
usw.
und so weiter
VAG
Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG)
vGA
Verdeckte Gewinnausschüttung
VwGO
Verwaltungsgerichtsordnung
WM
Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
WpHG
Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG)
WStBG
Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung des Erwerbs von Anteilen an sowie Risikopositionen von Unternehmen des Finanzsektors durch den Fonds »Finanzmarktstabilisierungsfonds – FMS« und der Realwirtschaft durch den Fonds »Wirtschaftsstabilisierungsfonds – WSF« (Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetz – WStBG)
ZEV
Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
ZIP
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZPO
Zivilprozessordnung
5. VermBG
Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer (Fünftes Vermögensbildungsgesetz – 5. VermBG)
A Stille Gesellschaft
I Zivilrecht
1 Rechtsnatur bzw. Wesen der stillen Gesellschaft
Stille Gesellschaft, RechtsnaturDie stille Gesellschaft ist seit dem Mittelalter bekannt (Keul in MHdB GesR II, § 72, Rz. 3; Schäfer, Gesellschaftsrecht, § 27, Rz. 2) und stellt damit eine der ältesten Varianten der kaufmännischen Betätigungsformen dar (Jung in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 3.1). Eine klare Trennung zwischen der stillen Gesellschaft und der Kommanditgesellschaft ist seit 1861 im Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch (kurz: ADHGB) gesetzlich manifestiert und setzt sich im HGB vom 10.05.1897 fort (Keul in MHdB GesR II, § 72, Rz. 5; Jung in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 3.7).
Gesetzliche Regelungen zur stillen Gesellschaft sind seit dem Gesetz zur Durchführung der Vierten, Siebenten und Achten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts (Bilanzrichtlinien-Gesetz – BiRiLiG) vom 19.12.1985 (BGBl I 1985, 2355) in den Vorschriften § 230 HGB bis § 236 HGB zu finden. Mit dem Bilanzrichtlinien-Gesetz wurden die Normen betreffend die stille Gesellschaft, die bis dahin in § 335 bis § 342 HGB a. F. zu finden waren, im Handelsgesetzbuch »örtlich« versetzt. Eine inhaltliche Änderung ging damit allerdings gerade nicht einher, vgl. BT-Drucksache 10/317, 74. Eine Definition der Rechtsform »stille Gesellschaft« ist in den vorgenannten Normen jedoch nicht – bzw. nur sehr oberflächlich unter Darstellung der kennzeichnenden Merkmale dieses Gesellschaftstyps – enthalten (Koenigs, Die stille Gesellschaft, S. 3; Keul in MHdB GesR II, § 72, Rz. 9; Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 4.1; K. Schmidt in MüKo HGB, § 230 HGB, Rz. 1). Dies unterscheidet die heutigen Regelungen zur stillen Gesellschaft von denen im Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch vom 31.05.1861. Im ADHGB ist eine – wenn auch unvollständige und zum Teil in der Literatur kritisierte – Begriffsbestimmung zu finden (Koenigs, Die stille Gesellschaft, S. 3). Art. 250 ADHGB enthält nämlich die folgende Begriffsdefinition:
»Eine stille Gesellschaft ist vorhanden, wenn sich jemand an dem Betriebe des Handelsgewerbes eines Anderen mit einer Vermögenseinlage gegen Antheil an Gewinn und Verlust beteiligt. Zur Gültigkeit des Vertrages bedarf es der schriftlichen Abfassung oder sonstiger Förmlichkeiten nicht.«
Art. 250 ADHGB
Unter Berücksichtigung der wachsenden Bedeutung der stillen Gesellschaft in der Praxis, kann sicherlich darüber gestritten werden, ob eine genaue Definition dieser Rechtsform im HGB oder einem anderen Gesetz erstrebenswert ist. Gerade mit Blick auf die Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten erscheinen detaillierte gesetzliche Vorgaben jedoch eher hinderlich. Durch die rudimentären gesetzlichen Regelungen und der übersichtlichen Anzahl von nicht abdingbaren, also zwingenden Vorschriften kann mit der stillen Gesellschaft weitreichend gestaltet werden. Hätte der Gesetzgeber Regelungsbedarf erkannt, hätte meines Erachtens das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG) vom 10.08.2021 (BGBl I 2021, 3436) mit seiner umfassenden Reform des Gesellschaftsrechts einen idealen Zeitpunkt geboten, auch die stille Gesellschaft zu reformieren. In der Gesetzesbegründung zum MoPeG wird die stille Gesellschaft tatsächlich ausdrücklich erwähnt. Dort wird dargelegt, dass für die stille Gesellschaft – unabhängig von der konkreten Ausgestaltung – kein grundlegender Reformbedarf besteht (BT-Drucksache 19/27635, 220). Vielmehr hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die gesetzlichen Regelungen §§ 230 ff. HGB hinreichend flexibel sind, um wirtschaftlich sinnvolle stille Beteiligungsformen entstehen zu lassen (BT-Drucksache 19/27635, 220).
Um sich der stillen Gesellschaft anzunähern und deren Wesen sowie Rechtsnatur umschreiben zu können, ist es erforderlich, die zentralen gesetzlichen Regelungen näher zu beleuchten. Zu den wesentlichen Vorschriften gehören dabei sicherlich die Norm § 230 HGB und § 231 Abs. 2 HGB betreffend die Gewinnbeteiligung eines sich still Beteiligenden.
Auch in der Literatur wird das Wesen der stillen Gesellschaft typischerweise unter Bezugnahme auf die zentrale Vorschrift § 230 HGB erläutert (Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 4.1; Volb, Die stille Gesellschaft, Rz. 2 bis Rz. 6; Koenigs, Die stille Gesellschaft, S. 1 ff.; K. Schmidt in MüKo HGB, § 230 HGB, Rz. 2; Roth in Hopt, HGB, § 230 HGB, Rz. 1). Eine kurze, prägnante Definition der stillen Gesellschaft ist hingegen zumeist nicht zu finden (so auch K. Schmidt in MüKo HGB, § 230 HGB, Rz. 2 m. w. N.). Eine Ausnahme davon stellt die Kommentierung zu § 230 HGB im Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch dar. Dort definiert K. Schmidt unter der Rz. 2 die stille Gesellschaft explizit wie folgt:
»Ist auf Grund des zwischen einem kaufmännischen Rechtsträger (das HGB sagt: Inhaber des Handelsgeschäfts) und einem Anderen (dem stillen Gesellschafter) zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks ein Gesellschaftsvertrag geschlossen worden, kraft dessen der andere ohne Bildung eines Gesellschaftsvermögens mit einer Einlage am kaufmännischen Unternehmen (das HGB sagt: Handelsgewerbe) beteiligt ist und eine Gewinnbeteiligung erhält, so liegt eine stille Gesellschaft iSd HGB vor.«
so K. Schmidt in MüKo HGB, § 230 HGB, Rz. 2
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen §§ 230 ff. HGB und der vorgenannten Definition können insbesondere die folgenden besonderen Merkmale der stillen Gesellschaft abgeleitet werden:
Merke
Die stille Gesellschaft stellt eine Personengesellschaft im Sinne von § 705 Abs. 1 BGB* dar.
Die stille Gesellschaft stellt eine reine Innengesellschaft im Sinne des § 705 Abs. 2 Alt. 2 BGB dar.
Die stille Gesellschaft verfügt über kein Gesellschaftsvermögen im Sinne von § 713 BGB (§ 740 Abs. 1 BGB).
*Bezug genommen wird nachfolgend auf die Vorschriften in der Fassung des MoPeG. Die Neufassung der Vorschriften des BGB tritt gemäß Artikel 16 des MoPeG am 01.01.2024 in Kraft. Die Übergangsvorschriften sind jedoch zu beachten. Ein gesonderter Hinweis, wie »n. F.«, erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit insofern nicht. Sind Vorschriften in der Fassung vor dem MoPeG von Bedeutung, wird dies besonders mit dem Hinweis »a. F.« gekennzeichnet.
1.1 Die stille Gesellschaft als Personengesellschaft
Stille Gesellschaft, PersonengesellschaftTrotz der besonderen Regelung in § 230 Abs. 2 HGB handelt es sich bei der stillen Gesellschaft um eine Personengesellschaft im Sinne von § 705 Abs. 1 BGB (Keul in MHdB GesR II, § 72, Rz. 16 und Rz. 17; Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 4.3; Roth in Hopt, HGB, § 230 HGB, Rz. 2 und Einl. vor § 105 HGB, Rz. 10; BMF-Schreiben vom 11.04.2023, BStBl I 2023, BStBl I 2023, 672, Rz. 4; Schäfer, Gesellschaftsrecht, § 28, Rz. 4; laut K. Schmidt in MüKo HGB, § 230 HGB, Rz. 4 um einen »Spezialfall der Gesellschaft nach § 705 BGB in Form einer Innengesellschaft«). Dies hat bereits Koenigs in seinem Standardwerk »Die stille Gesellschaft« aus 1961 (S. 5 f.) klargestellt. In der Gesetzesbegründung zum MoPeG wird die stille Gesellschaft ebenfalls als Variante der Gesellschaft bürgerlichen Rechts bezeichnet (BT-Drucksache 19/27635, 260).
Die Vorschriften § 705 Abs. 1 und Abs. 2 Alt. 2 BGB i. V. m. §§ 740 ff. BGB können also grundsätzlich ergänzend zu den Normen §§ 230 ff. HGB auf die stille Gesellschaft entsprechend angewendet werden (Jung in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 9.2; Retzlaff in Grüneberg, BGB, Einf. vor § 705 BGB, Rz. 13; K. Schmidt in MüKo HGB, § 230 HGB, Rz. 4 und Rz. 6). Dies gilt allerdings nur dann, wenn in den Vorschriften §§ 230 ff. HGB keine speziellere gesetzliche Regelung zu finden ist. Die Normen §§ 705 ff. BGB sind subsidiär zu berücksichtigen (K. Schmidt in MüKo HGB, § 230 HGB, Rz. 6). Außerdem dürfen die Vorschriften des BGB, die auf die stille Gesellschaft analoge Anwendung finden sollen, nicht dem Wesen dieses besonderen Rechtsinstituts zuwiderlaufen (Jung in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 9.2; K. Schmidt in MüKo HGB, § 230 HGB, Rz. 6). Eine entsprechende Anwendung solcher Regelungen für die stille Gesellschaft scheidet von vornherein aus.
Davon abzugrenzen sind aber die Handelsgesellschaften im Sinne von § 6 Abs. 1 HGB, für die die Vorschriften betreffend Kaufleute Anwendung finden. Die stille Gesellschaft stellt keine (Personen-)Handelsgesellschaft nach § 6 Abs. 1 HGB dar – und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine typische oder atypische Erscheinungsform handelt. Dies wird bereits bei genauerem Blick ins HGB deutlich. Das zweite Buch des HGB ist mit dem Titel »Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft« überschrieben. Dies hat sich durch das MoPeG auch nicht geändert. Würde es sich bei der stillen Gesellschaft um eine Handelsgesellschaft handeln, müsste eine solche Differenzierung gerade nicht erfolgen. Aufgrund erheblicher Unterschiede zwischen KG und OHG sowie stiller Gesellschaft ist diese Differenzierung nur konsequent (vgl. A I 8.5).
Als Personengesellschaft und mangels gesonderter Regelungen in den Vorschriften §§ 230 ff. HGB ist bei der stillen Gesellschaft zunächst § 705 Abs. 1 BGB zu beachten. Dort ist eine Legaldefinition der Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu finden, die für die rechtsfähige und nicht rechtsfähige Gesellschaft gleichermaßen gilt (BT-Drucksache 19/27635, 125). Auch unter Berücksichtigung von MoPeG handelt es sich bei der GbR um die Grundform aller, insbesondere aber der rechtsfähigen, auf eine gewisse Dauer angelegten Personengesellschaften (BT-Drucksache 19/27635, 100, 105). Über die speziellen Verweisregelungen in § 105 Abs. 3 HGB für die OHG, in § 161 Abs. 2 HGB und damit auch auf § 105 Abs. 3 HGB für die KG und in § 1 Abs. 3 PartGG für die Partnerschaft sind die Vorschriften des BGB betreffend die GbR entsprechend anzuwenden. Ein solcher Rückgriff auf die GbR-Vorschriften ist allerdings nur dann möglich, wenn im HGB und im PartGG keine spezielleren Regelungen zu finden sind (BT-Drucksache 19/27635, 105). Die Normen des HGB und des PartGG sind gegenüber dem BGB vorrangig und stellen damit lex specialis dar. Dies zeigt sich auch daran, dass durch das MoPeG zahlreiche Vorschriften, die bisher im HGB zu finden waren und nur für die OHG und KG sowie GmbH & Co. KG galten, ins BGB überführt wurden (BT-Drucksache 19/27635, 106).
Für die stille Gesellschaft wurde eine entsprechende Verweisvorschrift hingegen nicht ins Gesetz aufgenommen. Ohne Probleme – gerade im Zuge des MoPeG – hätte eine solche klarstellende Verweisnorm ins Handelsgesetzbuch in den Vorschriften §§ 230 ff. HGB eingegliedert werden können. Dies wird jedoch – soweit ersichtlich – in der Literatur nicht kritisch diskutiert. Bei der stillen Gesellschaft handelt es sich nach herrschender Meinung um eine Gesellschaft im Sinne von § 705 Abs. 1 BGB, so dass die Vorschriften betreffend die GbR herangezogen werden können (Retzlaff in Grüneberg, BGB, Einf. vor § 705, Rz. 13; Jung in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 9.2; K. Schmidt in MüKo HGB, § 230 HGB, Rz. 4 und Rz. 6).
Zentrales Merkmal der stillen GesellschaftStille Gesellschaft, GesellschaftszweckStille Gesellschaft, Gemeinsame Zweckverfolgung und aller anderen Personengesellschaften ist die gemeinsame Zweckverfolgung durch die Vertragspartner (BGH vom 11.07.1951, II ZR 45/50, BGHZ 3, 75; BGH vom 10.10.1994, II ZR 34/94, BGHZ 127, 176; BGH vom 21.07.2003, II ZR 109/02, BGHZ 156, 38; BFH vom 10.02.1978, III R 115/76, BStBl II 1978, 256; BFH vom 22.07.1997, VIII R 57/95, BStBl II 1997, 755; BFH vom 08.04.2008, VIII R 3/05, BStBl II 2008, 852; BFH vom 28.11.2019, IV R 54/16, BStBl II 2023, 447; BMF-Schreiben vom 11.04.2023, BStBl I 2023, 672, Rz. 4). Bei der stillen Gesellschaft ist damit wesentliches Element das partnerschaftliche Zusammenwirken des Geschäftsinhabers und des stillen Gesellschafters (BFH vom 07.12.1983, I R 144/79, BStBl II 1984, 373). Der stille Gesellschafter und der Inhaber des Handelsgewerbes verfolgen als gemeinsamen Zweck Gesellschaftszweck, Betrieb des Handelsgewerbesden Betrieb des HandelsgewerbesBetrieb des Handelsgewerbes, als gemeinsamer Zweck durch den Geschäftsinhaber selbst, aber im Interesse der Gesellschaft (BFH vom 10.02.1978, III R 115/76, BStBl II 1978, 256; Koenigs, Die stille Gesellschaft, 1961, S. 5). Das Unternehmen wird also auf gemeinsame Rechnung betrieben (vgl. Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 4.7). Der geförderte Zweck Gesellschaftszweck, Bloße Kapitalhingabe unzureichendmuss dabei über eine bloße Kapitalhingabe hinausgehen (BMF-Schreiben vom 11.04.2023, BStBl I 2023, 672, Rz. 4). Unter Berücksichtigung dieses besonderen Kennzeichens muss eine Abgrenzung zwischen der stillen GesellschaftStille Gesellschaft, Abgrenzung sonstige Vertragsverhältnisse und sonstigen Vertragsverhältnissen, wie beispielsweise einem partiarischen Darlehen, erfolgen (siehe beispielsweise BGH vom 10.10.1994, II ZR 34/94, BGHZ 127, 176; BFH vom 10.02.1978, III R 115/76, BStBl II 1978, 256; BFH vom 28.11.2019, IV R 54/16, BStBl II 2023, 447).
1.2 Die stille Gesellschaft als Innengesellschaft
Stille Gesellschaft, InnengesellschaftDie Regelung des § 230 Abs. 2 HGB stellt zudem klar, dass ausschließlich der Inhaber des Handelsgewerbes aus den in dem Betrieb geschlossenen Geschäften allein verpflichtet und berechtigt wird. Zivilrechtlich gibt es also keine Tätigkeit der stillen Gesellschaft (BFH vom 15.10.1998, IV R 18/98, BStBl II 1999, 286; BFH vom 12.11.1985, VIII R 364/83, BStBl II 1986, 311). Werden im Rahmen des Handelsgewerbes Vermögensgegenstände, wie beispielsweise Grundstücke, Fahrzeuge oder Büromaterialien, angeschafft, wird der Inhaber des Handelsgewerbes Partei des Kaufvertrags und letztendlich zivilrechtlicher Eigentümer.
Aus § 230 Abs. 2 HGB ergibt sich, dass es sich bei der stillen Gesellschaft um eine reine Innengesellschaft handelt, die der Ausgestaltung der Rechtsverhältnisse untereinander dient (§ 705 Abs. 2 Alt. 2 BGB; Keul in MHdB GesR II, § 72, Rz. 16; Roth in Hopt, HGB, Einl. vor § 105 HGB, Rz. 10 und § 230 HGB, Rz. 2; Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 4.10). Im Außenverhältnis soll die Gesellschaft nicht auftreten (Retzlaff in Grüneberg, BGB, § 705 BGB, Rz. 3; BGH vom 24.02.1954, II ZR 3/53, BGHZ 12, 308). Eine Vertretung sämtlicher Gesellschafter nach außen besteht damit gerade nicht (BGH vom 24.02.1954, II ZR 3/53, BGHZ 12, 308). Dadurch unterscheidet sich die stille Gesellschaft beispielsweise von Außengesellschaften, wie der OHG (§ 124 Abs. 1 HGB; laut Regelstatut des HGB ist jeder Gesellschafter zur Vertretung der OHG befugt, sofern im Gesellschaftsvertrag keine abweichende Regelung zu finden ist, so § 124 Abs. 2 HGB) und der KG (§ 170 Abs. 1, § 161 Abs. 2 i. V. m. § 124 Abs. 1 (entsprechend) HGB). Im Gegensatz zu Außengesellschaften, wie die OHG (§ 105 Abs. 2 HGB) oder KG (§ 161 Abs. 2 i. V. m. § 105 Abs. 2 HGB), ist die Innengesellschaft gerade nicht rechtsfähig.
Seit dem MoPeG kann in diesem Zusammenhang auch auf eine Legaldefinition im Gesetz zurückgegriffen werden. Das BGB sieht nun explizit zwei Rechtsformvarianten der GbR vor, nämlich die rechtsfähige und die nicht rechtsfähige Gesellschaft (BT-Drucksache 19/27635, 103). In § 705 Abs. 2 BGB sind die Legaldefinitionen dazu zu finden. Eine Gesellschaft, die selbst Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen kann, stellt also gemäß § 705 Abs. 2 Alt. 1 BGB eine rechtsfähige Gesellschaft dar, wenn diese nach dem gemeinsamen Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnehmen soll. Ggf. ist ein Rückgriff auf die Vermutungsregelung des § 705 Abs. 3 BGB erforderlich. Regelungen zu den rechtsfähigen Gesellschaften sind in den Vorschriften § 706 bis § 739 BGB enthalten. Eine Legaldefinition der nicht rechtsfähigen Gesellschaft ist in § 705 Abs. 2 Alt. 2 BGB zu finden. Eine nicht rechtsfähige Gesellschaft liegt vor, wenn diese den Gesellschaftern untereinander zur Ausgestaltung ihres Rechtsverhältnisses dient. Weitere gesetzliche Regelungen zur nicht rechtsfähigen Gesellschaft sind in § 740 bis § 740c BGB enthalten. Dort wird die fehlende Vermögensfähigkeit (§ 740 Abs. 1 BGB), die Beendigung der Gesellschaft (§ 740a BGB), die Auseinandersetzung (§ 740b BGB) und das Ausscheiden eines Gesellschafters (§ 740c BGB) geregelt.
Die stille Gesellschaft selbst soll gerade nicht am Rechtsverkehr teilnehmen (Retzlaff in Grüneberg, BGB, Einf. v. § 705 BGB, Rz. 13). Die Geschäfte dieser Innengesellschaft werden durch einen der Gesellschafter oder durch einen beauftragten Dritten im eigenen Namen und im Innenverhältnis für Rechnung der Gesellschaft geführt (BGH vom 24.02.1954, II ZR 3/53, BGHZ 12, 308). Für Außenstehende, wie den Vertragspartner, ist die Gesellschaft dabei nicht erkennbar (BGH vom 24.02.1954, II ZR 3/53, BGHZ 12, 308). Bei der stillen Gesellschaft handelt es sich also – unabhängig von der konkreten Erscheinungsform – um eine nicht rechtsfähige Gesellschaft im Sinne von § 705 Abs. 2 Alt. 2 BGB. Ob die besonderen Vorschriften in §§ 740 ff. BGB auch für die stille Gesellschaft von Bedeutung sind und zur Anwendung kommen, wird in den nachfolgenden Kapiteln zu den jeweiligen Themen erörtert.
Die Innengesellschaft ist im Gegensatz zur Außengesellschaft nicht Trägerin von Rechten und Pflichten (Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 4.11; K. Schmidt in MüKo HGB, § 230, Rz. 7 und Rz. 8). Verbindlichkeiten gegenüber der stillen Gesellschaft und Forderungen der stillen Gesellschaft gegenüber anderen Rechtspersönlichkeiten kann es folglich nicht geben. Infolgedessen ist die stille Gesellschaft auch im Zivilprozess nicht parteifähig; sie kann weder Klägerin (aktive Parteifähigkeit) noch Beklagte (passive Parteifähigkeit) sein (Keul in MHdB GesR II, § 72, Rz. 18; Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 4.12). Die fehlende Parteifähigkeit im Zivilprozess ergibt sich aus § 50 ZPO, der die Parteifähigkeit an die Rechtsfähigkeit knüpft. Da die stille Gesellschaft aber nicht rechtsfähig ist, ist deren Parteifähigkeit abzulehnen. Auch im Verwaltungsgerichtsverfahren kann die stille Gesellschaft gemäß § 61 VwGO keine Beteiligte sein. Bei der stillen Gesellschaft handelt es sich nämlich weder um eine natürliche oder juristische Person (§ 61 Nr. 1 VwGO) noch um eine Vereinigung, der Rechte zustehen können (§ 61 Nr. 2 VwGO). Die Insolvenzfähigkeit einer stillen Gesellschaft ist unter Bezugnahme auf § 11 InsO ebenfalls nicht gegeben (BT-Drucksache 19/27635, 203; Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 4.12).
Als Innengesellschaft stellt die stille Gesellschaft zudem keine Handelsgesellschaft, wie beispielsweise die OHG, KG und GmbH & Co. KG, im Sinne von § 6 Abs. 1 HGB dar (Roth in Hopt, HGB, § 230 HGB, Rz. 2; Keul inMHdB GesR II, § 72, Rz. 19). Damit können die Vorschriften, die für Kaufleute gelten, für die stille Gesellschaft gerade nicht angewendet werden. Eine Pflicht zur Eintragung der stillen Gesellschaft bzw. der stillen Beteiligung ins Handelsregister besteht grundsätzlich (Ausnahme: Teilgewinnabführungsvertrag bei Aktiengesellschaften, § 294 AktG) nicht; § 29 HGB sieht eine entsprechende Verpflichtung laut explizitem Wortlaut nur für Kaufleute vor.
Auch die Eintragung in das Gesellschaftsregister (siehe auch: Verordnung über die Einrichtung und Führung des Gesellschaftsregisters vom 16.12.2022, BGBl I 2022, 2422) im Sinne des § 707 BGB ist für die stille Gesellschaft konsequenterweise nicht vorgesehen. In dieses Register sollen aus Gründen der Publizität nur rechtsfähige Gesellschaften bürgerlichen Rechts eingetragen werden können (BT-Drucksache 19/27635, 2, 108).
Am 27.06.2017 wurde in Deutschland zur Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.05.2015, Abl L 141/73) ein zentrales elektronisches Transparenzregister eingeführt (BT-Drucksache 18/11555, 1, 125). Gesetzliche Regelungen zu dieser Thematik sind in der Vorschrift § 18 bis § 26a GwG zu finden. Daneben gibt es noch diverse Verordnungen, die sich mit dem Transparenzregister beschäftigen, wie beispielsweise die Transparenzregistergebührenverordnung – TrGebV oder die Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung – TrEinV. Gemäß § 18 Abs. 1 GwG wird das Transparenzregister zur Erfassung und Zugänglichmachung von Angaben über den wirtschaftlich Berechtigten eingerichtet. Mit dem Transparenzregister sollen durch die Zugänglichmachung bestimmter Angaben Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindert werden (BT-Drucksache 18/11555, 1, 125).
In § 19 GwG ist die gesetzliche Regelung zu den Angaben betreffend den wirtschaftlich Beteiligten im Transparenzregister zu finden (§ 19a und § 19b GwG betreffen Immobilien). Daraus ergibt sich, welche Angaben zum wirtschaftlich Beteiligten über das Transparenzregister zugänglich gemacht werden (BT-Drucksache 18/11555, 126). Gemäß § 19 Abs. 1 GwG sind im Transparenzregister im Hinblick auf Vereinigungen nach § 20 Abs. 1 Satz 1 GwG und Rechtsgestaltungen nach § 21 GwG folgende Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach § 23 GwG zugänglich zu machen: Vor- und Nachname (Nr. 1), Geburtsdatum (Nr. 2), Wohnort (Nr. 3), Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (Nr. 4) – ergänzend wird an dieser Stelle auf die gesetzliche Regelung des § 19 Abs. 3 GwG hingewiesen– und alle Staatsangehörigkeiten (Nr. 5).
Im Zusammenhang mit dem Transparenzregister und stillen Gesellschaften stellen sich die beiden folgenden zentralen Fragen:
Obliegt der stillen Gesellschaft selbst die Transparenzpflicht?
Muss die stille Beteiligung selbst offengelegt werden?
zu a) Obliegt der stillen Gesellschaft selbst die Transparenzpflicht?
Wer zur Offenlegung von Angaben verpflichtet ist, ergibt sich aus der zentralen Regelung des § 20 Abs. 1 Satz 1 GwG. Gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 GwG haben alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften die Angaben, die die Norm § 19 Abs. 1 GwG nennt, zu den wirtschaftlich Berechtigten dieser Vereinigung einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu halten und der registerführenden Stelle unverzüglich zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen. Diese gesetzliche Pflicht trifft also unter anderem die OHG, KG, GmbH, AG, KGaA, Partnerschaften und UG. Einzelunternehmer und eingetragene Kaufleute trifft diese Pflicht hingegen nicht. Der Wortlaut der Vorschrift § 20 Abs. 1 Satz 1 GwG ist insofern eindeutig. Ab dem 01.01.2024 trifft diese Pflicht unter Berücksichtigung des Wortlauts des Gesetzes aber auch die tatsächlich gemäß § 707 BGB ins Gesellschaftsregister eingetragene rechtsfähige GbR. § 20 Abs. 1 GwG bezieht sich nämlich explizit auf die »eingetragene Personengesellschaft« und nimmt keine Eingrenzung auf Personenhandelsgesellschaften vor.
Wie bereits dargestellt, wird die stille Gesellschaft – unabhängig von der konkreten Ausprägung als typisch oder atypisch stille Gesellschaft – weder ins Handelsregister noch ins Gesellschaftsregister eingetragen. Auch eine Eintragung ins Genossenschafts-, Vereins- oder Partnerschaftsregister ist nicht vorgesehen. Es handelt sich zivilrechtlich um eine reine Innengesellschaft im Sinne von § 705 Abs. 2 Alt. 2 BGB.
Die Transparenzpflichten des § 20 Abs. 1 Satz 1 GwG erstrecken sich damit meines Erachtens nicht auf die stille Gesellschaft (höchstrichterlich nicht geklärt). Die Ausprägungsform der stillen Gesellschaft – typisch oder atypisch – dürfte dabei keine Rolle spielen. Damit ist die stille Gesellschaft nicht dazu verpflichtet, die entsprechenden Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu halten und der registerführenden Stelle unverzüglich zur Eintragung ins Transparenzregister mitzuteilen. Eine Mitteilungspflicht der typisch stillen Gesellschaft dürfte damit eindeutig abzulehnen sein (so auch Walter/Becker in Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz, § 20 GwG, Rn. 30 – aktuelle Rechtsprechung ist aber zu beachten). Bei der atypisch stillen Gesellschaft kann diese Thematik allerdings kontrovers diskutiert werden (vgl. Walter/Becker in Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz, § 20 GwG, Rn. 32).
Auch § 21 GwG, in dem Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen zu finden sind, ist für die stille Gesellschaft nicht einschlägig.
zu b) Muss die stille Beteiligung selbst offengelegt werden?
Besteht eine Offenlegungspflicht, muss als nächstes allerdings geprüft werden, ob die stille Beteiligung selbst offengelegt werden muss. Die Offenlegungspflicht trifft gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 GwG juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften. Eingetragene Kaufleute und Einzelunternehmer sind genau wie stille Gesellschaften und die nicht ins Gesellschaftsregister eingetragene GbR selbst von § 20 Abs. 1 Satz 1 GwG allerdings nicht erfasst. Damit muss ein stiller Gesellschafter, der sich an einem Einzelunternehmen oder einer nicht ins Gesellschaftsregister eingetragenen GbR beteiligt, nicht offengelegt werden. Auch die Frage des Erfüllens der Voraussetzungen eines wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 GwG kommt es hierbei nicht an.
Dafür stellt sich die Frage, ob der stille Gesellschafter als wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des GwG einzustufen ist, über den die in § 19 Abs. 1 GwG aufgeführten Angaben einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu halten und der registerführenden Stelle unverzüglich zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen sind. Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 GwG gilt für Vereinigungen im Sinne von § 20 Abs. 1 Satz 1 GwG, also für juristische Personen des Privatrechts mit Ausnahme rechtsfähiger Stiftungen und für eingetragene Personengesellschaften, die gesetzliche Regelung des § 3 Abs. 1 und Abs. 2 GwG entsprechend. Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des GwG ist laut § 3 Abs. 1 Satz 1 GwG die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person, sonstige Gesellschaft oder eine Rechtsgestaltung gemäß § 3 Abs. 3 GwG letztlich steht (Nr. 1) oder auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird (Nr. 2). Insbesondere die in § 3 Abs. 2 GwG aufgeführten natürlichen Personen zählen nach § 3 Abs. 1 Satz 2 GwG zu den wirtschaftlich Berechtigten. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 GwG gehört zu den wirtschaftlich Beteiligten jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile hält (Nr. 1), mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert (Nr. 2) oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt (Nr. 3). Dabei ist allerdings der genaue Wortlaut der Vorschrift § 3 Abs. 2 Satz 1 GwG zu beachten. Insbesondere nimmt § 3 Abs. 2 Satz 1 GwG Bezug auf § 2 Abs. 11 WpHG.
Zur Beurteilung, ob es sich bei dem stillen Gesellschafter um einen wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des GwG handelt, dürfte eine Unterscheidung zwischen typisch und atypisch stiller Gesellschaft zwingend notwendig sein.
Bei der typisch stillen Gesellschaft nach dem Regelstatut des HGB in §§ 230 ff. HGB, ist der stille Gesellschafter am Gewinn und ggf. am Verlust, jedoch nicht an den stillen Reserven beteiligt (§ 231 HGB) und ihm steht ein Informationsrecht gemäß § 233 HGB i. V. m. § 166 HGB entsprechend zu. Unter Berücksichtigung dieser Merkmale kann nicht davon ausgegangen werden, dass die natürliche Person, die sich typisch still beteiligt, Kontrolle über die juristische Person oder sonstige Gesellschaft ausübt. Die Tatbestandsmerkmale des § 3 Abs. 2 GwG sind nicht erfüllt. Typischerweise handelt es sich bei der Fallkonstellation des typisch stillen Gesellschafters gerade nicht um einen wirtschaftlich Berechtigten im Sinne von § 3 GwG, dessen Angaben offengelegt werden müssen. Die Angaben von typisch stillen Gesellschaftern müssen damit nicht im Transparenzregister offengelegt werden (so Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 2.17; Blaurock/Pordzik, NZG 2019, 413, 416; höchstrichterlich aber nicht geklärt; aktuelle Literatur und Rechtsprechung sind zu beachten).
Bei der atypisch stillen Beteiligung kann und wird dies hingegen kontrovers diskutiert werden (ausführlich mit Hinweis auf unterschiedliche Auffassungen: Blaurock/Pordzik, NZG 2019, 413, 416 und Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 2.17a). Im Geldwäschegesetz wird die stille Gesellschaft an keiner Stelle explizit genannt. Zudem wird die stille Gesellschaft oftmals gerade deshalb genutzt, um der Publizität zu umgehen. Karsten Schmidt bejaht die Offenlegung der stillen Beteiligung im Transparenzregister, wenn der stille Gesellschafter Kontrollmöglichkeiten ausüben kann (siehe K. Schmidt in MüKo HGB, § 230 HGB, Rz. 11). Auch Blaurock vertritt diese Auffassung (Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 2.17a; Blaurock/Pordzik, NZG 2019, 413, 416). Dabei wird insbesondere auf den weiten Kontrollbegriff des GwG hingewiesen (Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 2.17a; Blaurock/Pordzik, NZG 2019, 413, 416). Eine einheitliche Aussage zu allen atypisch stillen Gesellschaftern lässt sich meines Erachtens an dieser Stelle allerdings nicht treffen. Unter Berücksichtigung der Regelungen des GwG muss in jedem Einzelfall geprüft werden, welche Vereinbarungen der stillen Gesellschaft konkret zugrunde liegen. Ob der stille Gesellschafter also aufgrund von Kontrollmöglichkeiten die Grenze zum wirtschaftlich Berechtigten überschreitet. Dabei dürfte es aber nicht ausreichen, wenn dem stillen Gesellschafter gesellschaftsvertraglich bzw. unter Verweis auf die Regelungen des HGB lediglich Informationsrechte gemäß § 233 HGB i. V. m. § 166 HGB eingeräumt werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit empfiehlt sich ggf. eine »informationsfreundliche Vorgehensweise« (so Blaurock/Pordzik, NZG 2019, 413).
1.3 Kein Gesellschaftsvermögen
Stille Gesellschaft, kein eigenes GesellschaftsvermögenDie gesetzlichen Regelungen zur stillen Gesellschaft (§ 230 HGB) verdeutlichen, dass eine stille Gesellschaft kein Gesellschaftsvermögen hat (Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 4.7; K. Schmidt in MüKo HGB, § 230 HGB, Rz. 9; BGH vom 25.04.2006, 1 StR 519/05, NJW 2006, 1984 – Ausführungen zur abweichenden Meinung: K. Schmidt in MüKo HGB, § 230 HGB, Rz. 9). Seit MoPeG ergibt sich dies ausdrücklich aus den zivilrechtlichen Vorschriften zur GbR. In § 740 Abs. 1 BGB ist explizit geregelt, dass die nicht rechtsfähige Gesellschaft kein Vermögen hat. Dies zeigt, dass eine Personengesellschaft sehr wohl auch dann gegeben sein kann, wenn es kein Gesellschaftsvermögen gibt. § 713 BGB kann weder unmittelbar noch entsprechend Anwendung (kein entsprechender Verweis in § 740 Abs. 2 BGB) auf die stille Gesellschaft finden. Der Regelungsinhalt dieser besonderen Norm widerspricht vielmehr dem gesetzlich normierten Wesen der stillen Gesellschaft (vgl. § 230 HGB) – Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 4.8. Das Fehlen von Gesellschaftsvermögen stellt eine zwingende Rechtsfolge aus der Eigenschaft der stillen Gesellschaft als reine Innengesellschaft dar. Da die stille Gesellschaft selbst nicht Trägerin von Rechten und Pflichten sein und damit auch keine Vermögensgegenstände erwerben kann, ist die Entstehung von Gesellschaftsvermögens ausgeschlossen (Keul in MHdB GesR II, § 72, Rz. 22; Roth in Hopt, HGB, § 230 HGB, Rz. 25). Die Einlage des Stillen geht gemäß § 230 Abs. 1 HGB in das Vermögen des Inhabers des Handelsgewerbes über. Im Gesetz wird damit klargestellt, dass die Einlage des Stillen gerade nicht dazu führt, dass Gesellschaftsvermögen der stillen Gesellschaft entsteht.
Obwohl es sich bei der stillen Gesellschaft um eine Personengesellschaft handelt, verfügt diese zivilrechtlich also über Stille Gesellschaft, kein eigenes Gesellschaftsvermögenkein Gesellschaftsvermögen gemäß § 713 BGB, so § 740 Abs. 1 BGB. Vom Gesellschaftsvermögen strikt zu trennen ist das steuerliche Betriebsvermögen, das bei der atypisch stillen Gesellschaft eine zentrale Rolle spielt (siehe: A III 3.6).
2 Gründe für und gegen eine stille Gesellschaft
Stille Gesellschaft, Gründe fürDie Gründe, die für die unternehmerische Betätigung in der Rechtsform einer stillen Gesellschaft sprechen, sind mannigfaltig. Geschäftsinhaber und stiller Gesellschafter können dabei unterschiedliche Interessen verfolgen. Nachfolgend werden verschiedene Gründe für die beteiligten Parteien dargelegt. Diese Zusammenstellung ist allerdings nicht abschließend; weitere Interessen und Ziele, die mit der stillen Gesellschaft verfolgt werden können, sind zweifelsohne denkbar.
Die Gründung einer stillen Gesellschaft ist für die beteiligten Parteien aber nicht ausschließlich mit positiven Folgen verbunden. Aus der Wahl einer solchen Beteiligungsform können sich auch Nachteile ergeben, die in die Entscheidungsfindung einbezogen werden sollten. Eine abschließende Darstellung der Nachteile einer stillen Gesellschaft erfolgt an dieser Stelle jedoch nicht. Weitere Rechtsfolgen, die gegen die Gründung einer stillen Gesellschaft sprechen, sind ohne Weiteres denkbar. Dabei ist zu beachten, dass sich derartige Folgen sehr wohl auch außerhalb und unabhängig vom Steuerrecht ergeben können.
Ob die Gründung einer stillen Gesellschaft – in typischer oder in atypischer Ausprägung – eine geeignete Gestaltung darstellt, macht eine Betrachtung und Beurteilung des Einzelfalls erforderlich. Die Folgen der Gründung einer solchen Gesellschaft sind umfassend zu würdigen und in die Überlegungen einzubeziehen.
2.1 Gründe für den Geschäftsinhaber
Stille Gesellschaft, GeschäftsinhaberMit Gründung einer stillen Gesellschaft kann die Kapitalausstattung eines Unternehmens verbessert werden. Der stille Gesellschafter leistet beispielsweise eine Bareinlage, mit der der Geschäftsinhaber wirtschaften kann. Die Geldbeschaffung über die stille Gesellschaft kann unter Umständen einfacher sein als die Aufnahme eines Bankdarlehens. Die darlehensgebende Bank hat ggf. mehr Mitspracherechte und Einflussnahme auf den Geschäftsinhaber als ein stiller Gesellschafter. Zinszahlungen können im Falle eines Bankdarlehens zudem gewinnunabhängig zu leisten sein. Die stille Gesellschaft ist hingegen durch die Gewinnbeteiligung, die unabdingbar ist, gekennzeichnet. In Verlustjahren sind nach dem Regelstatut des HGB keine Zahlungen an den sich still Beteiligenden zu leisten. Zudem können mit dem stillen Gesellschafter längerfristige Arrangements getroffen werden (Blaurock in Blaurock, Handbuch Stille Gesellschaft, Rz. 2.6).
Die stille Beteiligung bietet sich auch im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung an. Dadurch können besondere Anreize für Mitarbeiter geboten und deren Bindung an dem Unternehmen gesteigert werden. Außerdem sind die Vorschrift § 2 Abs. 1 Nr. 1 lit. i) 5. VermBG (Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer) und § 3 Nr. 39 EStG zu beachten.
Für den Geschäftsinhaber kann zudem die fehlende Publizität der stillen Gesellschaft von besonderer Bedeutung sein. Stille Gesellschaften müssen im Vergleich beispielsweise zur KG (siehe u. a.: § 161 Abs. 2 i. V. m. § 106 HGB, § 162 HGB, § 12 HGB), die deutliche Ähnlichkeiten zur stillen Gesellschaft aufweisen kann, gerade nicht ins Handelsregister eingetragen und damit für Außenstehende offengelegt werden. Auch eine Eintragung ins Gesellschaftsregister (vgl. § 707 BGB) ist gesetzlich nicht vorgesehen. Für Geschäfts- und Vertragspartner des Geschäftsinhabers ist die stille Gesellschaft damit nicht ersichtlich. Die fehlende Eintragung ins Handels- und Gesellschaftsregister bringt zudem einen weiteren Vorteil mit sich: die Kosten für eine solche Eintragung fallen nicht an. Dabei ist allerdings zu beachten, dass neben Gesellschafts- und Handelsregister mittlerweile auch ein Transparenzregister existiert. Wie unter A I 1.2 dargestellt, kann bei Erfüllung der im GwG vorgesehenen Tatbestandsmerkmale die Pflicht zur Offenlegung der stillen Beteiligung im Transparenzregister bestehen. Diese Besonderheit ist bei den Überlegungen zu berücksichtigen. Ist die Eintragung ins Transparenzregister erforderlich, ist eine fehlende Publizität nicht mehr gegeben. Es erfolgt zwar unabhängig von den gesetzlichen Regelungen im GwG weiterhin keine Eintragung der stillen Gesellschaft ins Handels- oder Gesellschaftsregister; dennoch werden die in § 19 Abs. 1 GwG genannten Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister offengelegt. Wem und wie Einsichtnahme in das Transparenzregister gewährt wird, ergibt sich aus der gesetzlichen Regelung des § 23 GwG und der Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (TrEinV). Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GwG ist die Einsichtnahme in das Transparenzregister allen Mitgliedern der Öffentlichkeit bei Vereinigungen nach § 20 Abs. 1 Satz 1 GwG und bei Rechtsgestaltungen nach § 21 GwG gestattet. Ein besonderes Interesse muss bei der Person, die Einsicht nehmen will, weder vorliegen noch muss dieses durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu Behörden und Gerichten sind die Informationen, die Mitglieder der Öffentlichkeit erhalten, allerdings eingeschränkt. Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 3 GwG werden dabei der Vor- und Nachname (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 GwG) sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (§ 19 Abs. 1 Nr. 4 GwG) als Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten zugänglich gemacht und übermittelt. Daneben werden noch der Monat und das Jahr der Geburt des wirtschaftlich Berechtigten, sein Wohnsitzland und alle Staatsangehörigkeiten zugänglich gemacht. Weitere Angaben des § 19 Abs. 1 GwG sind für »alle Mitglieder der Öffentlichkeit« nicht zugänglich. Zu beachten ist dabei aber auch § 23 Abs. 2 GwG, auf den vorliegend nicht weiter eingegangen werden soll. Auf Antrag des wirtschaftlich Berechtigten kann die registerführende Stelle die Einsichtnahme ins Transparenzregister und Übermittlung von Daten unter bestimmten Voraussetzungen beschränken. Gemäß § 23 Abs. 4 GwG ist die Einsichtnahme ins Transparenzregister zudem nur nach vorheriger Online-Registrierung des Nutzers möglich. Weitere Informationen zur Registrierung können der offiziellen Webseite zum Transparenzregister entnommen werden.
Bei der Nachfolgeplanung kann die Gründung einer stillen Gesellschaft einen geeigneten Weg darstellen, um die eigenen Interessen und Vorstellungen zur konkreten Nachfolge umzusetzen. Potentielle Nachfolger beteiligen sich als stille Gesellschafter und können so bereits an das Unternehmen herangeführt werden. Mitspracherechte und Kontrollmöglichkeiten des Nachfolgers können schrittweise ausgeweitet werden. Dabei können auch Personen, die keine gesetzlichen Erben sind, als Nachfolger etabliert werden.
Die stille Gesellschaft weist auch mit Blick auf das Steuerrecht deutliche Vorteile auf. Durch die Gründung einer atypisch stillen Gesellschaft an einer Kapitalgesellschaft kann die Verlustnutzung teilweise ermöglicht werden. Aufgrund des Trennungsprinzips sind Verluste, die von der Kapitalgesellschaft erwirtschaftet werden, dort »eingesperrt«. Anteilseigner können im Unterschied zum Mitunternehmer die Verluste nicht steuerlich nutzen. Die Kapitalgesellschaft ist genau wie der jeweilige Anteilseigner (unter Beachtung der konkreten Rechtsform) Rechts- und Steuersubjekt. Zwischen der Ebene der Kapitalgesellschaft und der Ebene der Anteilseigner ist genau zu trennen. Der Anteilseigner erhält Steuersubstrat durch offene oder verdeckte Ausschüttungen der Kapitalgesellschaft; eine Verlustnutzung ist ausgeschlossen. Die eingeschränkte Verlustnutzung kann bei einer Kapitalgesellschaft, die seit mehreren Jahren Verluste erwirtschaftet, misslich sein. Dabei ist insbesondere zu erwähnen, dass sich der 100 %ige Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft noch zusätzlich atypisch still an ebendieser Kapitalgesellschaft beteiligen kann. Da es sich bei der atypisch stillen Gesellschaft um eine Mitunternehmerschaft handelt, gelten insofern ertragsteuerlich die Grundsätze des Transparenzprinzips und die (beschränkte) Verlustnutzung ist möglich. So können Verluste, die die Kapitalgesellschaft zukünftig erwirtschaftet, teilweise steuerlich nutzbar gemacht werden (aber: § 15a EStG). Die Errichtung einer stillen Gesellschaft kann allerdings Auswirkungen auf bestehende Verluste haben. Insbesondere – aber nicht abschließend – wird an dieser Stelle auf § 8c KStG sowie § 10a GewStG hingewiesen.
Außerdem kann durch die atypisch stille Gesellschaft eine Aufteilung und damit letztendlich Verlagerung von Einkünften erfolgen. Diese Gestaltung dürfte gerade im Zusammenhang mit minderjährigen Personen, die ansonsten noch keine eigenen Einkünfte erwirtschaften, oder Ehepartnern von Bedeutung sein. Ggf. wird durch die zugewiesenen Gewinnanteile der Grundfreibetrag nicht erreicht oder zumindest kommt der Spitzensteuersatz nicht zur Anwendung.
Für die Kapitalgesellschaft sieht § 11 Abs. 1 Satz 3 GewStG zudem keinen gewerbesteuerlichen Freibetrag in Höhe von 24.500 € vor. Bei einer atypisch stillen Beteiligung als Mitunternehmerschaft kann § 11 Abs. 1 Satz 3 GewStG hingegen zur Anwendung kommen. Damit kann bei einer GmbH & atypisch Still – obwohl nach außen hin nur die Kapitalgesellschaft als Geschäftsinhaberin tätig sowie berechtigt und verpflichtet wird – der gewerbesteuerliche Freibetrag nun genutzt werden.
2.2 Gründe für den stillen Gesellschafter
Stiller Gesellschafter, Gründe fürDer stille Gesellschafter beteiligt sich typischerweise durch Bareinlage an der stillen Gesellschaft. Mit dieser Beteiligung hat der stille Gesellschafter – gerade in Zeiten von Niedrigzinsen – die Möglichkeit, sein Geld anzulegen und damit Erträge zu erwirtschaften. Die Erträge, die der stille Gesellschafter als Gegenleistung erhält, dürften grundsätzlich höher sein als die Bankzinsen bei einer Anlage oder wenn das Geld im Rahmen eines partiarischen Darlehens eingesetzt wird. Es besteht ggf. allerdings ein Verlustrisiko.
Im Vergleich zur KG und OHG weist die stille Gesellschaft einen weiteren großen Vorteil auf: die fehlende Außenhaftung. Der stille Gesellschafter kann in der Regel zu keinem Zeitpunkt – auch in der Gründungsphase – nicht von Gläubigern des Geschäftsinhabers in Anspruch genommen werden. Eine abweichende gesellschaftsvertragliche Regelung ist allerdings möglich.
Die wirtschaftlichen Folgen, die sich aus der stillen Gesellschaft ergeben, sind für den sich still Beteiligenden zudem gut abschätzbar. Eine Inanspruchnahme durch Gläubiger des Geschäftsinhabers ist nicht möglich. Der stille Gesellschafter kann allenfalls die getätigte Einlage verlieren. Auch im Falle von Dauerverlusten besteht keine Nachschusspflicht (aber: abweichende gesellschaftsvertragliche Vereinbarung möglich).
Der stille Gesellschafter kann zudem mehr Verantwortung für das Unternehmen übernehmen. Die Vorschriften § 233 HGB i. V. m. § 166 HGB entsprechend sehen dies zwar nicht vor; durch individualvertragliche Vereinbarung kann aber vom Regelstatut des HGB abgewichen werden.
2.3 Gründe gegen eine stille Gesellschaft
Stille Gesellschaft, Gründe gegenMit der Errichtung einer stillen Gesellschaft können auch Gefahren – insbesondere auch mit Blick auf das Steuerrecht – einhergehen.
Durch geschickte Vertragsgestaltung kann gezielt zwischen typisch und atypisch stiller Gesellschaft gewählt werden. Da die Rechtsprechung allerdings noch im Fluss ist, können zukünftige höchstrichterliche Entscheidungen erhebliche Auswirkungen auf bestehende Beteiligungsverhältnisse entfalten. In der Vergangenheit hat sich dies insbesondere im Zusammenhang mit der Mitunternehmerstellung des stillen Gesellschafters gezeigt (vgl. BFH vom 13.07.2017, IV R 41/14, BStBl II 2017, 1133 und BFH vom 12.04.2021, VIII R 46/16, BStBl II 2021, 614). Die beiden BFH-Urteile machen deutlich, dass die rechtlichen Fragen rund um stille Gesellschaften noch nicht abschließend geklärt sind und sich im Wandel befinden. Bei Gestaltungen kann dies erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Im Zusammenhang mit stillen Gesellschaften gibt es momentan eine Vielzahl ungeklärter Rechtsfragen. Eine umfassende höchstrichterliche Rechtsprechung existiert zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Bei der atypisch stillen Gesellschaft weichen die steuerrechtliche und die zivilrechtliche Beurteilung erheblich voneinander ab. Durch Errichtung einer atypisch stillen Gesellschaft und damit Mitunternehmerschaft i. S. v. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG kommen die allgemeinen Grundsätze betreffend Mitunternehmerschaften zur Anwendung. Sonderbetriebsvermögen und Ergänzungsbilanzen können nun von Bedeutung sein. Die atypisch stille Gesellschaft verfügt steuerrechtlich »quasi« über Betriebsvermögen; das Vermögen des Geschäftsinhabers wird ertragsteuerlich der atypisch stillen Gesellschaft zugewiesen (A III 2.3). Bei Umstrukturierungsmaßnahmen kann sich infolgedessen die Frage stellen, welche Norm des UmwStG konkret einschlägig ist. Ob beispielsweise die Einbringung in die atypisch stille Gesellschaft erfolgt (ggf. gemäß § 24 UmwStG) oder in das Handelsgewerbe (ggf. gemäß § 20 UmwStG bei Kapitalgesellschaften). Dies kann aufgrund der Unterschiede zwischen Steuerrecht und Zivilrecht Fragen aufwerfen und für erhebliche Unsicherheiten sorgen.
Vergütungen an den GmbH-Geschäftsführer, wie Gehalt und Vorabgewinnausschüttungen, unterfallen mit Gründung einer atypisch stillen Gesellschaft genau wie offene und verdeckte Gewinnausschüttungen den für Mitunternehmerschaften geltenden Grundsätzen. Sonderbetriebseinnahmen, die auch gewerbesteuerliche Auswirkungen nach sich ziehen, liegen vor, wenn der Anteilseigner die Rolle des sich still Beteiligenden übernimmt.