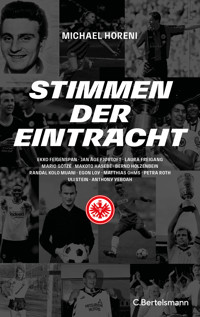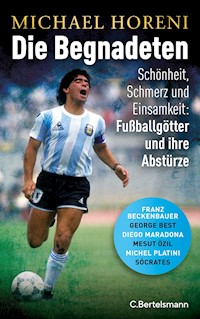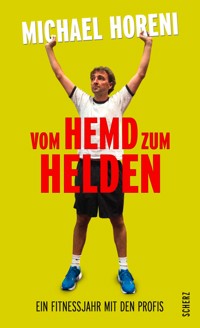20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
»Stimmen der Eintracht« ist ein Buch über zwölf Menschen, zwölf Leben, die verbunden sind mit einem Verein, dem Fußball und seinen Fans. Gleichzeitig sind diese zwölf Lebensgeschichten eingebunden in eine übergreifende Erzählung: die Geschichte von Eintracht Frankfurt. Unabhängig von Zeit und Raum steckt in jedem der zwölf Kapitel die unbändige Freude und Lust des Fußballs – die Kraft und die Faszination, mit der er Menschen seit Generationen verbindet und zusammenführt.
In Band 2 sprechen zu den Fans: Uwe Bein, Timothy Chandler, Kalli Feldkamp, Maurizio Gaudino, Jürgen Grabowski, Robin Koch, Omid Nouripour, Lara Prašnikar, Erich Ribbeck, Alexander Schur, Wolfgang Steubing und Kevin Trapp.
Mit 16-seitiger Farbtafel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
»Stimmen der Eintracht« ist ein Buch über zwölf Menschen, zwölf Leben, die verbunden sind mit einem Verein, dem Fußball und seinen Fans. Gleichzeitig sind diese zwölf Lebensgeschichten eingebunden in eine übergreifende Erzählung: die Geschichte von Eintracht Frankfurt. Unabhängig von Zeit und Raum steckt in jedem der zwölf Kapitel die unbändige Freude und Lust des Fußballs – die Kraft und die Faszination, mit der er Menschen seit Generationen verbindet und zusammenführt.
In Band 2 der Reihe sprechen zu den Fans: Uwe Bein, Timothy Chandler, Kalli Feldkamp, Maurizio Gaudino, Jürgen Grabowski, Robin Koch, Omid Nouripour, Lara Prašnikar, Erich Ribbeck, Alexander Schur, Wolfgang Steubing und Kevin Trapp.
Autor
Michael Horeni, Jahrgang 1965, hat Politische Wissenschaften, Geschichte und Philosophie studiert und war langjähriges Sportredaktionsmitglied der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, zuletzt als Fußballkorrespondent Europa. Er veröffentlichte u. a. »Klinsmann« (2005), »Die Brüder Boateng« (2012), in Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Watzke den Bestseller »Echte Liebe« (2019), »Die Begnadeten« (2022) und zuletzt den ersten Band von »Stimmen der Eintracht« (2024). Horeni, der über zwanzig Jahre als Berichterstatter zuständig für die deutsche Nationalelf war und von 17 Welt- und Europameisterschaften im Fußball berichtet hat, wurde ausgezeichnet mit dem deutschen Fair Play Preis.
MICHAEL HORENI
STIMMEN DER EINTRACHT
Band 2
C.Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2025 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Reproduktion: Lorenz+Zeller GmbH, Inning a. Ammersee
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-33817-6V002
www.cbertelsmann.de
Inhalt
Vorwort: Stimmen der Eintracht
Jürgen Grabowski
Mr. Eintracht
Kevin Trapp
Kämpfernatur mit Fingerspitzengefühl
Lara Prašnikar
Die Angreiferin
Kalli Feldkamp
Der Meister der Endspiele
Robin Koch
Der geborene Verteidiger
Omid Nouripour
Der Fußball-Weltversteher
Uwe Bein
Der Zauberer des tödlichen Passes
Erich Ribbeck
Der Bundestrainer der Eintracht
Timothy Chandler
Die Seele der Kabine
Wolfgang Steubing
Der Möglichmacher
Maurizio Gaudino
Der italienische Adler
Alexander Schur
Der Malocher vom Main
Kurzbiografien
Anmerkungen
Vorwort: Stimmen der Eintracht
Derzeit erlebt Eintracht Frankfurt eine der erfolgreichsten Phasen ihrer über 125-jährigen Geschichte. Der Verein und seine Fans genießen die Erfolge der jüngsten Vergangenheit auch im Wissen um schwierige, enttäuschende und konfliktreiche Zeiten, die mitunter noch nicht lange zurückliegen. Bittere Niederlagen, Rückschläge und Abstiege gehören zur DNA eines der größten Vereine des Landes. Sie sind über Generationen tief verankert in der kollektiven Erinnerung. Mit dem zweiten Band aus der Buchreihe Stimmen der Eintracht setzen wir ein Projekt fort, in dem sich all diese unterschiedlichen Erfahrungen aus den verschiedenen Zeiten spiegeln. Aus der ganz persönlichen Sicht von zwölf Protagonisten der Eintracht werden sie lebendig – und bleiben es.
Die zwölf Kapitel in diesem Band erzählen zwölf Lebensgeschichten, geformt aus dem eigenen Erleben und gesellschaftlichen Prägungen in der jeweiligen Zeit. Jede einzelne dieser Lebensgeschichten ist zudem eingebunden in eine größere Erzählung, in die Geschichte von Eintracht Frankfurt und seiner Anhänger. Stimmen der Eintracht will damit auch die Geschichte des Vereins aus der Perspektive seiner verschiedenen Persönlichkeiten erzählen, ein bisschen auch die des deutschen Fußballs.
Die Beiträge sind in mehreren vielstündigen Gesprächen mit den Protagonisten entstanden. Ihre persönlichen, auch emotionalen Erzählungen und Erinnerungen, bei denen mitunter Tränen fließen, sind in der unmittelbarsten literarischen Form verfasst, der Ich-Erzählung. Eine Ausnahme macht das Kapitel über Jürgen Grabowski, den größten Spieler der Eintracht. Das Kapitel über den in Frankfurt unsterblichen Grabi ist eine fiktionalisierte Ich-Erzählung, die auf seinen Äußerungen zu Lebzeiten fußt.
Dieses Buch erzählt die Geschichten von zwölf Menschen, die mit Eintracht Frankfurt verbunden sind, teilweise ihr ganzes Leben lang. Elf von ihnen sind oder waren Spielerinnen und Spieler, Trainer und Verantwortliche. Von der Lebenserfahrung reicht dieser Band vom 91 Jahre alten Trainer Kalli Feldkamp über seinen Altersgenossen Erich Ribbeck und den Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats und Anteilseigner der Eintracht Frankfurt Fußball AGWolfgang Steubing zu früheren Spielergenerationen mit den beiden Weltmeistern Jürgen Grabowski und Uwe Bein sowie Maurizio Gaudino und Alexander Schur bis zur aktuellen Profigeneration mit KevinTrapp, Robin Koch, Timothy Chandler und LaraPrašnikar, der mit 27 Jahren jüngsten Protagonistin dieses Bands. Hinzu kommt als längst geschlechtsunabhängiger zwölfter Mann im Fußball eine Person des öffentlichen Lebens, die in enger Beziehung zu Eintracht Frankfurt steht: der in Teheran geborene Wahl-Frankfurter und Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour. Der Autor, jahrzehntelang für die Frankfurter Allgemeine Zeitung als Sportjournalist im Topfußball tätig und Politologe, ist selbst gebürtiger Frankfurter und dem Verein seit Kindheit verbunden.
Sportgeschichtlich spannt sich Stimmen der Eintracht von den vergleichsweise bescheidenen und noch stark regional geprägten Anfangsjahren der Bundesliga bis hin zum global geprägten Champions-League-Business unserer Zeit, zu dem mittlerweile die Männer und Frauen von Eintracht Frankfurt gehören. Geografisch und kulturell greift dieser Band vom Herzen Europas über Slowenien, Italien, Iran aus bis auf den amerikanischen Kontinent, glorreich wird es mit den WM-Titeln 1974 und 1990 über den Gewinn des UEFA-Pokals 1980 und der Europa League 2022 bis hin zu den fünf DFB-Pokalsiegen von 1974 bis 2018.
Soziologisch und politisch erzählt dieses Buch etwa auch von den ersten Gastarbeiterkindern und den alltäglichen Diskriminierungen, die in der Enge des deutschen Wirtschaftswunderlands beginnen, aber dort nicht enden, oder den exzessiv geld- und geltungsgetriebenen Achtzigerjahren und den zeitgleichen Integrationserfahrungen eines mit seiner Familie vor Krieg und religiösem Fanatismus geflüchteten Jungen. Es führt weiter zu einem Kind, dessen Vater sich im soldatischen Kampfeinsatz für das amerikanische Militär im Dienst der neuen Weltordnung traumatisch entfernt, und endet beim persönlichen Einsatz einer jungen Frau gegen bis heute existierende Frauenfeindlichkeit, die auch im Fußball sichtbar wird – bei einem gleichzeitigen kommerziellen Boom inklusive kultureller Aufwertung, wie ihn der Frauenfußball zuvor nicht erlebt hat.
Gemeinsam ist allen Geschichten, dass in ihnen eine unbändige Lust auf Fußball steckt – die Kraft und die Faszination, mit der dieser Sport die Menschen immer wieder zusammenführt, wie schwierig die Zeiten auch sein mögen. In Stimmen der Eintracht soll in unseren konfliktreichen Tagen unbedingt spürbar werden, was Fußball für viele Menschen oft ein Leben lang ist, nicht zuletzt bei Eintracht Frankfurt: eine Herzenssache, eine unzerstörbare Liebe.
1 Jürgen Grabowski
Mr. Eintracht
© Vereinsarchiv Eintracht Frankfurt
Es ist vernünftiger,
vor dem Leben Angst zu haben
und nicht vor dem Tod.
Marlene Dietrich,1901 – 1992
Auf der Gegentribüne, die seinen Namen trägt, führt eine Treppe im Herzen von Eintracht Frankfurt hoch zu einem besonderen Ort, zu seinem Erinnerungsort: »Zum Jürgen«.
Schon am Eingang wird Jürgen Grabowski auf einer überlebensgroßen Aufnahme lebendig. Wie er den Ball am Fuß führt, aufrecht, den Blick nach vorne, das Spielfeld überblickend. Der Kapitän trägt das schwarz-rot gestreifte Trikot aus der Saison 1979/80, seiner letzten Saison, in der er mit der Eintracht den UEFA-Pokal gewinnt.
In Grabowskis Bar, die unmittelbar an die Nordwestkurve mit ihren stimmungsgewaltigen Fans grenzt, ist er bei jedem Heimspiel allgegenwärtig. An den Wänden hängen Fotos aus seiner großen Zeit, den Siebzigern. Die Pokalsiege, die Triumphfahrten, die Siegesfeiern auf dem Römer. Mit wehendem Haar, später auch mit Schnauzbart.
Auf den Ecken der Holztische sind dezent die Jahreszahlen eingeprägt, die sich mit seinen Siegen verbinden: 74, 75, 80. Durch die Fenster sehen die gut 300 Fans, die ihm dort bei den Heimspielen nahe sein wollen, direkt auf das Spielfeld, das er wie kein anderer beherrschte. In einem kleinen Seitenraum steht an der Wand weiß auf schwarz, was Jürgen Grabowski für Eintracht Frankfurt bedeutet: ein Spieler, der in 555 Pflichtspielen für Verein und Fans »zum Mythos« wird. Ein Weltmeister, der mit 44 Länderspielen so oft für Deutschland im Einsatz gewesen ist wie bis heute kein anderer Frankfurter. Ein Eintrachtler, der später zweimal als Interimstrainer einspringt, im Verwaltungsrat sitzt und bis zu seinem Tod als Markenbotschafter wirkt. Und der in jedem Heimspiel von den Zuschauern seit Jahren besungen wird, über das Leben hinaus:
»Wir haben die Eintracht im Endspiel gesehen,
mit dem Jürgen, mit dem Jürgen.
Sie spielte so gut und sie spielte so schön,
mit dem Jürgen Grabowski!«
»Zum Jürgen« – an diesem Ort wird die Eintracht-Legende wieder sichtbar, hörbar und fühlbar. Es ist, als spräche Jürgen Grabowski von dort noch einmal zu uns.
Einen Monat nach meinem Tod haben wir im Europapokal gegen den FC Barcelona gespielt. Zu Lebzeiten ist mir so ein Duell gegen diesen Klub nicht vergönnt gewesen, gegen einen Klub, der Künstler liebt, der Fußball als Kunst versteht, genau wie ich.
So ein Spiel, so eine Begegnung hätte ich genossen. Dass sich unsere Fans ausgerechnet einen solchen Gegner ausgesucht haben, um sich von mir zu verabschieden, hat mir natürlich gefallen. Dieses Gespür für den Moment, das gefällt jedem Künstler. »Auferstehen werden nur Götter«, stand an diesem Abend auf einem riesigen Banner in der Kurve, darüber ein Porträt von mir. Mir erschien das vielleicht ein wenig übertrieben, aber ich würde lügen, wenn ich sagte, dass es mir nicht geschmeichelt hätte.
Künstler lieben den Applaus. Mehr noch: Wir brauchen den Applaus, die Bestätigung. Ich habe das auch immer gebraucht, wie die Luft zum Atmen. Dieses Gefühl bei den Menschen über das Leben hinaus zu spüren, ist ein großes Geschenk, größer als das Leben.
Nachdem die Eintracht ein paar Spiele später die Europa League gegen die Glasgow Rangers gewonnen hatte, sprach Axel Hellmann davon, dass die »Metaphysik im Fußball« bei diesem Sieg eine Rolle gespielt habe. Dass es so etwas wie »Bestimmung« gewesen sei, dass die Eintracht ausgerechnet im Jahr meines Tods diesen Titel nach 42 Jahren zurück nach Frankfurt geholt hat. Und dass ihm niemand etwas anderes erzählen könne. Das hat mich berührt, dieses Gespür für die Dinge zwischen Himmel und Erde im Fußball.
Unsterblich wurde ich schon am 7. Juli 1974.
Das sagt man immer im Fußball, wenn jemand Weltmeister wird. Es stimmt ja auch.
Mein Freund Wolfgang Overath war in seiner Karriere von der Vorstellung der Unsterblichkeit getrieben. Das war für ihn der Antrieb, weshalb er nach den Weltmeisterschaften 1966 und 1970 im Alter von dreißig Jahren unbedingt noch die Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland wollte. Mir ging es auch so.
»Du musst Erster werden!
Du bist Zweiter und Dritter geworden.
Jetzt musst du Erster werden!
Die Leute vergessen den Zweiten und Dritten schnell.
Aber den Weltmeister vergessen sie nie!«
Das hat Wolfgang damals zu sich selbst gesagt. Und er hat es zu mir gesagt, denn er wusste, was ich fühle. Bei der Weltmeisterschaft in England waren wir Zweiter geworden, bei der Weltmeisterschaft in Mexiko Dritter. Unvergessene Spiele waren dabei: Das Finale 1966 gegen England mit dem legendären Wembley-Tor – das Halbfinale 1970 gegen Italien, das Jahrhundertspiel. Doch beide haben wir verloren.
Wolfgang und ich hatten unterschiedliche Rollen in der Nationalmannschaft, wir hatten unterschiedliche Temperamente. Aber ich glaube, niemand hat mich als Fußballer besser verstanden.
Der Tag, als ich Weltmeister wurde, fiel auf meinen Geburtstag. Das hatte es zuvor auch noch nicht gegeben. Als wir das Spiel gewonnen hatten und ich Weltmeister war, dachte ich: Die Welt gehört mir.[1][2]
Das dachte ich wirklich, doch nur für einen Moment. Dieser Spruch, das wurde mir schnell klar, ist nur Klischee. Er klingt nach Allmacht, nach Größenwahn. Das sind Gefühle und Vorstellungen, die für manche im Fußball vielleicht attraktiv klingen, die manche vielleicht sogar für erstrebenswert halten. Zu mir hat das nie gepasst.
Mir gehört die Welt – von wegen. Nichts von der Welt gehörte mir, auch nicht als Weltmeister. Was mir gehörte, war meine Kunst. Sie war das Einzige, was ich besitzen wollte. Sie gehörte mir, nur mir. Und sie machte mich frei. Nur der Moment auf dem Rasen konnte mir diese Freiheit schenken.
Als mir klar wurde, dass ich nur meiner Kunst verpflichtet bin, habe ich meinen Rücktritt aus der Nationalelf erklärt. Denn dort war für sie, anders als bei der Eintracht, kein Raum. Und ich glaubte nicht mehr daran, dass ich ihn bekommen würde. Ich bin zurückgetreten, weil ich enttäuscht war während der Weltmeisterschaft.[3] Oft wurde ich gefragt, ob diese Entscheidung richtig war. Ich habe mich das selbst oft gefragt. Ich weiß es nicht, vielleicht hätte es die Freiheit doch gegeben. Doch ich habe das in diesem Moment nicht gespürt. Die Eindrücke der Weltmeisterschaft waren noch zu stark, die negativen Eindrücke.
Ich bin nicht stolz, dass ich diese Entscheidung so getroffen habe.[4] Das war ich nie. Denn ich bin aus Enttäuschung gegangen, nicht aus dem Gefühl der Zufriedenheit, gar des Triumphs, obwohl ich den goldenen Pokal in Händen hielt. Dass während der Weltmeisterschaft meine Kunst nicht geschätzt wurde, dass für sie zeitweilig gar kein Platz mehr vorhanden war, konnte ich nicht vergessen, vielleicht auch nicht verwinden. Wie soll das auch gehen? Entweder man versteht und liebt meine Kunst, oder man versteht und liebt sie nicht. Dazwischen gibt es nichts, nicht für mich.
Bei der Weltmeisterschaft 1974 hatten wir die beiden ersten Spiele der Gruppenphase gewonnen, gegen Chile und Australien. Ich stand in der Startaufstellung. Dann kam das Spiel gegen die DDR. Sparwasser. 0:1. Nichts an diesem Tag hat bei uns geklappt. Es war das Spiel, das wir nicht verlieren durften. Es hatte eine besondere Bedeutung, wir sollten die besseren Deutschen sein. Doch als wir geschlagen und mit gesenkten Köpfen vom Platz schlichen, hat Deutschland die Welt nicht mehr verstanden, West-Deutschland. Und dann wurden Schuldige gesucht für eine Niederlage, die nicht sein durfte. Vier Spieler sind aus der Mannschaft geflogen: Uli Hoeneß, Bernd Cullmann, Heinz Flohe und ich.
Dass sich etwas ändern musste, habe ich akzeptiert. Doch im nächsten Spiel gegen Jugoslawien saß ich nicht einmal auf der Bank. Ich musste auf die Tribüne. Das war ein Schock.[5] Ich war nur noch Zuschauer. Hoeneß und Flohe dagegen durften gegen Jugoslawien auf die Bank, sie wurden bei unserem 2:0-Sieg noch eingewechselt. Doch ich saß auf der Tribüne. Meine Kunst hatte ausgespielt. Wie sollte ich das jemals vergessen?
Von Journalisten war mir zugetragen worden, dass der Bayern-Block mit Franz an der Spitze an dieser Entscheidung beteiligt gewesen sei. Ich fragte dann den Beckenbauer, ob da etwas dran wäre.[6] Er hat das bestritten. Wie weit die Bayern-Vormacht mitwirkte, lasse ich mal im Raum stehen.[7] Aber selbst viele Jahre später, als ich einmal einen Kontakt von ihm wegen meiner Beschwerden am Fuß brauchte, habe ich ihn nicht direkt angerufen. Ich habe einen Freund gebeten, ihn darum zu bitten. Ich wollte Franz nicht direkt fragen. Das war vielleicht übertrieben, aber ich wollte es nicht anders, vielleicht konnte ich auch nicht anders.
Nach meiner aktiven Fußballzeit wurde mir Wolfgang Overath zum Freund. Unsere Beziehung war zu Spielerzeiten noch nicht so eng, wie sie nach der Karriere werden sollte, aber ich fühlte mich ihm schon damals verbunden. Wir waren bei den Weltmeisterschaften in England und Mexiko und hatten die erste Phase der neu gegründeten Bundesliga bei der Eintracht und dem 1. FC Köln erlebt. Wolfgang hatte ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Er sagte später einmal, was ich nie gesagt hätte, obwohl es genau so gewesen ist:
»Eintracht Frankfurt war Grabowski.
HSV war Seeler.
Bayern war Beckenbauer.
Und Köln war Overath.«
Wolfgang war der einzige Spieler unserer Mannschaft, der bei den drei Weltmeisterschaften alle Spiele machte, der sich immer durchgesetzt hat, trotz Günter Netzer. Das hat mir imponiert. Bei mir war es anders in der Nationalmannschaft.
Wolfgang hat nach dem DDR-Spiel mit mir gesprochen. Er sagte, es sei von allen ein schlechtes Spiel gewesen. Und jeder habe mal schlechte Tage. Auch der Franz. Und er selbst. Ich solle den Kopf nicht hängen lassen, ich könne der Mannschaft noch helfen. Aber wenn man sensibel sei wie ich, sei man eben auch anfälliger, wenn es schlecht laufe, dann gehe man einfach mit unter, das sei nun mal so. Das sei anders als bei jemand, der mit Kraft und Robustheit dagegenhalten könne. Doch Wolfgang hat an mich geglaubt, das habe ich nie vergessen. Wir wurden echte Freunde, wir kamen uns nahe, immer näher, bis zum Ende.
Im nächsten Spiel bei der Weltmeisterschaft 1974 hat sich mein Ärger in Wut verwandelt. Gegen Schweden saß ich stinksauer auf der Bank,[8] aber immerhin saß ich dort. Schweden ging in der ersten Halbzeit in Führung. Nach der Pause machten wir aus einem 0:1-Rückstand schnell eine 2:1-Führung, aber Schweden schlug zurück. Nach 53 Minuten stand es 2:2. Es lief nicht gut für uns. Deswegen wurde ich eingewechselt. Vielleicht hat mir dann der liebe Gott[9] geholfen, jedenfalls habe ich das vorentscheidende Tor zum 3:2 gemacht. Es war eine schöne Kombination über einige Stationen, der Holz stochert den Ball zu mir, und ich schieße ihn ins Tor. Das war zwölf Minuten vor dem Ende. Uli Hoeneß hat kurz vor Schluss noch einen Elfmeter reingeschossen.[10]
Das Tor gegen Schweden war das Tor meines Lebens.[11] »Jürgen hat uns dieses Spiel gewonnen«, sagte der Franz später.[12] Ich war wieder drin in der Mannschaft. Doch nicht nur das. Dieser Treffer hat mir alles geebnet,[13] meinen gesamten Weg, meine gesamte Karriere.
Das nächste und entscheidende Spiel um den Einzug ins Finale fand in Frankfurt statt: die legendäre Wasserschlacht gegen Polen. Ein schwieriges Spiel, ein schwieriger Platz, tief durchtränkter Rasen, der Ball ist in Pfützen liegen geblieben. Nichts für Techniker, aber wir haben uns durchgesetzt, ich habe mich durchgesetzt.
Im Finale gegen die Niederländer haben wir wieder mit der Frankfurter Flügelzange gespielt. Bernd links, ich rechts. Wir hatten unseren Anteil am Sieg, das steht außer Frage. Bernd bekam den unvergessenen Elfmeter zum 1:1. Und kurz vor der Pause bin ich in der eigenen Hälfte Uli Hoeneß entgegengelaufen, habe ungefähr auf Höhe des Anstoßkreises den Ball von ihm übernommen, habe mich dann mit dem Rücken zur gegnerischen Hälfte in Richtung der Seitenlinie von meinen Gegenspielern abgesetzt. Uli ist gleichzeitig auf der rechten Seite in die Spitze vorgestoßen, blieb dann stehen, als ich das Spiel verlangsamte. In diesem Augenblick ist Rainer Bonhof für die Niederländer überraschend im Sprint nach vorne gestoßen, auf die entblößte rechte Seite. Ich habe ihm den Ball aus dem Stand genau in den Lauf gespielt, sein Weg war frei, erst im Strafraum wurde Rainer attackiert, er hat den Gegner mit seinem Tempovorteil stehen lassen und hat Gerd Müller in zentraler Position vor dem Tor angespielt. Und der Gerd macht sein Gerd-Müller-Tor.
Drehung. Schuss. Tor. 2:1. Abpfiff. Weltmeister.
Mehr geht nicht.
Mehr Glück geht nicht.[14]
Nach dem WM-Titel habe ich anders auf mein Leben geschaut. Ich habe mich an meinen Traum erinnert. Ein Traum, der immer in mir gewesen ist. Ich muss daran denken, wie ich als Zehnjähriger in Biebrich vor einem Radio- und Fernsehgeschäft stand, durch die Scheibe das Finale von 1954 sah. Da spielte ich in einem kleinen Verein, und ich träumte nach dem WM-Sieg davon, wie das wohl wäre, wenn man selbst so etwas erreichen würde wie Fritz Walter und die anderen. Das waren oft nur Sekunden, aber der Traum kam immer wieder.[15]
Ich habe mir viele Gedanken gemacht und vieles zu Herzen genommen, im Fußball und im Leben. Sicher nicht alles, aber doch vieles. Wolfgang hat das verstanden. Und er hat verstanden, dass Sensibilität noch eine andere Seite hat. Eine, die nicht nur empfindsam macht, sondern auch empfindlich.
Meine Entscheidung, die Nationalmannschaft zu verlassen, hatte damit zu tun: Ich konnte nicht aus meiner empfindsamen, empfindlichen Haut. Mit dem Posten als Rechtsaußen, dem ich alles verdanke, war ich nicht zufrieden.[16] Wäre es mir nur um Status und Ruhm gegangen, hätte ich weitermachen müssen, aber das war mir nicht möglich. Ich wollte geben, was ich zu geben habe – und ich konnte nur geben, was ich zu geben habe. Nichts anderes. Ich war ein kreativer Spieler.[17] Es war unter meiner Würde, für meine Kunst zu kämpfen. Entweder man erkennt sie, oder man erkennt sie nicht.
Ich brauchte Freiheit.
Heute kann man sich kaum vorstellen, wie strikt der Fußball damals gewesen ist, wie eng das taktische Korsett, wie wenig Freiheit es gab. Als Rechtsaußen habe ich in der Nationalmannschaft nur wenige Bälle bekommen. Damals war es noch so, dass man an der Linie kleben musste.[18] In der Nationalmannschaft ging es zwar nach vorne, aber anders als bei der Eintracht – durch die Mitte. Und dort ordnete Wolfgang oder Günter das Spiel. Es wurde viel mit Doppelpässen gearbeitet. Ich denke nur an den Franz und den Gerd. Die Außen wurden kaum eingebunden, sind regelrecht verhungert.[19]
Ich musste in jedem Spiel auf Bälle warten, ich war wie gefesselt. Jeder Spieler hatte nur seinen abgezirkelten Raum, ein Raster, aus dem niemand ausbrechen durfte, aus dem ich nicht ausbrechen durfte. Die Trainer glaubten, sonst würde man das Spiel eng machen. Was für ein Irrglaube!
Ich habe immer die Chancen gesehen, die in der Freiheit lagen, die ich in der Nationalelf nicht leben durfte, wie ich sie leben wollte. Ich habe sie gesehen, die unerkannten Möglichkeiten. Aus den wenigen Bällen, die ich bekam, habe ich versucht, das Bestmögliche zu machen. Das war mein Anspruch. Doch ich konnte nicht zeigen, was in mir steckt.[20]Ich war in der Nationalelf nie zufrieden.[21]Im DFB-Team war ich darauf angewiesen, einen Ball, der damals nie so zirkulierte wie heute, zu bekommen. Für mich als kreativen Spieler ein Dilemma, frustrierend, teilweise demütigend.[22]
Nach meinem Tod stand in einer Zeitung, mein Umgang mit Ruhm erinnere an die Schriften des amerikanischen Mythenforschers Joseph Campbell. Der hatte beschrieben, was einen Menschen zum Helden macht.[23] Ein Held ist demnach einer, der in aller Stille aufbricht, hinaus in die Welt geht, sich den Herausforderungen stellt, Widerstände bewältigt und den Triumph erringt. Und dann, das sei entscheidend für den Helden, wieder in die Stille zurückkehrt.
Als Held habe ich mich weniger verstanden. Künstler sind selten Helden. Doch das mit der Rückkehr in die Stille hat mir gefallen.
In der Zeitung stand auch, dass die Leute sich immer an diesen Helden erinnern, dass sie seine Wiederkehr ersehnen. Denn der Held sei schließlich nicht tot, er halte sich nur bedeckt. Als mich Bundestrainer Helmut Schön vier Jahre nach meinem Rücktritt für die Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien zur Nationalmannschaft zurückholen wollte, fühlte sich das für mich ein bisschen so an. Doch ich bin in der Stille geblieben. Ich weiß nicht, das räume ich offen ein, ob die Entscheidung 1974 richtig war, genauso wenig wie 1978.[24]Vielleicht war es ein Fehler. Vielleicht hätte ich noch einmal spielen sollen.[25]
Nach meinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist meine Kunst bei der Eintracht so richtig aufgeblüht. Wolfgang sagte, sie bestünde – neben meiner Technik und meiner Dribbelstärke – insbesondere in meinem außergewöhnlichen Blick für Situationen. Wenn ich als Regisseur auf dem Platz andere in Szene setzte und plötzlich Räume schuf, die keiner gesehen hat; wenn ich mir den Raum genommen habe.
In jener Zeit konnte ich bei der Eintracht meine Freiheit auf dem Platz nutzen wie nie zuvor. Ich habe dann die nächsten sechs Jahre, also im Alter von 30 bis 36, wo es normalerweise ein bisschen weniger wird, meine beste Zeit gehabt – und im Mittelfeld befreit aufgespielt.[26] Es war für mich eine wunderbare Anerkennung, dass Helmut Schön nun erkannte, was wirklich in mir steckt. Dass er meine Kunst in der Nationalelf haben wollte.
Ich habe lange über das Angebot nachgedacht. Ich war hin- und hergerissen. Der Anruf des Bundestrainers war für mich überraschend gekommen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon zugesagt, als Kolumnist für die Abendpost/Nachtausgabe zur Weltmeisterschaft nach Argentinien zu fahren. Ich wollte nun beiden absagen. Doch die Zeitung hat mich aus dem Vertrag entlassen, als ich von der Bitte des Bundestrainers erzählte. Diese Anständigkeit hat mir gefallen.
Enge Freunde sagten zu mir, ich könne nur verlieren, wenn ich zurückkehre. Schön würde mich nur holen, weil er seiner Mannschaft nicht vertraut. Ich weiß nicht, ob es so war. Meine Freunde sahen natürlich die Chancen, die in meiner Rückkehr lagen, aber sie sahen vor allem, dass es ein Vabanque-Spiel für mich wäre. Dass ich zum großen Verlierer werde, wenn wir scheitern. Dass der Held, der zurückgeholt wurde, es vielleicht nicht schafft, dass meine Kunst es nicht schafft.
Natürlich ist mir nicht entgangen, dass nicht alle meine Rückkehr wollten. Die Kölner hatten damals eine starke Lobby in der Nationalmannschaft, fünf Spieler vom FC standen im WM-Kader. Mein Freund Wolfgang gehörte nicht mehr dazu, er war nach dem WM-Sieg auch zurückgetreten. Doch aus Köln hörte ich: »Was brauchen wir den Grabi?«
Das war ein wichtiges Signal. Ein Warnzeichen, dass es zu Konflikten kommen könnte. Konflikte wollte ich nicht, aber noch stärker wuchs das Gefühl, dass ich ohne vollständige Unterstützung meine Kunst wieder beweisen muss. Das wollte ich noch weniger. Ich habe Helmut Schön schließlich abgesagt. Damit war meine Karriere in der Nationalelf endgültig vorbei. Er hat es akzeptiert. »Du weißt genau, wie gern ich dich als Spielerpersönlichkeit in unserer Mannschaft in Argentinien dabeigehabt hätte«, hat Helmut Schön später über mich zu meinem Abschiedsspiel in Frankfurt geschrieben. »Dein Aufstieg zum großen Spieler geschah in einer von jeder Erfolgshektik freien Entwicklung.«[27]
Ich habe mich danach entschieden, doch als Kolumnist nach Argentinien zu fahren. Ich habe das nur aus persönlichen Gründen gemacht, weil mir Sportchef Hartmut Scherzer über die Jahre zum Freund geworden war. In Córdoba haben wir uns dann mehrere Wochen ein Hotelzimmer geteilt.[28]
Meine Entscheidung, als Kommentator bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein, hat sich auch für die Eintracht gelohnt. Nachdem die geplante Verpflichtung von Bruno Pezzey während des Turniers wegen Unstimmigkeiten in puncto Ausländerregelung plötzlich doch noch zu scheitern drohte, habe ich Bruno im WM-Quartier der Österreicher getroffen – dann ließen sich auch die offenen Fragen mit der Eintracht klären.[29]Ein Weltklassespieler, als Abwehrspieler ein Ästhet am Ball,[30] habe ich damals bei der Weltmeisterschaft über ihn geschrieben. Ich war sehr froh, dass er zu uns gekommen ist. Bruno hat dann auch entscheidend dazu beigetragen, dass wir zwei Jahre später den UEFA-Pokal gewonnen haben. Bei unserem 5:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen die Bayern hat er zwei Tore gemacht. Dass sein Wechsel zustande gekommen ist, war mein wichtigster Beitrag bei der Weltmeisterschaft 1978, jedenfalls aus Frankfurter Sicht.
Unser Endspiel von 1974 gegen die Niederlande habe ich mir später nie mehr komplett angesehen. Auch nicht das Halbfinale gegen Italien bei der Weltmeisterschaft 1970, bei dem ich die Flanke zum 1:1 geschlagen hatte, ohne die das Jahrhundertspiel nicht zum Jahrhundertspiel geworden wäre. Unseren Torschützen hat niemand vergessen. Ausgerechnet Schnellinger, wie man so sagt. An meine Vorarbeit erinnern sich die wenigsten, aber sie war wirklich schön. Den Einwurf von Siggi Held habe ich mit einer sensationellen Flanke fast von der Eckfahne aus weitergeleitet zu Schnellinger, der zum 1:1 traf. Verlängerung![31]
In Mexiko wurde ich mit einem Titel ausgezeichnet, von dem viele dachten, ich wäre darauf stolz: Bester Auswechselspieler der Welt. So wurde ich genannt nach dieser Weltmeisterschaft, so wurde ich gesehen. Aber das wollte ich nicht sein.[32] Nie. Ich wollte spielen, meine Kunst zeigen. Das wollen alle Künstler. Das ist der Grund, warum wir existieren. Es gibt keinen anderen. In allen vier Spielen vor dem Jahrhundertspiel war ich Auswechselspieler. Ich kam für Haller gegen Marokko. Ich kam für Löhr gegen Bulgarien. Ich kam für Libuda gegen Peru und England. Doch ein Künstler kann kein Auswechselspieler sein. Nie.
In Frankfurt konnte ich Künstler sein. Immer. Als Charly Körbel zum 120. Geburtstag von Eintracht Frankfurt sagte, dass er in mir den größten Künstler sieht, den der Verein in seiner Geschichte hervorgebracht hat,[33] war mir das viel wert. Mehr als mancher Titel, und viel mehr als der Titel, den ich nie haben wollte: Bester Auswechselspieler der Welt.
Dass ich überhaupt so schnell in die Nationalmannschaft gekommen war, hatte ich meinem ersten Trainer bei der Eintracht zu verdanken: Elek Schwartz. Er war von Benfica Lissabon gekommen, hatte dort Eusebio trainiert. Schwartz liebte technisch guten Fußball. Bei seinem Amtsantritt im Sommer 1965 kündigte er an: »Jürgen Grabowski wird in einem Jahr in der Nationalmannschaft spielen.«[34]
Im Nachhinein werden es die meisten Leute kaum glauben, was für einen Schub mir das als jungem Spieler gegeben hat, dieses Vertrauen. Ich war gerade vom FV Biebrich 02 gekommen, aus der Hessenliga. Dort bin ich mit meiner Technik früh aufgefallen. Diese Technik und mein Gefühl für den Ball waren in mir, seit ich denken kann. Diese Gabe wurde mir in die Wiege gelegt. Ich habe das nie extra geübt, auch später nicht in der Bundesliga. Diese Pässe, Schüsse, Dribblings – alles war von Anfang an da.[35]
Mit zwanzig Jahren war ich sofort Stammspieler bei der Eintracht. Das war ungewöhnlich. Damals musste man sich für die Bundesliga meist über mehrere Jahre in unteren Ligen beweisen. Mein Start in Frankfurt war mir allerdings peinlich. Ich werde es nie vergessen: Das erste Probetraining habe ich verpasst. Ich bin in Wiesbaden mit dem Auto losgefahren und nie in Frankfurt angekommen.[36] Ich habe mich komplett verfahren.
Danach quälte mich nur eine Frage: Was denken die bloß von mir?[37] Jedenfalls mit mehr Achtung, als ich befürchtet habe. Im ersten Saisonspiel am 14. August 1965 hat mich Elek Schwartz für die Startelf nominiert. Wir haben 2:0 gegen den Hamburger SV gewonnen, damit war ich drin in der Mannschaft. Ich habe bei der Eintracht dann immer von Beginn an gespielt. Wenn ich mich recht erinnere, wurde ich nie ausgewechselt, außer wenn Verletzungen im Spiel waren, in 441 Bundesligaspielen für die Eintracht.
Ich habe damals 1000 Mark im Monat bekommen, zudem ein Handgeld von 12 000 Mark. Davon habe ich mir einen Triumph Spitfire gekauft. Feuerrot.[38] Das war kein Auto im gewöhnlichen Sinne. Kein Transportmittel, das einen von A nach B bringt. Der Spitfire war ein Kunstobjekt, vielleicht auch ein Lustobjekt. Er startete bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans, war schwer zu kontrollieren. Ihr habt vermutlich nie in so einem Wagen gesessen und wisst nicht, wie es ist, wenn ihr das Gaspedal durchdrückt und euch die Kraft tief in den Ledersitz drückt, wenn du das Tempo bestimmen kannst, nur du. Und wenn dich bei all dieser Kraft diese Schönheit umgibt, diese Eleganz. Auf die meisten Menschen habe ich sehr korrekt und kontrolliert gewirkt. Das war ich auch. Ich trug Krawattennadeln, führte später eine Versicherungsagentur und habe die meisten meiner Entscheidungen genau durchdacht und nicht aus dem Bauch entschieden. Doch für schöne, schnelle Autos hatte ich immer eine Schwäche, auch für das Unkontrollierte.
Elek Schwartz hat bei uns das 4-2-4-System eingeführt. Das war ein ausgesprochen offensives, temporeiches und attraktives System. Es war mir auf den Leib geschrieben. Wir spielten wunderbaren Fußball, schon nach neun Monaten durfte ich mein erstes Länderspiel bestreiten. Das war eine große Überraschung, aber dass mich Helmut Schön dann drei Monate später in das Aufgebot für die Weltmeisterschaft 1966 berief, war für mich selbst eine Sensation.[39]
Dass ich bei der Weltmeisterschaft in England keine Minute gespielt habe, war nicht schlimm, wirklich nicht. Wir waren damals acht oder neun Spieler im Kader, die nicht zum Zug kamen. Und wer spielte nicht alles in der Nationalmannschaft: Seeler, Tilkowski, Haller, Beckenbauer, Schnellinger. Diese Namen, da war man froh, überhaupt dabei zu sein.[40] Und die Weltmeisterschaft in England war ja auch die letzte, in der Aus- und Einwechslungen verboten waren. Da wusste man, dass man kaum eine Chance auf einen Einsatz bekommen konnte.
In der Bundesliga bin ich schnell aufgefallen, bald wollten mich auch die Bayern. Der FC Bayern war damals, im Jahr 1968, noch nicht die unbestrittene Nummer eins im Land, aber ein aufstrebender, ambitionierter Verein. Wichtig war mir noch etwas anderes: Die Zuschauer in München haben technisch gute Spieler geschätzt. Ich wusste, diese Leute sehen dich gerne.[41]
Ich hatte Interesse. Bei den Verhandlungen habe ich mich dann relativ weit aus dem Fenster gelehnt.[42] Ich sagte zu Robert Schwan, dem Manager von Bayern München, er solle sich mit unserem Präsidenten Rudi Gramlich einigen. Als der Anruf von Schwan kam, saß ich bei unserem Präsidenten. Und Gramlich sagte den Bayern ab! Ich bin froh darüber, wie es gekommen ist. Die Offerte von Bayern schmeichelte mir, aber ich habe doch zu gerne bei der Eintracht gespielt.[43]
Am 8. Dezember 1969 haben wir zu Hause 3:0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Ich ahnte nicht, dass dieses Spiel einschneidenden Einfluss auf mein Leben nehmen sollte. Bernd Nickel schoss das erste Tor, ich die beiden anderen. In der Nacht vor dem Spiel war das Thermometer auf minus acht Grad gefallen, ein bitterkalter Winter. Der Platz im Waldstadion ähnelte einer Eislaufbahn. Am nächsten Tag hat mich ein Fotograf für die Bild-Zeitung auf die Schlittschuhbahn neben dem Stadion gebeten, weil ich mich auf dem eisigen Platz so gut bewegt hatte. Ich sollte auf Kufen den Eisprinzen geben. Aber ich stand nicht sicher und suchte Halt. Auf der Eisfläche war eine junge Frau mit braunen Haaren und braunen Augen. Sie hat mich für das Foto an der Hand genommen. Sie trug einen schwarzen Pullover auf dem Eis, ich eine dicke Lammfelljacke. Die Zeitung schrieb am nächsten Tag zu dem Foto: »Grabowski will nicht zum Nordpol, sondern nach Mexiko!«
Ein halbes Jahr später fuhr ich nach Mexiko. Als ich von der Weltmeisterschaft zurückkam, habe ich auf dem Goetheplatz eine Autogrammstunde gegeben, zugunsten der Deutschen Sporthilfe. Da stand plötzlich diese junge Frau wieder vor mir – und reichte mir das gemeinsame Foto von der Eisbahn. Ich sollte es unterschreiben. Ich fragte sie, ob sie noch einen Moment Zeit hätte und mit mir ein Eis essen würde. Helga sagte Ja.[44]
Über fünfzig Jahre sind wir zusammen gewesen, mehr als ein halbes Jahrhundert. Auch in den letzten Stunden im Krankenhaus war Helga bei mir, die Frau meines Lebens.
Auch meinen Fußball hat sie sehr gemocht, Helga war immer im Stadion. Meine Mutter ist nur einmal ins Stadion gekommen, zu meinem Abschiedsspiel im Jahr 1980. Sie wollte es immer, aber ihr war es zu aufregend. »Zu Hause vor dem Radio oder am Fernsehschirm habe ich mir schon genug Sorgen um ihn gemacht, wenn er verletzt vom Platz humpelte«,[45] sagte sie. Ich habe während meiner ganzen Karriere bei meiner Mutter Ottilie gewohnt, erst ganz zum Schluss bin ich mit Helga in unser Haus in Taunusstein gezogen.[46]
Den schönsten und faszinierendsten Fußball haben wir bei der Eintracht unter Gyula Lóránt gespielt. Lóránt war Ungar, ein kantiger Mann. Er spielte für Honvéd Budapest von 1951 bis 1956 – die große Zeit des ungarischen Fußballs. Er spielte zusammen mit Ferenc Puskás, dem vielleicht größten Fußballgenie seiner Zeit, aber beim WM-Finale 1954 dem großen Fritz Walter unterlegen, dem Idol meiner Kindheit und Jugend, meinem Vorbild. Neben Alfred Pfaff von der Eintracht, er gehörte immer zu meinen Lieblingsspielern.[47]
Als Lóránt im Herbst 1976 zur Eintracht kam, waren wir in Abstiegsgefahr. Wir standen auf Platz 16. Ich erinnere mich an seine erste Kabinenansprache: »Wenn wir nicht auf jedes Tor und auf jeden Punkt aufpassen, dann werden wir am Ende nicht Meister.« Wir haben nur mit dem Kopf geschüttelt, aber Lóránt hat es ernst gemeint. Nach dem 12. Spieltag hatten wir 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach. Nach der Niederlage im ersten Spiel in Bremen waren es 16 Punkte. Er hat uns dann ein neues System eingeimpft, das die Raumdeckung vorwegnahm. Am Anfang haben wir uns nur verwundert angesehen, weil wir auf der Tafel nur Striche gesehen haben. Auf einmal war es eine wunderbare Zeit.[48] Danach haben wir 21 Spiele lang nicht verloren, 14 Spiele gewonnen, mitunter spielten wir wie im Rausch. Es ging immer nach vorne![49]
Am Ende haben uns tatsächlich nur zwei Punkte zur Deutschen Meisterschaft gefehlt. Im Nachhinein kann man sagen: Es waren die Punkte, die wir im ersten Spiel unter Lóránt gegen Bremen verloren haben, genau wovor Lóránt uns gewarnt hatte. Mit zwei Punkten Rückstand auf Gladbach sind wir nur Vierter geworden, hatten aber das beste Torverhältnis aller Mannschaften. Keine hat so viele Tore geschossen wie wir: 86.
Lóránt war im Grunde der Trainer, der in der Bundesliga die Raumdeckung eingeführt hat, noch vor Ernst Happel beim Hamburger SV. »Ohne einen Jürgen Grabowski wären die Perfektion meines Raumdeckungssystems und die beispiellose Erfolgsserie nicht möglich gewesen. Als Trainer brauchte ich einen Umsetzer meiner Gedanken auf dem Spielfeld. Ich nenne ihn den offensiv/defensiven Mittelstürmer, eine Position, die es bisher noch gar nicht gab. Das ist ein Mann im Mittelfeld ohne direkten Gegenspieler, der klug ist, gut abgeschirmt eigene Ideen entwickelt, die Bälle hält und verteilt, quasi ein zweiter Libero im Mittelfeld. Eine Position, die es bisher noch nicht gab. Grabi war bei der Eintracht dieser ideale Mann«, sagte Gyula Lóránt später über meine Rolle in seinem System.[50]
Er war wirklich ein ganz besonderer Trainer. Er hatte die Mannschaft total im Griff, war eine Respektsperson. Wir hatten viel Spaß bei ihm, aber wir wussten genau, wie weit wir gehen konnten, weil er die absolute Autorität war.[51]
Ich habe Menschen bewundert, die selbstsicher waren, die mit einer starken inneren Überzeugung aufgetreten sind. Lóránt war einer von diesen Menschen. Viele in Frankfurt hatten zuvor geglaubt, dass wir nicht zusammenpassen. Der robuste, hemdsärmlige, laute Lóránt und dieser sensible, empfindliche und leise Grabowski. Die Zeitungen waren voll von solchen Artikeln.
Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was in Künstlern vorgeht, wie man mit ihnen umgeht. Lóránt wusste es. Er hat mich verstanden, er hat mein Spiel verstanden. Das Erste, was er sinngemäß zu mir sagte: »Jürgen, Sie sind mein Mann. Um Sie baue ich mein System der Raumdeckung.« Lóránt war seiner Zeit voraus.[52]
Als ein Spieler, der mit Puskás gespielt hat, wusste er auch um das Drama der damals besten Mannschaft der Welt. Die Ungarn von 1954, die nicht Weltmeister wurden. Lóránt wusste, dass Fußball Kunst sein kann. Aber auch, dass Künstler scheitern können. In einem Interview hat er gesagt, ich sei so gut wie Johan Cruyff.[53] Das war ein Kompliment, das ich zu schätzen wusste. Tatsächlich war es Cruyff, der mit seiner Spielweise meine Wandlung vom Flügelstürmer in der Nationalmannschaft zum Spielmacher bei der Eintracht entscheidend beeinflusste. Ich scheue mich nicht zuzugeben, dass ich mir nach dem Münchner Endspiel diesen Johan Cruyff zum Vorbild genommen und mir gesagt habe: »Jürgen, so wie Cruyff musst du in den letzten Jahren deiner Laufbahn auch bei der Eintracht spielen.«[54]
Lóránt hat Außergewöhnliches bei uns eingeführt, auch neben dem Platz. Im Kabinentrakt hat er unmittelbar vor dem Spiel eine Kaffeetafel aufbauen lassen. So, dass unsere Gegner das sehen konnten. Sie konnten aber nicht glauben, was sie sahen. Kurz vor jedem Spiel tranken wir komplett umgezogen einen Espresso.[55] Kekse gab es auch. Dann sind wir raus und haben gewonnen.[56]
Lóránt hat nicht nur den Fußball verstanden. Er hat auch das Leben verstanden. Deswegen war ich wütend, dass er mitten in der nächsten Saison zu Bayern München ging.[57] Ich wäre für ihn durchs Feuer gegangen.
Als die Eintracht und Bayern sich entschlossen, die Trainer zu tauschen, standen wir am 16. Spieltag auf Platz acht. Wir hatten aber bloß vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Die Bayern waren mit Dettmar Cramer auf einem Abstiegsplatz. Wir hatten sie gerade 4:0 im Waldstadion geschlagen. Holz hat das erste Tor gemacht, Rüdiger Wenzel das zweite, »Scheppe« Kraus das dritte und ich das vierte. Vier Tage zuvor hatten wir die Bayern auch schon im UEFA-Pokal mit 4:0 an die Wand gespielt. Nach den zwei Triumphen kam es dann Anfang Dezember 1977 zu dem in der Bundesliga bis heute einmaligen Tausch: Gyula Lóránt wechselte zu den Bayern, Dettmar Cramer kam zu uns.
Cramer galt als Inbegriff des gebildeten Trainers. Er konnte über Fußball und die Welt referieren, besuchte die Oper und trug feines Tuch. Ein kultivierter Mann, der »Fußball-Professor« genannt wurde. Das hat unserem Präsidenten Achaz von Thümen gefallen, einem Universitätskanzler. Mit Lóránt hatte er nicht viel anfangen können, und Lóránt wiederum kam mit den Offiziellen der Eintracht nicht so klar.[58] Als Kapitän habe ich für Lóránt gekämpft: »Wir wollen Lóránt behalten!«[59] Leider ein vergeblicher Kampf. Er hätte uns mit Sicherheit noch einige Jahre gut zu Gesicht gestanden, und wir hätten mit Sicherheit noch große Erfolge gehabt, das glaube ich zumindest.[60]
Im Verein gingen die Meinungen über Lóránt weit auseinander. »Wir tauschen keinen Sieger gegen einen Verlierer«,[61] hat unser Schatzmeister Gerhard Jakobi gesagt. Doch unser Ersatztorwart Günther Wienhold, der von Lóránt kaum aufgestellt wurde, freute sich: »Meinen nächsten Sohn nenne ich Dettmar.«[62]
Wir hatten wirklich eine spielstarke Mannschaft. Auch auswärts haben uns die Leute gerne gesehen. Ich hatte 15 Jahre einen Sonderbewacher, der einen ausschalten sollte.[63] Nicht zuletzt gegen die Bayern haben wir oft sehr gut gespielt. In Frankfurt haben wir regelmäßig gewonnen, fast immer. Ich habe gegen die Bayern 15-mal gewonnen. Ich glaube, so häufig hat kein anderer sie geschlagen. Aber über 34 Spieltage waren uns der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach voraus. Man muss es so brutal sagen: Die Leistungsdichte war nicht gut genug. Und damals war es ja nicht so, dass zur neuen Saison fünf, sechs neue Spieler kamen. Da kam vielleicht einer hinzu. Es hat letztendlich nicht gereicht.[64]
Die Eintracht galt in Deutschland als launische Diva. Mir hat es nie gefallen, wenn ich zum Synonym für die launische Diva erklärt worden bin. Wenn die Eintracht eine Diva war, dann war sie eine empfindsame Diva, keine launische. Als launisch gelten Menschen, die sich unberechenbar und wechselhaft verhalten aufgrund ihrer Stimmungslagen. Die anspruchsvoll sind und schwer zufriedenzustellen, die schnell beleidigt reagieren. Eine Diva, so wie ich sie verstehe, ist etwas anderes: ein empfindsames Geschöpf. Das muss sie auch sein, sonst erreicht sie nicht diese Höhen, die Normalsterbliche nie erreichen. Nicht in der Oper, nicht auf der Bühne, nicht im Stadion.
Allerdings hat es der Eintracht vermutlich an einer gewissen Robustheit gefehlt. Die braucht es, um am Ende einer Saison tatsächlich die Meisterschaft zu gewinnen. Einige geniale Spiele reichen nicht. Wenn wir die Bayern vor allem zu Hause besiegt haben, hatte ich das Gefühl, meine Pflicht als Künstler erfüllt zu haben. Dass wir dann eine Woche später bei einem Nobody verloren haben, war vielleicht der Preis, den eine Mannschaft wie wir dafür bezahlen musste. Wenn wir mit der Eintracht Fünfter waren und sind zu Rot-Weiss Essen, die auf dem fünfzehnten Platz waren, haben wir keine Schnitte gekriegt. Die Essener haben uns niedergemacht und Powerplay aufgezogen.[65]
Auch Bernd Hölzenbein war wie ich nicht der Typ, der an jedem Tag seine Leistung abrufen konnte, wie man es heute sagt und heute verlangt. Er hatte auch eine Künstlerseele. Er sagte von sich selbst, dass er an einem Tag Weltklasse sein konnte – und am nächsten Kreisklasse.
Bei der Eintracht hatten wir immer schon tolle Fans,[66] sie sind unserer Mannschaft in ihrer Einstellung zum Fußball nicht unähnlich gewesen. Wir hatten in der Saison 1965/66 mal 65 000 Zuschauer gegen Bayern München, mehr als das Stadion eigentlich fasste. Doch wenn wir ein Auswärtsspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen 0:1 verloren, kamen zum nächsten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf eben nur 13 000 oder 14 000 Zuschauer. Das war dann die Abstrafung.[67]
Wir waren ein Team für die besonderen Momente, für Pokalspiele, für den Europapokal. Mit Dietrich Weise haben wir 1974 und 1975 den DFB-Pokal gewonnen, 1980 den UEFA-Pokal mit Friedel Rausch. Große Spiele gegen große Mannschaften zu gewinnen – das hat immer zu uns gepasst. Doch eine Meistermannschaft, die kontinuierlich Siege produziert, das waren wir nicht. Da hatten uns andere Vereine etwas voraus.
Bei den Bayern besaß auch der Franz ein robustes Wesen und starken Durchsetzungswillen, wie auch einige andere Stars der Bayern dieser Zeit. Günter Netzer war zwar ein empfindsamer Regisseur, doch in Mönchengladbach hatte er mit Berti Vogts eine echte Kämpfernatur an seiner Seite. Und mit Rainer Bonhof einen vorbildlichen, laufstarken Profi. Die haben mit ihrer Mischung nicht nur faszinierenden Fußball gespielt, sondern auch Titel gewonnen. Wir haben bei der Zusammensetzung der Mannschaft auf solche Dinge vielleicht nicht so geachtet.
Im Jahr 1975 haben wir die Bayern deklassiert, auf besondere Weise. Wir siegten 6:0, schon zur Halbzeit stand es 5:0. Und nach einer Stunde hat Bernd Nickel dann einen Eckball direkt zum sechsten Tor verwandelt. Auch er besaß besondere Gaben, wieder ein Spieler, der nicht in das normale Schema passte. Die Fans nannten ihn Dr. Hammer, weil er so einen harten Schuss hatte. Im Grunde war er aber ein Ball-Künstler, ein begnadeter Techniker, dem seine perfekte Schusstechnik gestattete, direkte Eckentore von allen vier Seiten zu erzielen. Selbst gegen einen Sepp Maier hat er beim 6:0 so getroffen.
Es hört sich jetzt vielleicht überheblich an, aber wir hätten wirklich zweistellig gewinnen können. Danach hatten wir im Minutentakt bis zum Ende Torchancen. Es war wirklich unfassbar! Da ist mir jetzt erst so richtig klar geworden, dass es bei uns nur nach vorn ging. Wir wollten nicht nach dem 6:0 mal ein bisschen den Ball hin und her spielen, nein, wir waren heiß darauf, das 7:0 oder 8:0 zu machen.[68]
In diesem Spiel habe auch ich ein traumhaftes Tor erzielt. Ich schoss den Ball fast von der linken Grundlinie in den rechten Torwinkel; Außenrist mit dem linken Fuß, obwohl der mein schwächerer Fuß war. In diesem Moment kam alles zusammen, was zusammenkommen muss: der Bewegungsablauf, die Technik und der Mut, den man für einen Schuss aus dieser eigentlich unmöglichen Position braucht. Ich habe diesen Moment später als ein Highlight[69] meiner Karriere bezeichnet.
Dieser Moment war vollendet. Deswegen habe ich mir dieses Tor später noch einige Male auf YouTube angeschaut. Ein gesamtes Spiel, selbst wenn man es gewinnt und es einen zum Weltmeister macht, ist etwas anderes als der perfekte Moment. Doch dieses Tor gegen Bayern gefällt mir, wenn ich es jetzt betrachte, immer noch.[70] Es geht immer um den Moment.
Als ich von Gyula Lóránt sprach, hatte ich anklingen lassen, dass ich eine gewisse Faszination gegenüber Menschen nicht leugnen kann, die selbstsicher und kraftvoll auftreten, denen Selbstzweifel nicht anzumerken sind. In meinem Freundeskreis gab es einige solche Männer. Nicht nur Wolfgang Overath gehörte dazu. Zu meinem Freundeskreis zählte auch Rüdiger Schmidtke, ein leidenschaftlicher Boxer, der Europameister wurde, aber eigentlich nie Boxer war.
Schmidtke machte Bodybuilding, weil er einen muskulösen Körper wollte, der seinen ästhetischen Ansprüchen genügte. Er war blond, gut aussehend und verdiente zuvor als Dressman sein Geld. Doch im Sportstudio erkannte ein Trainer sein besonderes Bewegungstalent, seine boxerische Begabung. Mit 23 Jahren bestritt Schmidtke dann seinen ersten Profikampf. Er hatte vorher kein einziges Mal als Amateur geboxt, stand nie im Ring. Er war wirklich kein Box-Genie, doch er besaß einen Durchsetzungswillen, den ich bewundert habe. Sechs Jahre später schaffte er das schier Unmögliche. Als namenloser Herausforderer besiegte er 1972 kraft seines Willens einen früheren Olympiasieger aus England im Wembley Empire Pool und wurde Box-Europameister. Wie es der Zufall will, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wembley-Stadion, wo ich in demselben Jahr in der legendären Wembley-Elf stand. Wir waren die erste deutsche Mannschaft, die England auf heimischem Boden besiegte. Und wir taten es auf unvergessene Weise. Unser 3:1-Sieg galt lange als das schönste deutsche Länderspiel aller Zeiten,[71] für manche ist er das noch heute.
Ich hatte noch andere Freunde, die nicht in ein gewöhnliches Raster passten. Einer von ihnen hat mal einen Bündel Geldscheine zur Aufbewahrung an der Schwimmbadkasse abgegeben, nachdem er zuvor Pelze geklaut und verkauft hatte. Das Geld, das er dafür bekommen hat, gab er dort ab, damit es ihm nicht selbst im Schwimmbad gestohlen wird. Solche Lebensweisen haben mich fasziniert. Menschen, die nach ihren eigenen Vorstellungen leben. Die sich nicht darum kümmern, was andere sagen und denken. Die sich keine Grenzen setzen. Die machen, was ihnen gefällt. Egal, wohin ihr Weg sie führt. Rüdiger Schmidtke ist nach langer Krankheit im Jahr 2022 gestorben. Seinen Tod hat kaum jemand registriert.
Meine Karriere hat ein Tritt von Lothar Matthäus beendet, das war am 15. März 1980. Es war ein unnötiges Foul. Im Fuß war alles kaputt, was kaputt sein konnte.[72] Ich wurde später oft gefragt, was ich darüber denke. Dazu wollte ich nie viel sagen, nur das Nötigste. Lothar Matthäus war damals 18, ich 35. Ich habe nie gesagt, dass er mich absichtlich verletzt hat. Es war ein dummes Foul, fast an der Außenlinie. Ein junger Spieler hätte die Größe haben müssen, sich zu entschuldigen. Ich musste dadurch meine Karriere beenden. Es kam nie ein Satz von ihm wie »Es tut mir leid«.[73]
Ich habe mich allerdings geärgert, als Matthäus behauptet hat, ich wäre nur auf eine Invaliditätszahlung der Versicherung aus gewesen. Dieser Satz mag die Dummheit eines jungen Mannes gewesen sein, aber im Grunde war es eine Frechheit![74] Ich habe natürlich nie einen Antrag gestellt. Ein Künstler stellt keinen Antrag auf Invalidität.
Wenn ich gefragt wurde, was der bitterste Moment war, musste ich bei der Antwort nicht lange zögern. Es war der letzte Moment meiner Karriere. Die Eintracht wurde 1980 UEFA-Cup-Sieger – ohne mich. Es war eine schöne Geste von meinen Mitspielern, dass sie mich nach dem Triumph über Gladbach auf die Schultern hoben und mir den Pokal reichten.[75]Das war sehr bewegend.[76]Doch es war nur ein schwacher Trost. Ein Endspiel im Europapokal – und ich nicht dabei. Wir hatten alles probiert. Aber es ging nicht. Aus und vorbei. Ich musste aufhören.[77]
Ich war todtraurig.[78]
Bernd Hölzenbein hat mir im Stadion den Pokal überreicht. Das war eine schöne, respektvolle Geste. »Für mich war der Grabi bei der Eintracht immer die Nummer eins«, hat er später gesagt.[79]