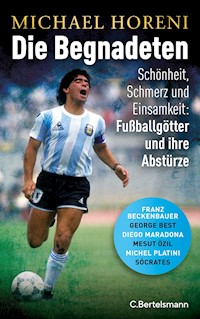9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Vom Schlaffi zum Straffi Sport ist Mord und andere Ausreden Wenn der eigene Körper zum Feind wird Er kam, sah und – keuchte! Michael Horeni kann es nicht fassen: Er ist am Ende! Nicht mit seinem Latein, aber mit seiner Kondition. Noch vor wenigen Jahren joggte er mühelos durch den Park, stürmte jedes Wochenende über den Fußballplatz, verließ den Tennis Court stets als Sieger – und war ein durchtrainierter Frauenschwarm! Mit Anfang 40 muss der FAZ-Sportredakteur aber der Wahrheit – und leider auch der Unförmigkeit seines Körpers – ins Auge blicken: Treppensteigen ist seine einzige sportliche Betätigung, er pfeift aus dem letzten Loch und zählt statt der Muskeln seines Waschbrettbauches die Schwimmringe seiner Wohlstandswampe. Damit ist jetzt Schluss! Klasse statt Masse – so lautet die neue Devise! Und gelingen soll ihm das mit Hilfe der renommierten Fitness-Trainer der Fußball-Nationalmannschaft, mit denen er 12 Monate trainiert, um am Ende mindestens so fit wie Schweini und Co. zu werden. Sein unterhaltsames Trainingstagebuch berichtet von den Höhen und Tiefen dieser außergewöhnlichen Challenge und treibt mit dem leicht umsetzbaren Fitness-Einsteiger-Programm selbst dem letzten Couch-Potato den inneren Schweinehund aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Michael Horeni
Vom Hemd zum Helden
Ein Fitnessjahr mit den Profis
Sachbuch
Fischer e-books
Abbildungen von Wonge Bergmann
1. KapitelDer ZusammenbruchJUNI2007
Spätestens wenn der eigene Körper zum Feind wird, sollte man sich ein paar grundsätzliche Gedanken über sein Leben machen. In meinem Falle ist das jetzt genau ein Jahr her. Als ich an jenem Morgen in meinem Hamburger Hotel aufwachte, um mich mit meiner alten Freundin Katja zu treffen, wusste ich davon aber noch nichts. Ich war bester Laune, sie nach etlichen Monaten wieder zu sehen.
Katja ist vor ein paar Jahren nach Hamburg gezogen; deshalb sehen wir uns nur noch selten. Außer ich habe mal wieder beruflich in Hamburg zu tun. So wie in diesem Juni.
Es war kurz nach sieben: Ich ging ins Bad, um mich fertig zu machen. Das Handy klingelte, als ich gerade unter der Dusche stand. Ich schnappte mir fluchend das Handtuch und stolperte klatschnass zum Telefon. Katja war dran.
»Morgen, mein Lieber. Schon wach?«, flötete sie in bester Laune. »Es klappt bei mir heute leider nicht. Ich habe um zehn noch einen Marketingtermin reinbekommen. Du musst deinen Kaffee wohl ohne mich trinken.«
»Keine Chance? Ich muss heute wirklich alleine im Hotel frühstücken?«, fragte ich enttäuscht.
»Diesmal sieht’s echt schlecht aus. Aber wenn du jetzt gleich rüberkommst, können wir noch zusammen laufen gehen und dabei quatschen.«
Ich erstarrte.
Laufen?
Ich?
»Hast du keine bessere Idee?«, erwiderte ich zögerlich. Ich musste Zeit gewinnen. Katja hielt mich also immer noch für fit. Das schmeichelte mir zwar, aber tatsächlich hatte ich Sport für mich schon lange abgehakt. Darüber jedoch hatten wir offensichtlich nie geredet.
»Stell dich nicht so an. Wir laufen eine Stunde um die Alster. Das Wetter ist doch super«, sagte sie.
Eine Stunde?
Niemals!
Allein der Gedanke, meinen schwerfälligen Körper durch Hamburg zu schleppen, trieb mir den Angstschweiß auf die Stirn. Aber ich wollte nicht als Weichei dastehen: Ich musste versuchen, irgendwie unbeschadet aus der Sache rauszukommen.
»45 Minuten laufe ich mit, aber nicht länger. Ich laufe zu Hause immer nur eine halbe Stunde. Ich hab’ dafür einfach keine Zeit, die Kinder, der Job, du weißt«, log ich. In Wahrheit konnte ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal überhaupt gelaufen war. Es musste Jahre her sein.
Katja dagegen war seit jeher verdammt sportlich. Früher war sie sogar Leistungssportlerin gewesen: Sie hatte es bis in den Nationalkader gebracht. Jetzt geht sie immer noch jeden Morgen joggen; Sport hat sie nie nach einem besonderen Plan in ihr Leben integrieren müssen, wie das die Fitness-Gurus mir und den Millionen anderen Sportmuffeln immer wieder predigten. Sport gehört für Katja schon immer zu ihrem ganz normalen Tagesablauf: Aufstehen. Anziehen. Eine Stunde laufen. Duschen. Zähne putzen. Fertig. So einfach war das für Katja.
Aber nicht für mich.
»Verstehe, kein Problem. Schaffst du es in einer Viertelstunde, bei mir zu sein?«, fragte sie mich voller Tatendrang.
»Oh Mann, ich habe meine Laufschuhe zu Hause vergessen«, log ich weiter.
Es war gleich eine doppelte Lüge. Ich hatte die Joggingschuhe natürlich nicht vergessen – ich besaß gar keine mehr. Das letzte Paar war schon seit mindestens zwei, drei Jahren durchgelaufen. Ich war danach überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mir ein neues zu kaufen. Ein Vegetarier geht ja auch nicht zum Metzger.
»Macht nichts. Ich hab welche für dich; die müssten passen. Klamotten sind auch kein Problem. Also, los«, entgegnete Katja munter.
Ich zuckte zusammen. Das kann doch nicht wahr sein, dachte ich. Aber aus der Nummer kam ich einfach nicht mehr raus.
»Super, bin gleich da.« Ich wusste, dass es nicht sehr überzeugend klang. Egal. Ich atmete tief durch, richtete mich auf und zog mich an.
Der frisch gebrühte Kaffee stand schon dampfend auf dem Küchentisch, als ich Katjas Wohnung betrat. Mehr hätte ja gar nicht sein müssen. Ein Kaffee, ein gutes Gespräch – perfekt. Aber die Sportsachen und Schuhe lagen wie eine Drohung direkt neben dem Tisch auf dem Fußboden.
»Zum Wachwerden«, sagte sie grinsend und deutete auf den Kaffee.
Ich stärkte mich mit einem großen, heißen Schluck, ehe ich mich ins Nebenzimmer verzog, um mich umzuziehen. Katja arbeitete währenddessen schon mal auf ihrem Blackberry die ersten Mails ab.
Um kurz vor acht wohlgemerkt. Katja nutzt jede Minute effektiv. Echt bewundernswert!
Keine Frage, Katja ist das, was man eine Powerfrau nennt. Sie hatte es schon mit Anfang Dreißig in den Vorstand eines bekannten Sportunternehmens gebracht. Ihr Terminkalender ist seitdem immer randvoll, und dieser Blackberry ist schon so etwas wie ihr sechstes Sinnesorgan. Überlebenswichtig. Ohne ihn geht sie gar nicht mehr aus dem Haus. Selbst beim Joggen hat sie das Ding dabei, jeden Morgen.
Ich aber bin kein Powertyp.
Ich habe auch keinen Blackberry.
Nicht einmal Joggingschuhe.
Ich probierte die geliehenen Schuhe an. Der linke passte wie angegossen, aber der rechte drückte vorne ein wenig an den Zehen. Das war meine Chance! Schuhe zu klein – was sollte Katja dagegen noch sagen? Ich könnte dem Joggen noch einmal entkommen!
Aber auf einmal flackerte irgendwo in mir ein letzter Funke längst erloschenen Ehrgeizes auf. Völlig unerwartet. Das packst du doch, du alter, fauler Sack. Wird schon irgendwie gehen, ging doch früher immer, munterte ich mich in Gedanken auf.
»Die Schuhe passen super«, rief ich Katja zu. »Worauf warten wir noch?«
Sie hatte für mich die Touristenstrecke ausgesucht, von Eppendorf einmal rund um die Binnenalster.
»Normalerweise laufe ich schon um halb sieben. Da ist es noch schön leer«, sagte Katja. Das wäre mir auch lieber gewesen – ganz ohne Zeugen.
Los ging’s. Es hätte wirklich herrlich sein können. Die Sonne schien, und ich tat nach den ersten Minuten weiter so, als passten mir die Schuhe.
Und plötzlich fühlte ich mich mutig.
Ich fühlte mich gut.
Ich hatte es also doch wieder geschafft, meinen inneren Schweinehund zu besiegen. Auch den Rest der Strecke würde ich schon irgendwie schaffen.
Bis wir an die Alster kamen, dauerte es zehn Minuten, und langsam fühlte ich mich schon nicht mehr ganz so riesig.
Und auch nicht mehr supermutig.
Eher wie ein Idiot.
Warum hatte ich mich darauf eingelassen, war ich völlig irre? Es war der Zeitpunkt, an dem ich zum ersten Mal ans Umdrehen dachte. Zwanzig Minuten joggen hätten mir völlig gereicht. Aus trainingswissenschaftlicher und medizinischer Sicht hatte ich sowieso alle Argumente auf meiner Seite. Die Vernunft und mein rechter Fuß brüllten mir zu: Aufhören! Mein Ehrgeiz aber ignorierte die Hilferufe und entgegnete mit völlig unpassender Arroganz und Überheblichkeit: Halt die Klappe und lauf weiter.
Der Blick auf die Binnenalster versetzte mir einen Schock. Vor mir tat sich ein gigantisches Gewässer auf. Mit entsetztem Blick hielt ich nach einer Brücke Ausschau, die meinen Leidensweg hätte verkürzen können. Aber da war nichts. Nur eine einzige Brücke, in unendlicher Ferne.
Da komme ich vielleicht noch in menschenwürdiger Verfassung an, dachte ich bei mir. Aber das wäre dann noch nicht einmal die Hälfte des Weges gewesen. Und was dann? Einfach sagen: »Mir reicht’s« und ein Taxi rufen? Oder eine Verletzung vortäuschen? Ich hatte nicht einmal mein Handy dabei, um aus irgendeinem Anruf einen geschäftlichen Notfall zu machen, der das unverzügliche Ende des Laufs begründet hätte. Ich war ratlos und konzentrierte mich verzweifelt auf meine Atmung. Der Ehrgeiz trieb mich weiter.
Ich wollte nicht aufgeben.
Während ich mit mir kämpfte, hatte Katja längst zu erzählen begonnen. Sie redete mit mir, als säßen wir gemütlich im Café. Mit jedem weiteren Schritt verabschiedete ich mich jedoch als ernstzunehmender Gesprächspartner.
Als sie von der letzten Krise ihres Unternehmens sprach, von den Intrigen und der Rolle der Medien, hätte ich nur zu gerne eloquent eingehakt, investigativ nachgefragt oder ein paar lässig-ironische Bemerkungen fallengelassen. Aber ich bekam keinen einzigen vernünftigen Satz mehr raus. Ich hörte mich »Ja, wirklich?« keuchen. Kurz vor der Apathie raunte ich noch ein »So?« und als Höhepunkt meiner verbliebenen intellektuellen Leistungsfähigkeit presste ich immer wieder den Zwei-Worte-Satz raus: »Und dann?« Ich selbst hielt mein Gestammel für eine absolut übermenschliche Anstrengung. In diesem Stadium war ich schon vollkommen damit ausgelastet, meine Atmung nicht aussetzen zu lassen, das Kreislaufsystem halbwegs stabil zu halten, die brennenden Oberschenkel und den schmerzenden rechten Fuß in dem verflucht engen Schuh zu ignorieren. Doch mein Ehrgeiz ließ nach zwanzig Minuten merklich nach. Die Vernunft übernahm wieder die Führung. Das war mir sehr recht. Ich musste der Sache ein Ende bereiten – so schnell wie möglich.
Am Seeufer entdeckte ich schließlich ein Café. Es war nur noch ein paar hundert Meter entfernt. Ich richtete meinen gekrümmten Körper noch einmal auf, ignorierte die Schmerzen, atmetet zweimal tief durch und sagte dann zu Katja so klar und deutlich wie es mir möglich war: »Läuft besser als ich dachte. Ich muss da vorne nur mal kurz auf die Toilette.«
»Dann haben wir auch schon ungefähr die Hälfte. Wir können aber auch noch ein bisschen länger laufen, wenn du möchtest«, schlug Katja vor. »Wir laufen ja sehr gemütlich.«
Ich sah sie entgeistert an. Sie meinte das wirklich ernst. Auf ihrer Stirn war noch kein einziger Schweißtropfen zu sehen. Sie hatte die knappe halbe Stunde Joggen scheinbar überhaupt nicht angestrengt. Nicht ein Hauch von Ermüdung ging von ihr aus. Das machte mich erst richtig fertig. Ich flüchtete auf die Toilette des Cafés.
Dort sah ich im Spiegel ein puterrotes, von Strapazen gezeichnetes Gesicht. Als ich die dazugehörige, bemitleidenswerte Gestalt betrachtete, begann ich mir Fragen zu stellen.
Über den Zustand meines Körpers.
Über mein bisheriges Leben.
Über meine Zukunft.
Was hast du nur aus deinem Körper gemacht?
Warum hast du ihn so verwahrlosen lassen?
Warum hast du den Sport so schleifen lassen?
Willst du weiter jeden Abend nur noch vorm Fernseher hocken, Rotwein trinken und Schokolade in dich reinstopfen? Oder kriegst du deinen Hintern nochmal richtig hoch?, wollte ich von mir wissen.
Das bemitleidenswerte Geschöpf im Spiegel sah mich nur ratlos an.
Aber jetzt musste ich erst einmal herausfinden, wie ich am schnellsten und mit dem letzten Rest von Selbstachtung wieder in Katjas Wohnung gelangen konnte. Ich drehte den Wasserhahn auf und ließ eiskaltes Wasser über meine Handgelenke fließen. Herrlich. Ich wollte nie mehr raus aus diesem winzigen Klo. Kühlung war alles, was ich brauchte. Allmählich verschwand auch die entsetzliche rote Farbe aus meinem Gesicht. Nach weiteren fünf Minuten wusch ich mich komplett, brachte meine Haare in Ordnung und wurde wieder zu einem Menschen, der vollständige Sätze bilden konnte.
In meinen Kopf tauchten auch wieder ein paar klare Gedanken auf. Als Erstes verpasste ich meinem Ehrgeiz einen Tritt und entschloss mich, Katja die Wahrheit zu sagen. Doch bevor ich mir die passenden Worte zurechtlegen konnte, empfing sie mich aufgeregt. War ja auch kein Wunder, nachdem ich fast eine Viertelstunde in einem Drei-Quadratmeter-Klo zugebracht hatte.
»Geht’s dir gut?« – »Ist alles in Ordnung?« – »Was ist denn los?« – »Kann ich dir helfen?« Sie war ernsthaft besorgt.
»Du musst mir nicht helfen«, entgegnete ich tapfer. »Ich kann einfach nicht mehr. Es ist wirklich genug für mich.«
»Warum? Wir sind doch gerade eine halbe Stunde gelaufen«, fragte sie unschuldig.
»Das ist eine lange Geschichte«, entgegnete ich mit fester Stimme. »Aber du kannst ruhig weiterlaufen. Ich finde auch alleine zurück, kein Problem.«
Einerseits war ich in diesem Moment sehr stolz auf mich, andererseits fühlte ich mich erbärmlich.
Mit bleischweren Beinen und dem Haustürschlüssel in der Hand sah ich Katja hinterher, wie sie mit federleichten Schritten ihren Weg um die Alster fortsetzte. Ich musste sie tatsächlich ziehen lassen. Meinem Ego versetzte diese Niederlage einen letzten, schmerzhaften Stich. Kurz darauf verschwand diese sportliche, attraktive und erfolgreiche Frau hinter der nächsten Uferbiegung. Ich blieb keuchend zurück.
Auch ich wäre gerne so sportlich, attraktiv und erfolgreich gewesen. War ich aber nicht. Da musste ich mir nichts vormachen. Ich spürte, wie mir diese Tatsache mehr und mehr zusetzte. Viel mehr als mir lieb war. Ich musste mir zum ersten Mal in meinem Leben eingestehen, dass mich meine jahrelange sportliche Untätigkeit zu einem Menschen gemacht hatte, der ich nie sein wollte.
Willkommen im Club der schlaffen Säcke.
Als Kind hatte ich oft darüber nachgedacht, wie mein Leben mit fünfunddreißig Jahren aussehen würde. Ich tat das meistens, wenn ich alleine in meinem Zimmer gegen die Schrankwand bolzte. Das konnte ich stundelang tun, ohne dass mir langweilig wurde. Dabei versuchte ich mir mein zukünftiges Leben vorzustellen. Warum ausgerechnet fünfunddreißig Jahre? Weil ich mir ausgerechnet hatte, im Jahr 2000 in diesem Alter zu sein. Ich hatte keine Vorstellung davon, dass es einen Unterschied machte, ob man nun fünfunddreißig, fünfundvierzig oder fünfundfünfzig Jahre alt ist. Denn erwachsen war man dann doch – so oder so. Man gehörte endgültig zur anderen Seite. Was sollte sich dann also noch groß verändern? Das gesamte Erwachsenenleben lag für mich noch in einem fernen Universum, und die Frage, die ich mir stellte, war immer die gleiche: Wie werde ich bloß sein, wenn ich mal erwachsen bin?
Ich wusste es natürlich nicht. Auch wenn ich insgeheim hoffte, dass Petra, die mit mir in die sechste Klasse ging, meine Frau werden würde. Sie war blond und das hübscheste Mädchen in unserer Stufe.
Über vieles in meinem künftigen Leben machte ich mir damals also Gedanken, aber niemals machte ich mir Gedanken über meinen Körper. Und auch nicht über meine Fitness. Ein Wort, das damals für mich noch gar nicht existierte. Es war ein Wort, das damals für niemanden existierte. Fitness gab es nicht und Wellness erst recht nicht. Trimm dich fit – das gab es. Sport für Unsportliche war das für mich, lächerlich. Denn wenn ich damals eines über meine Zukunft zu wissen glaubte, dann war es die Gewissheit, auch als Erwachsener fit zu sein.
Richtig fit.
Mein Zustand an jenem Junitag an der Alster hätte mein kindliches Vorstellungsvermögen gesprengt. Als ich mich allmählich auf den Rückweg in Katjas Wohnung begab, tauchten in meinem Kopf immer weitere Erinnerungsfetzen aus meiner Kindheit auf. Mir fiel ein, was ich damals über Leute gedacht hatte, die über ihren körperlich schlechten Zustand klagten. Ich habe diese Erwachsenen für vollkommen ahnungslos gehalten. Wie konnte man immer nur von Sport reden und es nicht einfach tun? Verrückt. Ich dachte, das sei so einfach zu verstehen, dass man es gar nicht erklären müsste. Aber die Erwachsenen kapierten nichts. Jetzt aber war ich selbst ein solch seltsamer Erwachsener geworden. Vollkommen kopfgesteuert und komplett unfähig, Spaß am Sport zu haben.
Meine Gedanken auf dem Rückweg wurden immer trübsinniger. Ich fühlte mich auf dieser Laufstrecke völlig fehl am Platz.
Der Weg, den ich nun eingeschlagen hatte, führte vom Ufer weg. Ich war mir über die Richtung zwar nicht mehr hundertprozentig sicher gewesen, aber immer noch überzeugt, mich wenigstens auf meinen vortrefflichen männlichen Orientierungssinn verlassen zu können. Ich brauche bei Autofahrten zum Beispiel keine Straßenkarten. Als mir meine Kumpels zum letzten Geburtstag ein Navigationsgerät geschenkt haben, war ich richtig beleidigt.
Spätestens in zehn Minuten glaubte ich Katjas Wohnung erreicht zu haben. Der unbefestigte Weg mündete jedoch in eine mir unbekannte Straße, die sich scheinbar noch weiter von der Binnenalster entfernte. Hier war niemand mehr zu sehen, den ich nach dem Weg hätte fragen können. Das beunruhigte mich aber nicht weiter. Ich gehöre nämlich zu der Sorte Männer, die niemals nach dem Weg fragen.
Nach ein paar Minuten sah ich ein besonders schönes Gebäude, von dem ich überzeugt war, es auf dem Hinweg schon mal gesehen zu haben. Als ich aber nach weiteren fünf Minuten wieder vor demselben Haus stand, wurde ich doch etwas unruhig. Nun wäre ich bereit gewesen, mich nach dem Weg zu erkundigen. Aber die Straße war menschenleer.
Es war mittlerweile kurz vor neun. Ein halbe Stunde später hatte ich ein Telefoninterview vereinbart. Ich wollte ein Taxi rufen. Doch wie gesagt: Ich hatte mein Handy in Katjas Wohnung gelassen. Um zusätzlichen Ballast zu vermeiden.
Ein unverzeihlicher Fehler.
Ich fürchtete, den Termin zu verpassen und begann wieder leicht zu joggen. Mein Orientierungssinn war jedoch genauso abhanden gekommen wie meine Fitness.
Ich verfranste mich immer mehr in diesem weißen Häuserlabyrinth, und nach zehn Minuten meldete sich mein rechter Fuß schmerzhaft zurück, auch die Oberschenkel begannen wieder zu brennen. Bald hörte ich auch wieder das vertraute Geräusch meiner rasselnden und pfeifenden Lungen.
Jetzt hätte ich auch einen Zombie nach dem Weg gefragt. Dann sah ich zum Glück endlich jemanden auf der Straße. Es handelte sich um eine sehr attraktive Frau. Um die Dreißig vielleicht, dunkelblond, sehr elegant.
Ich zögerte, sie anzusprechen. In meinem jämmerlichen Zustand war eine zivilisierte Form der Kontaktaufnahme nicht mehr möglich. Diese hanseatische Erscheinung auf ihrem marineblauen Damenrad und ich in meinen kurzen Hosen, dem zu engen Fußballtrikot und dem hochroten Kopf – das ging gar nicht. Ich überwand mich dennoch und rief ihr hinterher.
»Entschuldigen Sie, bitte … «
Sie hörte mich nicht.
Vielmehr: Sie wollte mich nicht hören.
Ich versuchte es lauter.
»Entschuldigung … Entschuldigung … «
Keine Reaktion, nichts. Ich begann zu brüllen.
»Hallo! … Hallo! … So warten Sie doch … Hallo! … «
Aus den Augenwinkeln musste sie mich gesehen haben. Aber sie wendete nicht einmal den Kopf zu mir um. Ich setzte zu einem sinnlosen Sprint an. Zwanzig, dreißig Meter, mehr schaffte ich nicht. Dann war sie weg.
Ich fühlte mich furchtbar. Ich wollte zum zweiten Mal an diesem Tag vor Scham im Erdboden versinken. Aber dafür war jetzt keine Zeit. Ich musste mich beeilen, mein Termin rückte immer näher.
Ich mobilisierte noch mal meine letzten Kräfte. Endlich fand ich einen Jogger, der sich meiner erbarmte und mir geduldig den Weg aus dem Irrgarten der Hamburger Herrenhäusern erklärte. Nach einer Viertelstunde hatte ich schließlich Eppendorf erreicht, den Ausgangspunkt meiner Leidenstour.
Ich schaute auf die große Uhr an der Kreuzung in Katjas Straße und zog Bilanz: Tatsächlich war ich an diesem Morgen unfassbare eineinhalb Stunden unterwegs gewesen – davon rund fünfundsiebzig Minuten joggend! Ich konnte es nicht glauben. So lange war ich seit mindestens zehn Jahren nicht mehr gelaufen. Aber ich hatte weder Kraft noch Zeit mich darüber zu freuen. Die Zeit drängte, es war kurz vor halb zehn. Vollkommen ausgelaugt erreichte ich Katjas Wohnung im zweiten Stock. Meine Hände zitterten vor Erschöpfung, als ich die Tür aufschloss. Ich rief sofort den Berater eines Fußball-Nationalspielers an, mit dem ich mich zum Telefoninterview verabredet hatte. Er ging sofort ran.
»Hallo, Herr Horeni, schön dass Sie so pünktlich anrufen, aber ich möchte Sie bitten, unser Gespräch um eine halbe Stunde zu verschieben. Ich war gerade eine Stunde joggen, hat etwas länger gedauert als sonst. Ich möchte gerne nochmal unter die Dusche. Ist das in Ordnung für Sie?«
»Natürlich«, antwortete ich müde, »bis später«.
Diese Sätze gaben mir endgültig den Rest. Der Kerl war mindestens fünfzig, hatte bestimmt auch sieben oder acht Kilo zu viel auf den Rippen und schaffte es trotzdem, regelmäßig locker eine Stunde zu laufen. Warum gelang das mir nicht?
Ich versuchte mich nach dem Interview bis zum frühen Abend von den Strapazen zu erholen. Nach dem Mittagessen legte ich mich aufs Bett und ergab mich einem traumlosen, ohnmächtigen Schlaf. Als ich nach zwei Stunden aufwachte, spürte ich schon einen leichten Muskelkater in meinen Beinen. Und mit jeder Minute wurde er schlimmer.
Eigentlich wollte ich mich am späten Nachmittag gemeinsam mit einem Kollegen in die Hamburger Arena aufmachen. Dort fand das letzte Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft in der Saison 2006/2007 statt. Eigentlich hatten wir vereinbart, gemeinsam die S-Bahn zum Stadion zu nehmen. Mir fiel es aber jetzt schon höllisch schwer, nur die knapp zwei Dutzend Treppenstufen aus dem zweiten Stock zu bewältigen. Rückwärts ging es tatsächlich etwas besser, aber an einen längeren Fußmarsch war überhaupt nicht zu denken. Als ich humpelnd und ächzend unten angekommen war, bestellte ich gleich ein Taxi.
Aber selbst das Einsteigen fiel mir schwer. Ich holte meinen Kollegen ab und erzählte ihm auf der Fahrt von meinem Höllenlauf.
Wir fuhren bereits eine knappe halbe Stunde, als ich plötzlich ein enormes Ziehen am hinteren rechten Oberschenkel spürte. Ich musste an Lothar Matthäus’ berühmten Satz denken, den ich nun endlich richtig verstand: »Und dann machte der Muskel zu.«
Jetzt machte mein Muskel zu!
Da war er: Mein Krampf. Im rechten Oberschenkel. Ich schrie auf. Um den Krampf zu lösen, versuchte ich hektisch, mein Bein auszustrecken. Ich saß hinter dem Fahrer und trat ihm dabei, von Schmerzen gepeinigt, mit voller Wucht in den Sitz.
»Was ist denn da hinten los, ist ja schlimmer als im Schulbus«, fluchte der Fahrer.
»Krampf«, brachte ich nur noch mit schmerzverzerrtem Gesicht hervor.
Nach ein paar Sekunden ließ die Wucht des Schmerzes zum Glück nach. Ich konnte wieder normal sitzen – und sprechen.
»Ich habe heute ein bisschen viel Sport gemacht, tut mir leid wegen des Tritts«, entschuldigte ich mich.
»Sich zum Länderspiel fahren lassen und selbst nix drauf haben, das sind mir die Liebsten«, spottete der Fahrer. Er war gerade dabei, sich um sein Trinkgeld zu reden, da krampfte mein Oberschenkel wieder blitzartig zusammen. Ich schrie erneut auf.
»Soll ich einen Krankenwagen holen? Da kann man Sie liegend ins Stadion bringen«, kam es trocken von vorne.
Mein Kollege aus dem politischen Ressort lachte darüber so politisch unkorrekt, als ob er sich sein Geld bei einer billigen Talkshow verdienen müsste und nicht bei einer seriösen Zeitung. Mir schossen vor Schmerz die Tränen in die Augen. Aber wenigstens half er mir dieses Mal, mein Bein wieder auszustrecken und den Krampf zu lösen.
Als wir endlich am Stadion ankamen, hatten der Taxifahrer und mein Kollege mittlerweile Freundschaft geschlossen. Mein Kollege hatte nämlich erzählt, dass ich zur »Spezies der Sportjournalisten« gehörte und nun über die deutsche Nationalmannschaft schreiben müsste. Der Fahrer fand das brüllend komisch.
»Muss man unsportlich sein, um über Sport zu schreiben?«, fragte er meinen Kollegen. Beide schüttelten sich vor Lachen.
Wir kamen die letzten Meter im Stadion nur noch ganz langsam voran. Ich fürchtete bei jedem Schritt, der Krampf würde mir wieder in den Oberschenkel fahren. Ich mied Treppen, wo ich nur konnte, was in einem Fußballstadion ziemlich schwierig ist. Glücklicherweise führt in Hamburg ein Fahrstuhl die Journalisten fast bis zu ihren Plätzen hinauf. Die Presse-Transportgarantie warf zwar ein seltsames Licht auf unsere Berufsgruppe, bedeutete aber in diesem Moment meine Rettung.
Von diesem Tag an liebte ich diese neue Arena. Auf der Tribüne tauschte ich dann noch meinen Sitzplatz mit einem anderen Kollegen, damit ich mein lädiertes Bein in eine komfortablere Haltung bringen konnte. Das Länderspiel konnte beginnen. Wenn auch in Schonhaltung.
Schon zig Male hatte ich die deutsche Nationalmannschaft spielen gesehen. Doch dieses Mal betrachtete ich sie plötzlich mit ganz anderen Augen. Während ich in den neunzig Minuten immer wieder gegen weitere drohende Krämpfe in meinem Oberschenkel ankämpfte, fiel mir die Müdigkeit der Spieler nach einer strapaziösen Saison viel deutlicher auf als früher. Ich konnte förmlich spüren, wie sich Miroslav Klose über den Platz schleppte, wie schwer es Christoph Metzelder fiel, mit den slowakischen Stürmern Schritt zu halten, und wie sein müder Körper es nicht mehr schaffte, ein Eigentor zu verhindern.
Ich hatte tatsächlich Mitleid mit den Stars – zum ersten Mal.
Dann schrieb ich über die Begegnung, die Deutschland 2:1 gegen die Slowakei ein bisschen glücklich gewann, dass es ganz falsch wäre, die Nationalspieler wegen ihrer Schwächen an diesem Abend allzu sehr zu kritisieren. Ich wusste nur zu genau, wie sehr sich die meisten Profis in diesen letzten neunzig Minuten noch einmal gequält haben mussten. Ein bisschen fühlte ich mich ja wie einer von ihnen.
Nach dem Spiel sprach ich mit dem Bundestrainer über die Partie.
»Die Frische hat etwas gefehlt, und man hat gemerkt, dass die Spieler müde sind. Aber der Wille war vorhanden«, sagte Joachim Löw. Keiner konnte die Worte des Bundestrainers so gut verstehen wie ich. Danach wechselte ich noch ein paar Worte mit Christoph Metzelder. Er meinte, der Glanz habe an diesem Abend etwas gefehlt.
»Aber dafür muss man doch Verständnis haben, wenn man bedenkt, was wir geleistet haben.«
Solidarisch rieb ich meine schmerzenden Oberschenkel. Die Nationalspieler redeten eigentlich fast nur noch vom Sommerurlaub, und ich wäre sofort bereit gewesen, uns allen ein paar Liegestühle in die Stadionkatakomben hinzustellen, um mit ihnen gemeinsam die müden und schmerzenden Beine hochzulegen. Denn eine große Gemeinsamkeit zwischen mir und den Fußball-Stars war an diesem Abend nicht zu übersehen: Wir schleppten uns gemeinsam mit letzter Kraft aus dem Stadion.
Als ich weit nach Mitternacht hundemüde ins Bett fiel, war in mir eine Entscheidung gereift: Ich entschloss mich, wieder Sport zu treiben! So richtig, wie früher. Ob mit oder ohne Schmerzen. Das war egal. Nur der Wille zählte.
Innerhalb weniger Tage gelang es mir jedoch mühelos, mein scheinbar unumstößliches Vorhaben wieder zu unterlaufen. Ich hatte mir dafür nicht einmal eine Ausrede überlegen müssen, um den guten Vorsatz wieder umzuwerfen.
Der höllische Muskelkater hatte in den ersten Tagen jede Bewegung zur Tortur gemacht. Sport treiben war in diesem Zustand faktisch unmöglich. Selbst wenn ich wirklich gewollt hätte: Es ging einfach nicht. Mit einer gewissen Erleichterung stellte ich danach fest, wie der Alltag und mein Hang zur Bequemlichkeit wieder ihre alte, mächtige Allianz eingingen. Mein Impuls, aktiv zu werden, wurde langsam, aber sicher schwächer.
Als die Muskelschmerzen nach ein paar Tagen allmählich aus Beinen und Rücken gewichen waren, konnte ich mich morgens schon wieder halbwegs aufrecht vom dritten Stock runter zum Auto schleppen. Am Arbeitsplatz angekommen, ließ ich mich mit dem Aufzug, jede Treppenstufe ignorierend, von der Tiefgarage bis in mein Büro transportieren. Mehr als zweihundert Schritte musste ich also vom Frühstückstisch bis zu meinem gut gepolsterten Bürostuhl nicht zurücklegen. So viel Bewegung genügte mir vollkommen. Ich kann ja auch in ein paar Tagen wieder mit dem Sport anfangen, beruhigte ich mich.
Die Zeit für eine konkrete Sport-Vermeidungsstrategie war also noch nicht reif; das Thema Sport-Comeback musste ich noch nicht endgültig abschließen. Ich spürte jedoch mit jedem Tag, der weiter ohne körperliche Aktivität verging, dass ich mir nur noch ein paar kleine Hürden in den Weg legen musste, um meinen schönen Vorsatz endgültig über Bord zu werfen.
Ich hatte keine geeigneten Sportschuhe. Und auch keine Zeit, um mir welche zu kaufen. So redete ich es mir zumindest ein. Ich fand mich ziemlich überzeugend. Zwei gute Gründe, um alles zu lassen, wie es war.
Am Samstag hatte ich frei. Trotzdem – aus dem Schuhkauf wurde nichts. Es gab dafür, wie ich fand, wieder gute Gründe: Am Morgen musste ich zunächst mit meinem acht Jahre alten Sohn zum Fußball. Punktspiel. Da darf man natürlich nicht fehlen.
Danach musste ich die Wochenration Getränke besorgen und am Nachmittag fuhren wir mit Freunden in den Rheingau. Da konnte ich natürlich nicht aus der Reihe tanzen. Wegen ein paar lächerlicher Turnschuhe.
Ich verschob den Schuhkauf also mit einem einwandfreien, guten Gefühl auf die kommende Woche. Aber dann berichtete mir meine Frau Patricia scheinbar beiläufig und mit einer gewissen Schadenfreude von einem Gespräch mit Dragiza, unserer Putzfrau.
Dragiza arbeitet seit rund fünfzehn Jahren in unserem Haus. Sie ist natürlich viel mehr als eine Putzfrau. Dragiza war schon da, als unsere beiden Kinder auf die Welt kamen. Sie hat in all den Jahren die großen und die kleinen Kinderdramen miterlebt, und in Notfällen stand sie sofort als Babysitterin bereit. Dragiza war immer da, wenn wir sie brauchten.
Eine gewisse gegenseitige Vertrautheit hatte sich somit im Laufe der Jahre entwickelt.
Nun lässt sich unsere Wohnung bedauerlicherweise nicht wie bei einem prächtigen Familiensitz in verschiedene Flügel aufteilen. Das Badezimmer mündet daher leider nur in einen schmalen Flur, und so kommt es mitunter vor, dass ich Dragiza morgens dort unvermittelt begegne. Meistens dann, wenn ich gerade aus der Dusche komme und sie die Wohnungstür aufschließt.
»Weißt du, was Dragiza letztens zu mir gesagt hat?«, fragte mich Patricia nun süffisant. Ich erinnerte mich sofort an den Moment, als ich vor ein paar Tagen nur mit einem Handtuch um die etwas ausladenden Hüften bekleidet im Flur stand und Dragiza mich mit einem kurzen, aber scharfen Blick von oben bis unten musterte.
Patricia grinste vergnügt, und ohne eine Bemerkung von mir abzuwarten, fuhr sie fort: »Dragiza sagte zu mir: ›Michael ist aber auch dicker geworden.‹ Sie hat sehr gelacht.«
»Warum sagt sie das nicht mir? Was erzählt ihr euch eigentlich noch alles hinter meinem Rücken?«, fragte ich leicht gereizt.
Prinzipiell mochte ich ja Dragizas direkte Art ja sehr, aber sie hatte ja nun auch nicht gerade die Figur eines Supermodels. In den letzten Jahren hatte sie selbst ordentlich zugelegt, und Sport kannte sie doch auch nur aus der Sportschau. Entrüstet wie einst Giovanni Trapattoni fuhr ich aus der Haut.
»Was erlaubt sich Dragiza eigentlich?«
»Sie ist diskret – wie Frauen halt so sind«, entgegnete Patricia grinsend und sah mit einem leicht amüsierten Blick an mir herab. »Und so ganz unrecht hat sie ja nun auch nicht.«
Das tat weh. Verdammt weh. Besonders weil es stimmte.
Ich weiß zwar nicht ganz genau, wie viel Wahrheit hinter dem Spruch steckt, dass Frauen spätestens dann merken, wenn die Jungs vom Bau sich nicht mehr nach ihnen umdrehen, dass sie etwas an sich verändern sollten. Vermutlich sehr viel. Denn genauso so fühlte ich mich jetzt: als ein vom anderen Geschlecht diskriminierter und von seiner Ehefrau im Stich gelassener Mann. Der kritische Unterton Patricias hinsichtlich meiner Physiognomie war ja nicht zu überhören. Ich kam um eine schonungslose körperliche Bestandsaufnahme nach zweiundvierzig Jahren nicht mehr herum.
Mein Urteil fiel nicht wirklich gut aus: Ich litt zwar noch nicht unter massivem Übergewicht, aber ein paar Kilos waren eindeutig zu viel. Um den Bauch und die Hüften herum war ich aus der Form geraten, ältere Hosen bekam ich auch kaum noch zu.
»Aber so geht es doch eigentlich fast allen, die ich kenne«, sagte ich zu mir. Ich versuchte immer noch, mir etwas vorzumachen. Mein Körper hatte zwar noch nicht so gewaltige Ausmaße angenommen, dass ich ein Jahr lang dem Diät-Wahnsinn hätte verfallen müssen, um mit einem umwerfenden Abnehmergebnis ins Guinness Buch der Rekorde einzugehen. Bei einer Größe von exakt ein Meter neunundsiebzig kam ich aber mittlerweile schon auf knapp achtzig Kilo. Tendenz eindeutig steigend.
Zu meinen sportlich besten Tagen vor zehn Jahre waren es 69 Kilo. Damals kam ich nicht einmal auf die Idee, mich auf die Waage zu stellen. Wozu auch? Der Spiegel sagte mir ja, dass ich schlank und sportlich aussah.
Ich ging zum Bücherregal und holte ein Fotoalbum hervor und betrachtete die schöne Vergangenheit. Ich sah, wie ein gut gebräunter, schlanker, sportlicher Mann am Strand mit seiner Tochter spielte. Das soll ich gewesen sein? Es war ein Mann von Anfang dreißig, der nicht so aussah, als müsste er sich davor fürchten, seiner Putzfrau nur mit einem Handtuch um die Hüften im Flur zu begegnen.
Ich sah an mir herunter. Ja, die Beweislage war buchstäblich erdrückend. Um meine Problemzonen Bauch und Hüfte war es in Wirklichkeit viel schlechter bestellt, als ich mir die letzten Jahre eingestehen wollte.
Als ich das Fotoalbum mit meiner sportlichen Vergangenheit wieder sorgsam verstaut hatte, quälte mich der Gedanke, wie ich wohl in zehn Jahren aussehen würde. Knapp zehn Kilo hatte ich im Vergleich zu meiner Topform von vor zehn Jahren jetzt schon zugelegt, davon bestimmt fünf Kilo allein in den vergangenen drei Jahren. Das Tempo der Gewichtszunahme hatte sich also immer weiter beschleunigt. Ich stellte eine Hochrechnung an: Wenn ich den Trend zur rasanten Verfettung der letzten drei Jahre ein wenig bremsen könnte, müsste ich mich glücklich schätzen, wenn ich in zehn Jahren wiederum »nur« weitere zehn Kilo zulegen würde. Dann hätte ich neunzig Kilo drauf!
NEUNZIG KILO! Und das wäre noch der günstige Verlauf! Eine noch düsterere Prognose wagte ich gar nicht anzustellen.
Ich befühlte meinen Bauch und stellte mir zehn zusätzliche Kilo vor. Ob ich dann beim Duschen tatsächlich meine Füße aus dem Blick verlieren würde? Würde ich einen verstärkten Lattenrost unter der Matratze benötigen? Würde meine Frau auch einen Fettklops lieben?
Und dann die Aussicht auf meine Garderobe: Schon jetzt drückten und zwickten die Hosen. Die neue Jeans, die ich mir vor gerade mal zwei Wochen gekauft hatte, musste ich schon eine Nummer größer als gewöhnlich nehmen. Ich hatte mich damit beruhigt, dass der Schnitt der neuen Levis wohl eben etwas enger ausfiel. Mit meinem Bauch hatte das natürlich gar nichts zu tun. Wenn es tatsächlich so weiterging, würde mir in zwei, drei Jahren keine einzige Hose mehr passen. Die Hemden, die Pullover – alles zu eng! Und am schlimmsten: meine schönen und sündhaft teuren Anzügen. Alles neu – was das kostet!
Aber wenigstens meine Schuhe könnte ich behalten, selbst wenn ich als konturloser, schwammiger Zweihundertachtzig-Pfünder durch die Straßen stapfen würde. Ich könnte mir dann weiter in Größe 43 die schönsten Schuhe kaufen. Schuhe passen einfach immer. 300 Euro das Paar? Ich würde darüber nicht mal mit der Wimper in meinem speckigen Gesicht zucken. Nun verstand ich die Frauen und ihren seltsamen Schuh-Tick. Ich war endlich hinter das Geheimnis gekommen, warum Frauen Schuhe so sehr lieben: Füße brauchen keine Diät! Schuhe passen immer!
Und mir wurde klar, dass meine ursprüngliche und eigentlich schon wieder verworfene Idee, wieder zu laufen, um fit zu werden, nur Ausdruck eines Luxusproblems gewesen war.
Tatsächlich war die Sache viel ernster.
Ich beschloss, Sport zu treiben, um fit zu werden und um abzunehmen.
2. KapitelDer letzte VersuchJULI2007
Als Erste-Hilfe-Maßnahme fiel mir nichts anderes als Joggen ein, um das Einrosten meines Körpers zu stoppen. Am nächsten Morgen machte ich mich in den Ostpark auf. Dieser zieht Sportler seit Jahren magisch an, und am Wochenende verwandelt sich die riesige Liegewiese in ein riesiges Fußballfeld. Der Rasen wird dann in fünf, sechs Spielfelder aufgeteilt, die ganz unterschiedlich groß sind – je nachdem wie viele Leute die jeweiligen Teams gerade zusammenbekommen. Manche bringen sogar richtige Tore mit und markieren mit Eckfahnen ein sehr echt wirkendes Spielfeld. Den meisten aber reichen hingeworfene Trainingsjacken als Torpfosten.
An Ehrgeiz fehlt es nicht, aber oft an Talent. Das hat im Ostpark Tradition. Man konnte schon Joschka Fischer und Dany Cohn-Bendit beobachten, die dort früher oft gekickt haben. Jahrelang habe ich ihre sportlichen Erben nur müde belächelt. Ich fühlte mich den Hobbykickern weit überlegen. In meiner Jugend hatte ich viele Jahre in den höchsten Fußballklassen und gegen Andy Möller, Manfred Binz und Ralf Falkenmayer gespielt. Sie wurden Stars und spielten später in der Nationalmannschaft. Aber trotzdem fühlte ich mich nie wie ein angehender Profi. Mit achtzehn habe ich aufgehört: Bei einer Zeitung einen guten Job zu finden, schien mir deutlich realistischer, als auf eine große Fußballkarriere zu hoffen.
Als ich nun meine ersten Runden drehte, musste ich einsehen, dass meine Kondition auf einem beklagenswert niedrigen Niveau angekommen war. Ich hätte jetzt genauso kraftlos rumgekickt wie all die anderen, denen ich mich so lange überlegen gefühlt hatte. Ich musste erst wieder das Laufen lernen, musste ganz von vorne anfangen. Wie beim Idiotentest, wenn der Führerschein weg ist.
Ich nahm mir vor, zunächst eine halbe Stunde in gemächlichem Tempo zu joggen. Wenn ich dann vielleicht nach ein paar Wochen 45 Minuten pro Tag schaffen sollte, müsste ich Katja beim nächsten Mal nicht mehr anschwindeln – und mein Gewichtsproblem würde ich vielleicht auch in den Griff kriegen. Mehr wollte ich ja nicht.
Die ersten Tage befand ich mich wie im Rausch. Mein sportlicher Ehrgeiz, der jahrelang unter Manuskripten in der Redaktion, Theoriedebatten in der Uni und Windeln im Kinderzimmer begraben gewesen war, meldete sich endlich wieder zurück. Ich machte mich jeden Morgen voller Energie auf den Weg in den Park. Das Laufen ging ich systematisch an, mit Stoppuhr und Laufplan. Ich wollte nichts mehr wie früher dem Zufall überlassen.
Einfach raus und kicken?
Nein!
Einfach raus und Tennis spielen?
Nein!
Einfach raus und trainieren?
Nein!
Ich benötigte sechs Minuten von der Haustür bis zum Park.