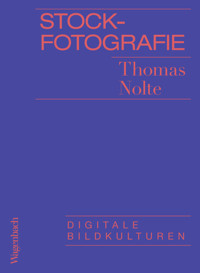
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Stockfotografien gibt es bereits seit dem 19. Jahrhundert, im Internet aber haben sie als Fast-Food für den unersättlichen Bilderhunger ungeahnte Verbreitung gefunden. Die Fotos mit ihren auf Vorrat produzierten Motiven sind in jedem Kontext frei einsetzbar und damit fast ein Idealtypus des digitalen Bildes. Damit werden sie jedoch zum bevorzugten Objekt ökonomischer Interessen. Und während sie in den Sozialen Medien das Material für unzählige Memes liefern, verwenden Unternehmen sie mittlerweile zum Training ihrer KI- Bildgeneratoren, deren Etablierung sie schon bald ihre eigene Existenz kosten könnten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stockfotos sollen unauffällig sein und in möglichst vielen Kontexten verwendet werden können. Im Internet sind sie omnipräsent, nicht zuletzt als Material für unzählige Memes. Thomas Nolte über ein lukratives Geschäftsmodell, das jedoch zunehmend unter Druck gerät: Wird Stockfotografie schon bald von KI-generierten Bildern ersetzt?
Thomas Nolte
STOCKFOTOGRAFIE
Pathosformeln des Spätkapitalismus
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
DIGITALE BILDKULTUREN
Durch die Digitalisierung haben Bilder einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Dass sie sich einfacher und variabler denn je herstellen und so schnell wie nie verbreiten und teilen lassen, führt nicht nur zur vielbeschworenen »Bilderflut«, sondern verleiht Bildern auch zusätzliche Funktionen. Erstmals können sich Menschen mit Bildern genauso selbstverständlich austauschen wie mit gesprochener oder geschriebener Sprache. Der schon vor Jahren proklamierte »Iconic Turn« ist Realität geworden.
Die Reihe DIGITALE BILDKULTUREN widmet sich den wichtigsten neuen Formen und Verwendungsweisen von Bildern und ordnet sie kulturgeschichtlich ein. Selfies, Meme, Fake-Bilder oder Bildproteste haben Vorläufer in der analogen Welt. Doch konnten sie nur aus der Logik und Infrastruktur der digitalen Medien heraus entstehen. Nun geht es darum, Kriterien für den Umgang mit diesen Bildphänomenen zu finden und ästhetische, kulturelle sowie soziopolitische Zusammenhänge herzustellen.
Die Bände der Reihe werden ergänzt durch die Website www.digitale-bildkulturen.de. Dort wird weiterführendes und jeweils aktualisiertes Material zu den einzelnen Bildphänomenen gesammelt und ein Glossar zu den Schlüsselbegriffen der DIGITALEN BILDKULTUREN bereitgestellt.
Herausgegeben von
Annekathrin Kohout und Wolfgang Ullrich
Stets zu Diensten: Stockfoto eines Kellners
Einleitung
In Robert Walsers Roman Jakob von Gunten ist die gleichnamige Titelfigur ihrem aristokratischen Elternhaus entflohen und verfolgt das Ziel, eine »reizende, kugelrunde Null«1 zu werden. Während Jakobs älterer Bruder in der Großstadt, in der sich beide Geschwister angesiedelt haben, als Künstler tätig ist, lässt sich Jakob in einer Dienerschule ausbilden. Er möchte sein Leben fortan bedingungslos in den Dienst anderer Menschen stellen.
Auf diese Weise ließe sich auch von der Stockfotografie erzählen: Im Gegensatz zu verwandten Bereichen wie etwa der Kunstfotografie ist sie bar jeglicher künstlerischen Ambitionen; ihr einziger Zweck besteht darin, der Bildverwertung beziehungsweise den Wünschen ihrer Kund*innen zu dienen.
Diese Kunstabstinenz wird besonders deutlich, wenn man Stockfotos von Museumsräumen mit ähnlichen Motiven aus der Kunstfotografie vergleicht. So hat zum Beispiel der Fotograf Thomas Struth in mehreren Werken die Innenräume berühmter Museen festgehalten. Auf seinen Bildern scheint die ausgestellte Kunst aus den Rahmen hinaus- und so in einen Dialog mit ihrer Umgebung zu treten. (# 1) Bei den Stockfoto-Darstellungen von Museen und Galerien sind die Rahmen der Gemälde indes oft leer. (# 2) Man könnte meinen, dass sich die auf massenhafte Verbreitung ihrer Bilder abzielende Stockfotografie dagegen wehrt, die als einmalig angesehene Kunst darzustellen.
# 1, 2 Museumsdarstellungen in Kunst- und Stockfotografie
Dass innerhalb des Rahmens eine Leere klafft, hängt aber vor allem mit der dienenden Funktion der Stockfotografie zusammen. Das Bild serviert seinen Nutzer*innen eine Vorlage, deren Weißraum sie je nach Gusto füllen dürfen. Diese Dienstbarkeit der Stockfotografie, die ihr seit jeher zu eigen ist, mag einer der Gründe für ihre beschleunigte Karriere im digitalen Zeitalter sein. Der Medienwissenschaftler Markus Krajewski vertritt in seiner Mediengeschichte des Dieners beispielsweise die These, dass die digitalen Techniken in der Nachfolge der historischen Dienerfigur stehen. Im Internet, so die Ausgangsbeobachtung Krajewskis, werde die Kommunikation durch etliche unsichtbare, im Hintergrund arbeitende Prozesse gesteuert. Deren Bezeichnung evoziere mit Begriffen wie Server die Welt der Domestiken des 18. Jahrhunderts. Während der »Typus des Dieners« im 20. Jahrhundert nach und nach verschwinde, beginne »er in aktuellen Kontexten des Digitalen […] eine außerordentliche Wichtigkeit zu erhalten«2 und in verwandelter Gestalt zurückzukehren.
Um die mit der Verbreitung des Internets aufkommenden Bedürfnisse nach Bildern und Bebilderung zu befriedigen, ist die Stockfotografie nun stets zu Diensten. In der digitalen Welt ist sie deshalb omnipräsent. Stockfotos sind Bilder, die mit Blick auf einen zukünftigen Verwendungszweck produziert werden und auf Vorrat (»in stock«) bereitstehen. Sucht beispielsweise die Redakteurin eines Apothekenmagazins auf die Schnelle noch ein passendes Bild, um einen Artikel zum Thema Heuschnupfen zu illustrieren, muss sie dafür nicht extra eine Fotografin oder einen Fotografen mit einem Shooting beauftragen. Stattdessen kann sie über eine Schlagwortsuche in den Datenbanken der Stockfotografie nach einem passenden Motiv suchen, etwa das Bild eines Menschen, der sich mit einem von Leid verzerrten Gesichtsausdruck die Nase schnäuzt, oder einer in der Blüte des Sommers stehenden Wiese. Die Stockfotografie ist also in erster Linie ein Geschäftsmodell zur effizienten Bilddistribution.
Die große Verbreitung der Stockfotografie im Internet erklärt sich außerdem aus dem für sie typischen Lizenzierungsmodell, dem der Lizenzfreiheit (»royalty free«). Bei lizenzfreien Rechtemodellen werden nicht die Bilder selbst erworben, sondern lediglich das Recht zu ihrer Nutzung. Dadurch kann ein entsprechendes Bild unbegrenzt oft verwendet werden. Zudem sind die Nutzungsrechte in der Regel nicht exklusiv, weshalb es immer wieder vorkommt, dass ein und dasselbe Motiv in unterschiedlichen Zusammenhängen auftaucht.3 Das kann gelegentlich unerwünschte Konsequenzen haben. So warb etwa die CDU während des Kommunalwahlkampfs in Hannover 2021 mit einem Stockfotomotiv, das die AfD bereits einige Jahre zuvor ihrerseits in einer Kampagne gegen Kita-Gebühren eingesetzt hatte. (# 3, 4)
# 3, 4 Zwei politische Kampagnen, ein Stockfoto
In diesem Buch will ich zeigen, dass sich aus dem Geschäftsmodell der Stockfotografie eine eigene unverwechselbare Ästhetik ergibt. Stockfotos zeichnen sich dadurch aus, dass sie ohne feste Referenz, frei flottierend und immerzu neu kontextualisierbar sind. Diese Charakteristika sind der Stockfotografie zwar schon seit ihrem Entstehen im 19. Jahrhundert zu eigen. Doch erst im Zeitalter des Internets und des Digitalen fügen sich Stockfotos besonders gut in ihr mediales Umfeld ein.
Der Eintritt der Stockfotografie in die digitale Sphäre geht dabei nicht spurlos an ihr vorüber. Vielmehr wird sie von der Dynamik des Internets erfasst: So treiben die Sozialen Medien mit den klischeehaften Darstellungen der Stockfotografie ihren Schabernack, und Unternehmen machen sich die digitalisierten Bilddatenbanken der Stockfotografie zunutze, um ihre künstlichen Intelligenzen (KI) zu trainieren. Damit nehmen Stockfotos in der digitalen Bildkultur eine Scharnierfunktion ein: Sie dienen als Grundlage für eine gerade erst anbrechende Ära von KI-generierten Bildern, in denen sich die Ästhetik der Stockfotografie fortsetzt, ja vielleicht sogar prägend wird.
1 | Stockfotografie als Adoptivkind des Neoliberalismus
Die Stockfotografie scheint – mehr als hundert Jahre nach ihrem Entstehen – im Internet geradezu ihr natürliches Habitat gefunden zu haben. Sie versorgt das Netz nicht nur mit Bildern, die Stockfotoagenturen nutzen zugleich dessen Distributionsformen: Seit den 2000er Jahren wird Stockfotografie ausschließlich über Internet-Plattformen vertrieben. Die Distribution über das Internet verdeutlicht eine Affinität beider Bereiche. Bei der Stockfotografie handelt es sich in erster Linie um ein Geschäftsmodell mit dem Ziel, eine möglichst effiziente Distribution von Bildern zu gewährleisten. Analog dazu besteht das wirtschaftliche Versprechen der digitalen Techniken darin, eine bessere Planbarkeit der Wertschöpfungsketten zu gewährleisten.4 Dass die Stockfotografie so gut ins digitale Zeitalter passt, hat daher zunächst weniger ästhetische als vor allem ökonomische Gründe. Ein Blick in die Geschichte der Stockfotografie zeigt, dass sie seit jeher auf wirtschaftliche Anforderungen reagiert. Aufgrund ihrer engen Verwobenheit mit der Wirtschaft eignet sie sich als Indikator ökonomischer Entwicklungen vom Erlahmen des Wirtschaftswachstums in den 1970er Jahren über Monopolisierungstendenzen des Marktes in den 1990er Jahren bis hin zur Kommerzialisierung des Internets ab der Jahrtausendwende und der wachsenden Marktmacht Chinas in der Gegenwart.
Das Prinzip der Stockfotografie existierte bereits vor der Erfindung der Fotografie. So wurden etwa für die im 19. Jahrhundert verbreiteten Bilderbögen sogenannte Druckstöcke auf Vorrat angefertigt, die generische Szenen wie etwa Schlachtdarstellungen zeigten und anlässlich unterschiedlicher Ereignisse als Einblattdrucke veröffentlicht wurden. Die Produktion von Bildern auf Vorrat hatte hier den Zweck, schneller auf das Tagesgeschehen reagieren zu können.5 Ein Beispiel findet sich in den Neuruppiner Bilderbögen zur 1848/49er Revolution mit dem Serientitel Das merkwürdige Jahr 1848. Auf zwei verschiedenen Bilderbögen, die jeweils Straßenkämpfe in Berlin (# 5) und Frankfurt am Main (# 6) zeigen, finden sich bei genauerer Betrachtung die gleichen Figuren wieder: ein Mann, der mit einer Stange das Pflaster aufreißt, ein weiterer Herr mit Zylinder, der mit einem Holzbrett unterm Arm in die Schlacht eilt, und ein bärtiger Revolutionär, der Steine vom Boden aufsammelt.





























