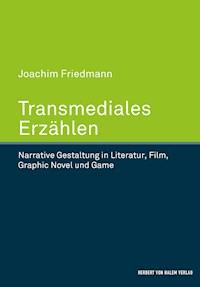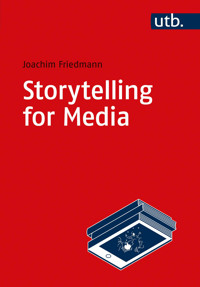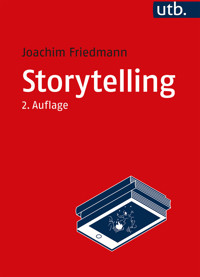
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch führt in die Techniken des Storytelling ein und berücksichtigt wissenschaftliche Grundlagentexte ebenso wie dramaturgische Ratgeber. Dabei benutzt es praktische Beispiele aus verschiedenen Erzählmedien, Genres und Epochen. Der vielfach ausgezeichnete Drehbuch-, Comic- und Gameautor Joachim Friedmann schafft eine theoretisch fundierte wie praktisch anwendbare Toolbox für die Analyse und Gestaltung von Erzählungen in unterschiedlichen Medien, die hier in der 2. Auflage noch um Praxis-Modelle für Storytelling ergänzt wurde, um so auch konkrete Anleitungen für das Kreieren eigener Stories zu geben. Das Buch wendet sich nicht nur an Studierende, sondern an alle, die verstehen wollen, wie Geschichten aufgebaut sind und erzählt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
utb 5237
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Psychosozial-Verlag · Gießen
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Prof. Dr. Joachim Friedmann ist Autor für TV, Comics und Games. Seine Arbeiten wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet (Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Bildungsmedienpreis). Als Storytelling-Consultant berät er unter anderem das Bundesumweltministerium, Microsoft Deutschland und den Deutschen Fußballbund DFB. Er lehrt zum Thema Interaktives und Transmediales Storytelling, Serielles Schreiben sowie Film- und Fernsehdramaturgie, u.a. an der der Filmuniversität Potsdam-Babelsberg, der Filmakademie Baden-Württemberg sowie an zahlreichen internationalen Universitäten und Akademien in Frankreich, Marokko, Nigeria, Estland und Litauen. Von 2017 bis Anfang 2025 war er Professor für Serial Storytelling an der Internationalen Filmschule Köln, seit 2024 ist er Professor für Interaktive Dramaturgie am Kunst- und Mediencampus der HAW Hamburg.
Joachim Friedmann
Storytelling
Einführung in Theorie und Praxis narrativer Gestaltung
2., überarbeitete und erweiterte Auflage
Umschlagabbildung: ©Henk Wyniger
Foto Seite 2: ©Nataly Savina
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 20251. Auflage 2019
https://doi.org/10.36198/9783838561547
© UVK Verlag 2025– Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 5237ISBN 978-3-8252-6154-2 (Print)ISBN 978-3-8385-6154-7 (ePDF)ISBN 978-3-8463-6154-2 (ePub)
Vorwort zur 2. Auflage
Seit dem Erscheinen der 1. Auflage im Herbst 2019 hat sich „Storytelling“ erfreulicherweise zu einem Werk entwickelt, das in der akademischen Welt genauso rezipiert wird wie in der Praxis, und das in Rezensionen inzwischen sogar als Standardwerk bezeichnet wird. Dabei erinnere ich mich an die lebhaften Diskussionen mit meiner damaligen Lektorin Sonja Rothländer zu der Frage, ob ein wissenschaftliches Lehrbuch zu so einem Thema, das eher mit Popkultur und Praxisanwendung assoziiert wird, überhaupt angemessen wäre. Doch gerade die Verbindung von wissenschaftlicher Systematik mit einer fundierten, praxisorientierten Perspektive hat offenbar zu dem Erfolg des Bandes beigetragen – der zudem durch die Publikation einer englischen Ausgabe im Jahr 2021 bestätigt wurde.
Was aber immer wieder als Kritik geäußert wurde, sowohl in Fach-Rezensionen als auch von Lesenden des Buches, war das Fehlen einer konkreten Anleitung zum Verfassen von Geschichten. Die einfache Frage, wie denn nun genau eine Geschichte aufgebaut sein müsse, wie man selber eine Geschichte entwerfen könne, sei nicht ausreichend beantwortet worden. Dieses offene Vorgehen war von mir durchaus intendiert. Es gibt schon etliche Anleitungen zum Verfassen von Geschichten, wenn auch in erster Linie im Bereich des Drehbuches. Die Gefahr bei solchen Anleitungsbüchern ist oft, dass die nach einer vorgegebenen Struktur verfassten Geschichten formelhaft und nicht wirklich innovativ wirken. Mein Buch aber sollte – metaphorisch gesprochen – eher ein Werkzeugkasten zum Verfassen einer Geschichte sein. Durch den bewussten Verzicht auf eine vorgegebene Bauanleitung wollte ich eine maximale Freiheit in der Gestaltung geben, damit verbunden auch die Möglichkeit, auf einige Elemente des Narrativen vielleicht sogar zu verzichten und so eigene Wege zu finden, Geschichten zu verfassen – in welchem Medium auch immer. Trotzdem nehme ich die Kritik und den Wunsch nach Anleitung und Struktur ernst. Um gleichzeitig Platz für Kreativität und künstlerischen Freiraum zu geben, ergänze ich in der nun vorliegenden 2. Auflage den direktiven strukturalistischen Ansatz, der in der dramaturgischen Literatur und in Drehbuchratgebern dominiert, um drei weitere Ansätze: die Geschichte aus dem Charakter, die Geschichte aus dem Thema und die Geschichte aus der Storyworld. Und hoffe, die Lesenden so auch im Kreationsprozess der eigenen Geschichten zu unterstützen.
Diese Ansätze sind als vier neue Kapitel in einem zweiten Teil angefügt. Weiterhin ist der Gesamttext nun auch mit Illustrationen ergänzt, die bislang nur in der englischen Ausgabe zu finden waren. Zudem wurde bei den Beispielen zu den Elementen des narrativen Gestaltens nun auch das Genre der Dokumentationen berücksichtigt. Gerade in der Arbeit zur zweiten Auflage habe ich viel Unterstützung erfahren, von lehrenden Kolleginnen und Kollegen genauso wie von Studierenden. Besonders bedanken möchte ich mich für Mitarbeit und wertvolle Hinweise bei David Daubitz, Eva-Maria Fahmüller, Fionna Frank, Florian Nieser, Jana Thürig, Liz Daggett-Matar sowie Insiah Zaidi. Damit bleibt mir nur noch, viel Spaß bei der Lektüre zu wünschen – und natürlich beim Kreieren Ihrer eigenen Geschichten!
Inhalt
Vorwort zur 2. Auflage
1Storytelling – mehr als Geschichten erzählen
Teil I: Die Analyse
2Die narrative Figur – Leben, Thema, Funktion
2.1Figur funktional
2.2Figur mimetisch
2.3Figur thematisch
2.4Figur antinarrativ
3Setting – der erzählte und der erzählende Raum
3.1Juri Lotman und der semantische Raum
3.2Weitere Möglichkeiten der Raumsemantisierung
3.3Hierarchisierung von Raumereignissen
4Narrative Basisoppositionen – Gegensätze machen Sinn
4.1Die Sinnhaftigkeit der Erzählung
4.2Sinnproduktion durch narrative Basisoppositionen
4.3Idee vs. Konteridee – Narrative Oppositionen in der Filmdramaturgie
4.4Narrative Basisoppositionen als Strukturierungsprinzip in seriellen und interaktiven Erzählungen
5Konflikt – Hindernisse zwingen zum Handeln
5.1Konflikte als initiale Handlungsauslöser
5.2Grundformen des Konflikts
5.3Der universelle Konflikt
5.4Konflikttypen und Handlungstypen
5.5Want und Need
6Transformation – was muss sich ändern?
6.1Transformation vs. Veränderung
6.2Transformation als Kriterium der Geschlossenheit
6.3Die zyklische Transformation
6.4Transformationen in interaktiven Erzählungen
7Emotion – Progression der Gefühle
7.1Emotionen als Genres
7.2Emotionale Progression als Strukturprinzip von Erzählungen
8Wendepunkte – die erwartete Überraschung
8.1Wissenschaftliche Konzepte des Wendepunkts
8.2Der Wendepunkt in der anwendungsbezogenen Dramaturgie
8.3Die Wirkung von Wendepunkten in Literatur und Film
8.4Wendepunkt und Transformation in interaktiven Erzählungen
9Narrative Struktur – Heldenreise in drei Akten
9.1Struktur dramatisch
9.2Struktur mythologisch
9.3Struktur oral
9.4Struktur interaktiv
10Kausalbeziehungen – Warum und Wodurch
10.1Kausalität als Bedingung für Narrativität
10.2Formen der Kausalität
10.3Formen non-kausalen Erzählens
10.4Kausalität und Interaktivität
11Subtext und Gapping – die Rezipierenden erzählen mit
11.1Gapping als text- und medienspezifische Strategie
11.2Subtext
11.3Spannungserzeugung durch Informationsmanagement
11.4Informationsmanagement in interaktiven Erzählungen
12Semantische Objekte – MacGuffins, Horkruxe und Heilige Grale
12.1Plotfunktional vs. nonfunktional
12.2Semantische Objekte in Erzählmedien
12.3Objektsemantisierung als Kommunikationsstrategie
Teil II: Die Kreation
13Die Geschichte aus der Struktur
14Die Geschichte aus dem Charakter
15Die Geschichte aus dem Thema
Case Study Thematisches Erzählen: Better Call Saul
16Die Geschichte aus der Storyworld
Epilog: Werte und Weltsicht
Abbildungsverzeichnis und Bildnachweise
Literaturliste
Stichwortverzeichnis
1Storytelling – mehr als Geschichten erzählen
Es wäre verführerisch, an dieser Stelle mit einer Geschichte zu beginnen. Wäre das nicht der richtige Anfang für ein Buch über Storytelling? Eine spannende, interessante Erzählung, die die Lesenden gleich in den Bann und ins Thema zieht? Ja, spannend wäre es vielleicht. Aber unter Umständen nicht hilfreich. Denn auch wenn praktisch alle Menschen Geschichten erzählen und die narrative Form intuitiv benutzen und erkennen, machen sie sich doch wenig Gedanken über die Art und Weise, wie Geschichten aufgebaut und erschaffen werden. Genau um diese Frage soll es aber in diesem Buch gehen. Hier sollen die Methoden dargestellt werden, mit denen man Geschichten erzählt, es ist ein Blick hinter die Kulissen des Storytellings. Erzählungen sind allgegenwärtig, sie gehören zum menschlichen Leben einfach dazu, erscheinen als eine natürliche Weise zu kommunizieren. Seien es Mythen und Märchen, die für viele frühe Gesellschaften identitätsstiftend waren, Alltagserzählungen, die zwischenmenschliche Beziehungen thematisieren und strukturieren, oder die Vielzahl von Erzählungen, die in Büchern, Filmen, Serien, auf Social-Media-Plattformen, in Dokumentationen und Computer-Games erzählt werden, sei es um zu unterhalten, zu informieren oder zu überzeugen: Geschichten sind quer durch alle sozialen, historischen und kulturellen Schichten eine der wichtigsten Formen, Kommunikation und Information zu organisieren. Die Erzählung ist, wie ROLAND BARTHES es formuliert, „international, transhistorisch, transkulturell, und damit einfach da, so wie das Leben.“ (1991, S. 102) Diese Beobachtung verleitet manche Menschen zu der irreführenden Aussage, dass das Leben doch die besten Geschichten schreibe. Warum dann also überhaupt ein Buch zum Thema Storytelling, wenn doch die Geschichten allgegenwärtig sind und um uns herum ohnehin dauernd geschehen?
Die Antwort ist einfach: Geschichten geschehen eben nicht, sondern werden erzählt. Das Leben und die Existenz stellen nur das Material zur Verfügung, aus dem Storyteller ihre Geschichten formen. Aus der schier unendlichen Menge von Ereignissen wählen sie als Erzählende die aus, die von Interesse erscheinen, gestalten sie auf bestimmte Weise, um sie so zur Geschichte zu machen, perspektivieren sie, strukturieren sie, dramatisieren sie. Wenn dem nicht so wäre, gäbe es dieses Buch nicht. Das Narrativieren von Texten, wie man den Prozess des Storytellings akademisch beschreiben könnte, ist ein hochkomplexer, vielschichtiger und differenzierter Vorgang. Es gäbe auf den ersten Blick logischere, einfachere, knappere Wege, Informationen zu ordnen, zu strukturieren und zu kommunizieren. Aber Geschichten sind für das menschliche Gehirn offenbar die einfachste Form, Informationen zu verarbeiten, wie Untersuchungen der Kognitionspsychologie nahelegen.
Doch obwohl oder gerade weil sie so allgegenwärtig sind, scheint es gar nicht so leicht, Geschichten zu untersuchen, ihre Gestaltungsprinzipien offenzulegen. Erzählungen werden als natürliches Phänomen wahrgenommen. Wenn ich in Seminaren oder Workshops die vermeintlich simple Frage stelle „Was ist eigentlich eine Geschichte?“, herrscht oft nachdenkliches Schweigen – obwohl alle Anwesenden schon mal eine Geschichte erzählt haben und eine Vielzahl von Geschichten gelesen, gesehen, gehört oder auch interaktiv rezipiert haben. Trotzdem ist dies kein widersprüchlicher Befund. Auch wenn bereits Kinder narrative Texte intuitiv identifizieren und benennen, ist eine Erzählung gleichzeitig ein komplexes semiotisches Konstrukt, und narrative Gestaltungsstrategien sind bei näherer Betrachtung keineswegs selbstverständlich. So lässt der narrative Text bewusst Leerstellen und gibt oftmals – im Gegensatz etwa zu instruktiven oder wissenschaftlichen Texten – gezielt bestimmte Informationen nicht preis, etwa in Krimis oder Detektivgeschichten. Selbst wenn uns in Geschichten sprechende Tiere wie in Äsops Fabeln oder gar handelnde Haushaltsgeräte wie im Disney-Animationsfilm The Brave Little Toaster begegnen, können wir die Erzählung auf einer emotionalen und semantischen Ebene immer noch als glaubwürdig empfinden. Und egal, ob eine Erzählung oral, literarisch, filmisch oder digital vermittelt wird – in den allermeisten Fällen nimmt sie eine prototypisch narrative Struktur an. Dabei ist auch nicht von Bedeutung, ob die Geschichte erfunden ist oder ein wahrheitsgetreuer Bericht. Es gibt faktuale genauso wie fiktionale Geschichten. Auch in Dokumentarfilmen, Reality-TV-Shows, Biopics und True-Crime-Podcasts, die doch nur die Wirklichkeit abbilden sollen, werden die Ereignisse von Storytellern zu Geschichten geformt und mit dramatischen Wendepunkten versehen.
Der Versuch, die Spezifik dieser transkulturellen und transhistorischen Kommunikationsform auch theoretisch zu erfassen, beginnt bereits in der Antike mit ARISTOTELES’ grundlegendem Werk, der Poetik, wobei sich Aristoteles auf die damals zeitgenössischen Erzählformen des Dramas, des Epos und der Lyrik bezieht. Dieser Ansatz wird in Deutschland von GOTTHOLD EPHRAIM LESSING in einer Sammlung von Aufsätzen, publiziert als Hamburgische Dramaturgie, weiterentwickelt. Ende des 19. Jahrhunderts emanzipiert sich die Erzählforschung zunehmend von der Dramentheorie. In Russland legt VLADIMIR PROPP 1928 mit der Morphologie des russischen Volksmärchens die erste systematische Untersuchung einer narrativen Gattung vor. Eine grundlegendere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Erzählungen beginnt allerdings erst in den 1960er Jahren, als französische Strukturalisten die Ideen Propps und der russischen Formalisten aufgreifen und systematisch weiterentwickeln.
Seit TZVETAN TODOROV 1969 für die Erzählwissenschaft den Fachbegriff der Narratologie geprägt hat, erfahren narrative Kommunikationsformen, in der Praxis unter dem Begriff des Storytellings subsumiert, immer mehr Aufmerksamkeit. Ganz besonders gilt dies in den letzten 25 Jahren in anwendungsbezogenen Kontexten wie Journalismus, Marketing, Organisationsentwicklung oder Coaching ebenso wie in der Wissenschaft. So prägt MARTIN KREISWIRTH den Begriff des Narrative Turn in den Humanwissenschaften und stellt fest, dass seit den neunziger Jahren in einer Vielzahl von akademischen Disziplinen, seien es Kunst- und Kulturwissenschaften, Sozial- und Naturwissenschaften, aber auch die Medizin, die Volks- und Betriebswirtschaftslehre und die Rechtswissenschaften, ein erhöhtes Interesse an Fragestellungen zur narrativen Form besteht.
Gleichzeitig ist dabei festzustellen, dass der Begriff des Storytellings sowohl im Alltag als auch in akademischen Kontexten oftmals wenig reflektiert benutzt wird. Eine Erzählung ist etwas, was erzählt wird, so der Minimalkonsens und Zirkelschluss. Auch die Minimaldefinitionen der Erzählwissenschaft greifen vor allem in einem anwendungsbezogenen Kontext zu kurz. So wird eine Erzählung in der Narratologie als eine Kette von Ereignissen und Handlungen in Zeit und Raum beschrieben. Gerade für Menschen, die daran interessiert sind, selbst Geschichten zu erzählen, für Storyteller, greifen solche Beschreibungen zu kurz. Wie die Narratologin MARIE LAURE RYAN zeigt, unterliegt die Gestaltung eines narrativen Textes einer Vielzahl von Bedingungen und Spezifikationen – auch wenn Storytelling-Techniken oft intuitiv genutzt werden. Sowohl im wissenschaftlichen als auch im anwendungsbezogenen Kontext muss es aber das Ziel sein, Prinzipien narrativer Gestaltung zu analysieren, zu reflektieren und so bewusst nutzbar zu machen.
Durch die Vielzahl der Disziplinen, die sich mit dem Storytelling beschäftigen, sind hierbei heterogene Erkenntnis-, Anwendungs- und Lehrinteressen zu erwarten. So stellen Filmschaffende möglicherweise Fragen der narrativen Strukturierung in den Mittelpunkt, da audiovisuelle Formate wie Feature-Film, horizontal erzählte Dramaserien oder Sitcoms unterschiedliche zeitliche Längen aufweisen, die sich auf die Erzählstruktur auswirken. Im Game Design wiederum sind Fragen der Raumsemantik von Bedeutung, da in Games für die Rezipierenden Erlebnisräume geschaffen werden, die sowohl spielerisch als auch erzählerisch erkundet werden. Im Marketing ist dagegen von Interesse, wie über die Emotionalisierung einer Geschichte bestimmte Botschaften wirkungsvoller kommuniziert werden können, um so Kaufimpulse auszulösen oder politische Inhalte nachhaltiger zu vermitteln. In der Medizin kann eine Frage sein, wie erkrankte Menschen über Kausalzusammenhänge, die in Heilungserzählungen fokussiert werden, in die Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung gebracht werden. Die Nutzung entsprechender Techniken geschieht also auch kontextabhängig und gerade in der akademischen Lehre sollten die spezifischen Erkenntnisinteressen der jeweiligen Fachrichtung berücksichtigt werden.
Ermöglicht werden kann dies durch einen systematischen Überblick über narrative Gestaltungsstrategien in verschiedenen Erzählmedien, basierend auf wissenschaftlichen, praktischen sowie dramaturgisch-künstlerischen Ansätzen. Diesen Überblick zu schaffen und Techniken des Storytellings für theoretisch wie praktisch Interessierte nutzbar zu machen, ist Zweck des vorliegenden Buches. Den zentralen Gestaltungsprinzipien von Erzählungen – seien es die Kreation von narrativen Figuren und Erzählräumen, die Schaffung von Wendepunkten oder die Strukturierung von Erzählungen – sind jeweils eigene Kapitel gewidmet, in denen sowohl aus wissenschaftlich-theoretischer wie praktischer und anwendungsbezogener Sicht Geschichten in verschiedenen Erzählmedien untersucht werden. Im zweiten Teil des Buches wird beschrieben, wie diese Gestaltungsprinzipien in der Kreation von eigenen Geschichten nutzbar gemacht werden können. Dabei sind die grundlegenden narrativen Gestaltungsstrategien transmedial anwendbar. Trotzdem finden einige dieser Strategien medienspezifische Ausformungen. So unterscheidet sich die Schaffung von Subtext oder die Emotionalisierung einer Erzählung in verbal vermittelten und audiovisuell rezipierten Texten in einigen Punkten – auch wenn sie in beiden Medien wichtiger Bestandteil der Narrativierung ist. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Zusammenhang auf neue Formen des interaktiven Erzählens gelegt – die Eingriffsmöglichkeiten, die Rezipierende zum Beispiel in Games in die Gestaltung der Erzählung haben, verändern einige der Parameter, die in klassischen Erzählmedien gelten.
So kann dieses Buch zwar nicht die Frage beantworten, warum Storyteller es bevorzugen, in Form von Geschichten zu kommunizieren, Informationen zu emotionalisieren, Zuhörende mit Wendungen zu überraschen, in Serien über viele Folgen den Charakter einer Figur zu erkunden, das Publikum in einem Kinosaal zu Tränen zu rühren, Spielende über viele Stunden an ein Game zu fesseln. Aber wie sie das tun, diese Frage wird auf den nächsten 200 Seiten ausführlich beantwortet werden.
Teil I: Die Analyse
2Die narrative Figur – Leben, Thema, Funktion
Eine Konstante von Erzählungen, die sofort ins Auge fällt, sind die Charaktere. In allen Erzählungen aller Kulturen begegnen uns handelnde Figuren mit Zielen, Wünschen und Emotionen – dieser Befund wird bereits in der Antike von Aristoteles gestellt, der bemerkt, dass in Geschichten „handelnde Menschen“ nachgeahmt werden.
Wenn es um die Nachahmung von handelnden Menschen geht, sollten Storyteller sich von der Wirklichkeit und vom Leben inspirieren lassen – diese Vermutung läge nah. Das nimmt auch LINDA SEGER an, eine Drehbuchberaterin aus Hollywood. Für sie ist der beste Weg, eine Filmfigur zu erschaffen, eine genaue Recherche.
Abb. 1: Vorderansicht der Venus von Milo
Psychologie, Beruf, Herkunftsmilieu und Erscheinungsbild sind für sie der konstituierende Rahmen, um möglichst glaubwürdige, lebensechte Figuren zu erschaffen. Betrachtet man Serien wie die Lindenstraße, die sozialrealistischen Filme von KEN LOACH oder die Romane von JONATHAN FRANZEN, so trifft dieser Befund auch zu. Aber wie steht es mit einer Figur wie Colonel Hathi, dem disziplinierten Elefanten aus Disneys Dschungelbuch, oder HK-47, dem erbarmungslosen Kampfdroiden aus dem Computer-Game Star Wars: Knights of the Old Republic? Hier hätte auch intensivste Recherche nicht zum Ziel geführt, denn im Leben gibt es bekanntlich keine Elefanten mit militärischen Rängen oder zynische Kriegsroboter. Solche Figuren sind nicht glaubwürdig in einem naturalistischen Sinne, sondern transportieren in erster Linie eine Weltsicht und verkörpern ein Thema. Der Drehbuchlehrer ROBERT MCKEE schreibt dazu:
Eine Figur ist genausowenig ein menschliches Wesen wie die Venus von Milo eine echte Frau ist. Eine Figur ist ein Kunstwerk, eine Metapher für die menschliche Natur. (2000, S. 403)
In diesem Zusammenhang können auch ein Elefant, eine Marionette wie Pinocchio oder – wie in The Brave Little Toaster – ein Ensemble von Haushaltsgeräten zu narrativen Figuren werden. Ob sie lebensecht sind oder nicht, spielt zunächst keine Rolle.
Abb. 2: Pinocchio, basierend auf einer italienischen Kindergeschichte
In der strukturalistischen Erzählforschung dagegen stehen weder die Glaubwürdigkeit noch die metaphorische bzw. thematische Verortung einer Figur im Fokus der Betrachtung. Theoretiker wie VLADIMIR PROPP oder ALGIRDAS JULIEN GREIMAS betonen die Funktion der Figur im Handlungsgefüge der Erzählung. So identifiziert Propp sieben Figuren, die sämtliche Handlungen und Rollen in einem russischen Zaubermärchen ausfüllen können: der Gegenspieler, der Schenker, der Helfer, die Zarentochter und ihr Vater, der Sender, der Held und der falsche Held. Tatsächlich ist Propps Schema auch auf andere Textarten übertragbar: So ist eine Figur wie Conan der Barbar weder glaubwürdig aus dem Leben gegriffen noch transportiert sie zwingend ein Thema oder eine Weltsicht. Aber Conan ist immer ein Held, egal ob in der literarischen Vorlage, der Comicversion, den Verfilmungen oder dem Computer-Game Conan Exiles.
Es gibt also ganz verschiedene Ansätze, eine Figur in einer Geschichte darzustellen, die offensichtlich über die bloße Nachahmung von Menschen hinausgeht. Mit welchen unterschiedlichen Schwerpunkten diese Figurengestaltung realisiert werden kann, soll im Folgenden dargestellt werden.
2.1Figur funktional
Der strukturalistische Ansatz
Die Figur hat eine klar umrissene Funktion in der Handlung – zu diesem Schluss kommt VLADIMIR PROPP bereits 1928, als er systematisch die russischen Zaubermärchen untersucht und die genannten sieben Funktionen identifiziert. Der Semiotiker ALGIRDAS GREIMAS entwickelt Propps Modell weiter und reduziert es auf sechs Funktionen, die er „Aktanten“ nennt. Diese benennt er als:
•Subjekt
•Objekt
•Sender
•Empfänger
•Helfer
•Widersacher
Die Bezeichnungen ergeben sich aus der Beziehung zum „Objekt des Begehrens“. Somit muss ein Aktant nicht zwingend eine Figur sein, es kann sich auch um ein Objekt handeln. Ebenso kann aber auch das Objekt des Begehrens ein figürliches sein, wenn etwa Harry Potter den Gefangenen von Askaban sucht oder der Klempner Mario seine Freundin aus den Fängen von Donkey Kong befreien will. Dabei können auch mehrere Aktanten in einer Figur verschmolzen werden, diese nennt Greimas dann Archi-Aktanten. Ebenso kann sich ein Aktant in mehreren Figuren realisieren.
Abb. 3: Das Aktantenmodell nach A. J. GREIMAS (1966). Illustriert von Jana Neef
Zudem ist der Ansatz von Greimas auch im Coaching sowie in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften für die Analyse von Erzählungen von Bedeutung. So untersucht ANNE MARIE SODERBERG mit Hilfe des Modells von Greimas eine Geschäftsübernahme in Dänemark und analysiert die Geschichten, in denen die Belegschaft ihre Erfahrungen mit der Fusion in Form von narrativen Interviews vermittelt. Dabei kann sie zeigen, dass die sechs Aktanten in jedem dieser Erfahrungsberichte zu identifizieren sind.
Der kulturanthropologische Ansatz
Mit einem anderen methodischen Ansatz kommt der Drehbuchlehrer CHRISTOPHER VOGLER ebenfalls zu einem Modell, das ein Figurenensemble über seine Funktionen beschreibt. Vogler baut dabei vor allem auf den Arbeiten von JOSEPH CAMPBELL auf, dessen Konzept der Heldenreise (vgl. Kapitel 9 Narrative Struktur) erheblichen Einfluss auf die Praxis des Storytellings hatte. Der Anthropologe Campbell untersuchte eine Vielzahl von Märchen, Mythen, religiösen Erzählungen und Sagen aus aller Welt. Dabei identifizierte er immer wiederkehrende strukturelle Parameter, deren Handlungsabfolge er als den transkulturell und transhistorisch wirksamen Monomythos beschreibt. Das heißt, der Aufbau einer solchen Geschichte ist in allen Kulturen nachvollziehbar. Dasselbe gilt auch für die Figuren, denen der Held des Monomythos auf seiner Reise begegnet und die transkulturell in einer Vielzahl von Erzählungen auftauchen. Campbell benennt diese in Bezug auf die psychotherapeutischen Arbeiten C.G. JUNGS als „Archetypen des kollektiven Unbewussten“. Vogler macht diese Theorien für die Dramaturgie nutzbar und überträgt sie auf Filmerzählungen. Folgende archetypischen Figuren einer Erzählung benennt Vogler:
•Held
•Mentor
•Schwellenhüter
•Herold
•Gestaltwandler
•Schatten
•Trickster
Alle diese Archetypen können natürlich auch ein weibliches oder diverses Geschlecht haben. Der Held ist in den meisten Fällen die Hauptfigur der Erzählung, so wie Luke Skywalker in Star Wars. Der Mentor ist sein weiser Ratgeber oder Lehrer, im konkreten Beispiel verkörpert durch Obi Wan Kenobi. Der Schatten ist der Gegenspieler des Helden, hier Darth Vader. Der Schwellenhüter wacht an einer Schwelle oder Grenze, die der Held im Laufe der Erzählung überwinden muss – die Stormtrooper des Imperiums wollen Luke daran hindern, Tatooine zu verlassen. Der Herold ist analog dem Sender von GREIMAS zu begreifen, er konfrontiert den Helden mit seiner Aufgabe, so wie R2D2 den Hilferuf von Prinzessin Leia an Luke überbringt. Der Gestaltwandler zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Funktion aus der Perspektive des Helden immer wieder ändern kann und so für ein Moment von Unsicherheit oder überraschender Wendung sorgt, so wie Han Solo erst als zynischer Söldner auftritt, um dann im entscheidenden Moment als wichtiger Freund wieder aufzutauchen und Luke im Showdown das Leben zu retten. Der Trickster ist eine anarchische, oft humorvolle Figur, der in der Lage ist, Vorannahmen und Gewissheiten des Helden wie des Publikums immer wieder in Frage zu stellen, so wie C3PO, der durch sein unangemessenes, zeremonielles Verhalten auch in Momenten der höchsten Gefahr für komische Situationen sorgt.
Nicht nur an den Bezeichnungen wird deutlich, dass VOGLER seine Figuren enger definiert als GREIMAS. Gleichzeitig aber ist das Ensemble in seiner Funktion weiter gefasst als bei PROPP oder GREIMAS. So ist etwa dem Gestaltwandler zu eigen, dass er mehrfach seine Rolle wechseln kann. Smeagol aus Der Herr der Ringe, der in VOGLERS Terminologie ein Gestaltwandler wäre, wird in der Terminologie von GREIMAS vom Helfer zum Widersacher und schlussendlich wieder zum unfreiwilligen Helfer des Helden Frodo.
Wissenschaftlich-theoretisch ist VOGLERS dramaturgische Applikation des Archetypenbegriffs kritisch zu betrachten. Für JUNG, der sein Modell in der Psychotherapie nutzbar gemacht hat, sind Archetypen nicht zwingend Charaktere, sondern Symbole und sogenannte Energiekomplexe, denen Bedeutung in der Persönlichkeitsentwicklung seiner Patienten zukommt. Trotzdem ist VOGLERS Modell in der Praxis aufgrund seiner unproblematischen Anwendbarkeit auf alle Arten von Erzählungen nützlich und in vielen Gebieten wie Marketing, Filmdramaturgie oder Gamedesign einsetzbar. Zudem zeigt es, dass bestimmte Figurenfunktionen transkulturell und transhistorisch immer wieder zu identifizieren sind. Und dies gilt nicht nur für die von VOGLER beschriebenen Archetypen. So ist zum Beispiel die Figur der Frau als Kriegerin in einer Vielzahl von Kulturen präsent, sei es die Amazonenkönigin Penthesilea im antiken Griechenland, Mulan im China der Wei-Dynastie, Jeanne d’Arc im Mittelalter im Frankenreich, Snoop in der Fernsehserie The Wire, Katniss in Die Tribute von Panem oder Lara Croft in Tomb Raider.
Abb. 4: Jeanne d'Arc führte die französische Armee in wichtigen Siegen während des Hundertjährigen Krieges an. Die Miniaturmalerei stammt aus dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert; ein zu ihren Lebzeiten angefertigtes Bild ist nicht überliefert.
Ebenso ist die Figur des gerechten Gesetzlosen in fast jeder Kultur zu identifizieren, als Robin Hood in der europäischen Erzähltradition, als die Räuber vom Liang Shan Moor in China, in der Moderne als Mythos von Che Guevara. Man könnte einwenden, dass Jeanne d’Arc und Che Guevara keine narrativen Figuren sind, sondern wirklich gelebt haben. Aber das zeigt nur die Kraft dieser narrativen Archetypen und die Tatsache, dass das Faktuale ebenso narrativiert werden kann wie das Fiktionale, wie die zahlreichen Nachdichtungen des Mythos von Jeanne d’Arc in erfolgreichen Romanen, Theaterstücken, Opern und Filmen zeigen.
Sich solch transkulturell wirksamer Figurenfunktionen oder – in der Terminologie von VOGLER – Archetypen zu bedienen, sie dabei aber gleichzeitig neu und in ungewohnter Weise frisch zu kreieren, ist dabei eine Herausforderung und eine Chance für alle Storyteller.
2.2Figur mimetisch
Zwar betont die Narratologie die Funktion als entscheidende Komponente in der Figurengestaltung. Doch eine rein funktionsorientierte Figur kann eindimensional wirken und birgt die Gefahr, zu einem formelhaften Erzählen zu führen. Conan der Barbar ist zwar in seiner Funktion klar einzuordnen, aber es mangelt ihm an der psychologischen Tiefe eines echten Menschen. Der Erfolg der Superhelden von Marvel beim Publikum liegt unter anderem darin begründet, dass die Autoren ihre Figuren – neben ihrer Funktion als Superheld – mit einem nachvollziehbaren Alltagsleben ausgestattet haben, was beim Konkurrenten DC Anfang der sechziger Jahre kaum der Fall war. Die Marvel-Superhelden dagegen waren nicht nur im Namen der Gerechtigkeit unterwegs, sie kämpften auch mit Alltagsproblemen, die von der jugendlichen Zielgruppe als lebensecht und relevant wahrgenommen wurden. Peter Parker alias Spiderman muss als Fotograf arbeiten und sich von seinem herrischen Chef Jonah Jameson tyrannisieren lassen, um sein Studium zu finanzieren. Er hat Probleme mit seiner Freundin Mary Jane und er versucht seiner Tante May zu helfen, die in kleinen, beengten Verhältnissen lebt.
ARISTOTELES’ Postulat, dass in Geschichten handelnde Menschen nachgeahmt werden, findet bis heute in der Erzählforschung Anwendung und wird in Anlehnung an den altgriechischen Begriff μίμησις, der eben „Nachahmung“ bedeutet, als „Mimesis“ bezeichnet. Diese mimetische Dimension der Figurengestaltung wird vor allem von der modernen Filmdramaturgie betont – Glaubwürdigkeit und psychologische Tiefe der Figur werden hier in den Fokus gestellt, die sorgfältige Recherche gilt als Schlüssel zur Kreation solch einer Figur. In der Tat würden eine Serie wie Emergency Room oder die Erzählung Djamila von TSCHINGIS AITMATOV ohne eine genaue Kenntnis des Milieus und der Menschen nicht ihre erzählerische Kraft entwickeln. Die Rezipierenden haben – ganz ungeachtet der erzählerischen Funktion der Figuren – den Eindruck, die Erlebnisse echter Menschen zu verfolgen. Somit gehört auch eine genaue Recherche des Stoffes zu den Aufgaben eines Storytellers.
Gerade in Erzählungen, die ein eng begrenztes Milieu schildern, wie etwa in einer Krankenhaus- oder Krimiserie, stößt dieses Konzept aber gleichzeitig an seine Grenzen, wenn man die narrative Funktion betrachtet. In einer Krankenhausserie sind die festen Mitglieder des Ensembles alle Ärzte oder Pfleger, in einer Krimiserie Ermittler. Zudem verfolgen sie alle das gleiche Ziel, nämlich Menschen zu heilen beziehungsweise einen Fall aufzuklären, sind also funktional mehr oder weniger identisch. Ein Modell, solche Figuren psychologisch glaubwürdig zu differenzieren und sie dabei gleichzeitig auch funktional einzuordnen, hat die amerikanische Dramaturgin LAURIE HUTZLER entwickelt. Sie benutzt dazu das sogenannte Enneagramm, ein Modell zur Persönlichkeitsbestimmung, das neun verschiedene Typen beschreibt, die wiederum in drei Gruppen zusammengefasst sind, je nachdem, ob der Charakter emotional, rational oder instinktiv gesteuert ist. Im Coaching werden diese als Beziehungs-, Sach- und Handlungstyp bezeichnet, oder popularisierend als Herz, Hirn und Bauch. Diese Persönlichkeitstypen geben Aufschluss über das zugrundeliegende Wertesystem und die daraus resultierenden Verhaltensweisen, die nach HUTZLERS Auffassung bei den verschiedenen Typen klar differenziert werden können. Gerade in Ensembles, die in einem eng begrenzten Milieu agieren und in denen Figuren sich auf den ersten Blick stark zu ähneln scheinen, kommt diese Differenzierung zum Tragen.
So schildert die Serie The Big Bang Theory das Leben der vier Freunde Sheldon, Leonard, Raj und Howard. Alle vier sind hochintelligente Männer, die als Physiker am CalTech Institut in Pasadena arbeiten. Leonard ist als sogenannter View-Point-Charakter die am wenigsten ausdifferenzierte Figur. Der View-Point-Charakter, aus dessen Perspektive meist erzählt wird, ist idealerweise die „normalste“ Figur des Ensembles, sodass die Rezipierenden zu ihr potenziell die höchste Identifikation aufbauen können. Seine drei Freunde dagegen sind nach den Grundtypen des Enneagramms designt. Sheldon stellt mit seinem IQ von 187 den Sachtyp dar, er ist kaum in der Lage, Gefühle zu zeigen oder zu erkennen. Der Ingenieur Howard wird von seinen Freunden wegen seines fehlenden Doktortitels verspottet und ist ein amouröser Draufgänger – der Handlungstyp. Raj sucht die große Liebe, ist aber aufgrund seiner Sensitivität und Schüchternheit kaum in der Lage, mit Frauen zu kommunizieren. Als Beziehungstyp lebt er seine Liebesbedürftigkeit in einem zärtlichen Verhältnis zu seinem Yorkshire-Terrier Cinnamon aus.
Ein ähnliches Muster ist in der Serie Sex and the City zu erkennen: Im Mittelpunkt stehen die vier Freundinnen Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda, die im New York der Jahrtausendwende leben. Alle vier sind erfolgreiche, wohlhabende, gebildete, attraktive Frauen – und mit Mitte bis Ende Dreißig auf der Suche sowohl nach dem Partner fürs Leben als auch nach sexuellen Abenteuern. Wiederum ist es die View-Point-Figur Carrie, die psychologisch die wenigsten Extreme aufweist.
Abb. 5: Das Ensemble der Fernsehserie Sex and the City, die vier Freundinnen Charlotte York (Kristin Davis), Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) und Samantha Jones (Kim Cattrall)
Samantha dagegen, eine erfolgreiche Marketingunternehmerin, lebt als aktiver Handlungstyp ihre Sexualität ungehemmt aus und benutzt Männer selbstbewusst und egoistisch, ohne sich jemals emotional zu öffnen. Für die romantische Charlotte ist Sex dagegen zweitrangig und nur ein Mittel, um endlich den Mann fürs Leben zu finden. Als Beziehungstyp glaubt sie fest an die große Liebe. Die zynische, rationale Miranda ist Akademikerin und Juristin, die die romantischen Vorstellungen von Charlotte belächelt. Sie ist die typische Repräsentantin des Sachtyps.
Die Narratologie sieht diese psychologisch orientierten Ansätze zur Figurengestaltung zwar kritisch, in der Praxis haben sich die genannten Konzepte jedoch vielfach bewährt. LAURIE HUTZLER berät unter anderem den Oscar-Preisträger PAUL HAGGIS, Voglers Archetypen sind die Blaupause für die Ensembles etlicher erfolgreicher Disney-Filme wie zum Beispiel König der Löwen. In Deutschland greifen Autoren und Dramaturgen wie JENS BECKER oder GUNTHER ESCHKE und RUDOLF BOHNE das Enneagramm als Figuren- und Strukturmodell auf. Auch wenn diese Ansätze wissenschaftlich umstritten sein mögen, haben sie in der Praxis ihren Nutzen bewiesen und sind interkulturell anwendbar.