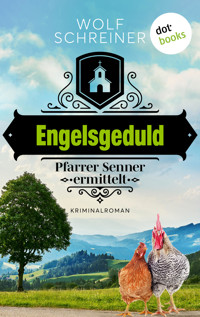4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Pfarrer Senner ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein mörderisches Geheimnis: Der amüsante Regio-Krimi »Stoßgebete« von Wolf Schreiner jetzt als eBook bei dotbooks. Alles Halleluja, oder was? Baltasar Senner, katholischer Pfarrer und Spürnase mit göttlichem Beistand, wittert eine Gefahr für den Gemeindefrieden: Auf dem Kartoffelacker seiner Dorfkirche wird ein gestohlener Rosenkranz gefunden – gleich neben den Überresten eines menschlichen Unterkiefers! Ist die Tote jene Frau, die hier vor vielen Jahren verschwand? Die Dorfgemeinschaft hüllt sich in Schweigen – denn es gibt nun wirklich Dinge, die Hochwürden nichts angehen! Doch der Pfarrer fühlt sich in der Pflicht, für Gottes Gerechtigkeit zu sorgen … und so setzt er Himmel und Erde in Bewegung, um die Wahrheit ans Licht zu bringen! »Dieser Regionalkrimi hat Stil und Niveau, ist spannend, erfrischend und sehr humorvoll.« Passauer Neue Presse Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der humorvolle Kriminalroman »Stoßgebete« von Wolf Schreiner ist der zweite Band seiner Krimi-Reihe um den Dorfpfarrer Senner – ein himmlischer Lesespaß für alle Fans der »Kluftinger«-Krimis und von Nicola Förg! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Alles Halleluja, oder was? Baltasar Senner, katholischer Pfarrer und Spürnase mit göttlichem Beistand, wittert eine Gefahr für den Gemeindefrieden: Auf dem Kartoffelacker seiner Dorfkirche wird ein gestohlener Rosenkranz gefunden – gleich neben den Überresten eines menschlichen Unterkiefers! Ist die Tote jene Frau, die hier vor vielen Jahren verschwand? Die Dorfgemeinschaft hüllt sich in Schweigen – denn es gibt nun wirklich Dinge, die Hochwürden nichts angehen! Doch der Pfarrer fühlt sich in der Pflicht, für Gottes Gerechtigkeit zu sorgen … und so setzt er Himmel und Erde in Bewegung, um die Wahrheit ans Licht zu bringen!
»Dieser Regionalkrimi hat Stil und Niveau, ist spannend, erfrischend und sehr humorvoll.« Passauer Neue Presse
Über den Autor:
Wolf Schreiner wurde 1958 in Nürnberg geboren und studierte in München Kommunikationswissenschaft, Volkswirtschaft und Politik. Er arbeitete als Journalist für Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen, bevor er seine Leidenschaft für Krimis entdeckte. Die Inspiration zu seiner Krimiserie um den katholischen Pfarrer Senner bekam er während seiner Zeit im Wallfahrtsort Altötting. Wolf Schreiner lebt in München.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine Reihe humorvoller Regionalkrimis um den Pfarrer Baltasar Senner mit den Bänden:
»Beichtgeheimnis«
»Stoßgebete«
»Bußpredigt«
»Heiligenschein«
»Engelsgeduld«
»Lammfromm«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2023
Copyright © der Originalausgabe 2012 by Wolf Schreiner
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung von einen Motiven von shutterstock.com (JessicaMcGovern, Arcady, Vasya Kobelev) und stock.adobe.com (SusaZoom)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-660-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Stoßgebete«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wolf Schreiner
Stoßgebete
Kriminalroman
dotbooks.
Kapitel 1
Irgendetwas hatte seinen Schlaf gestört. Ein Geräusch. Irgendwo bellte ein Hund. Dann wieder Stille. War er wach, oder träumte er? Baltasar Senner versuchte sich zu erinnern, was er geträumt hatte. Vergebens. Seine Sinne begannen, wieder normal zu arbeiten. Er spürte die Kühle des Zimmers in seinem Gesicht, roch kalte Asche und Baumharz, lauschte. Alles war ruhig. Noch einige Minuten regungslos liegen. An nichts denken. Die Nestwärme des Betts genießen. Ein bisschen dösen.
Das Unterbewusstsein hinderte Baltasar daran, in Träume abzutauchen. Wie spät war es? Welcher Tag? Sein Gehirn rekonstruierte, dass es Sonntag sein musste. Arbeitstag. Baltasar seufzte. Er zwang sich, seine Augen zu öffnen. Das Grau des Morgens verwandelte die Gegenstände des Zimmers in Schemen und Schatten, er konnte seine Hose am Boden erkennen, neben dem Hemd und den Socken. Wie war er ins Bett gekommen? Der Kopf schmerzte. Mühsam richtete Baltasar sich auf. Es half nichts, er musste aufstehen. Mit den Zehen fischte er nach der Hose, hob sie auf und legte sie übers Bett. Er tastete sich mit wackligen Schritten über den Holzboden, als befürchtete er, auf einer Eisschicht einzubrechen.
Die Morgenhygiene erledigte er wie in Trance, ein Schluck Orangensaft aus dem Kühlschrank, das Frühstück musste warten. Baltasar schloss die Haustüre hinter sich, hielt einen Moment inne und sog die Luft ein. Der Herbst meldete sich im Bayerischen Wald mit dem Geruch von frischem Laub und Moos. Baltasar mochte diesen Geruch, diese einzigartige Würze, die nur die Berge entlang der Grenze hervorbrachten.
Noch dazu diese Stille. Das Schweben zwischen Nacht und Tag, als hielte die Natur den Atem an. Ein Zustand, in dem die Welt noch zu schlafen schien. Keine leise Radiomusik hinter den Vorhängen der Nachbarn, kein Brummen von Automotoren, nicht einmal das sonst übliche Rattern der Melkmaschinen aus den Ställen war zu hören. Stattdessen eine Ruhe, die Baltasar wie ein Geschenk des Himmels erschien, selten und kostbar.
Er ging die paar Schritte hinüber zur Kirche. Der Altarraum lag im Halbdunkel, nur die Jesusfigur am Kreuz erstrahlte bereits im Morgenlicht und verlieh dem Ort etwas Mystisches. Baltasar bewunderte die Kunst der alten Baumeister, die Gebäude und Kirchenfenster so geschickt angeordnet hatten, um diesen dramatischen Effekt zu erzeugen, der auch nach Jahrhunderten seine Wirkung nicht verfehlte. Zumindest für diejenigen, die es tatsächlich in aller Herrgottsfrühe in die Kirche schafften.
Baltasar zündete die Kerzen an, überprüfte die Weihwasserkessel, legte die Gesangbücher aus. Er setzte sich in die erste Reihe und ließ die Altarszene auf sich wirken, das Kruzifix, den Tabernakel auf dem Altar, umfasst von Marmorsäulen und überkrönt von einem Gemälde, das Christi Himmelfahrt darstellte. Das Arrangement, seit Ewigkeiten bewährt, war eine Einladung an den Betrachter, sich Zeit zu nehmen und sich unvoreingenommen in die Szene zu versenken. Eine Meditation. Eine Übung im Sehen und Fühlen. Eine Prüfung im Glauben. Baltasar pflegte den Glauben auf seine ganz persönliche Weise auszulegen. Ebenso hatte er eine persönliche Auffassung von Genuss und Sünde und Vergebung. Gott hatte die Freuden des Daseins in die Welt gebracht. Wer sich diesen Freuden verschloss, verschloss sich der Gnade Gottes. Und die Sünde wurde einem am Ende vergeben. Meistens jedenfalls.
Dem Idealbild eines katholischen Pfarrers entsprach Baltasar gewiss nicht, das wusste er. Nicht bloß, weil er sich zu diesem Beruf erst spät entschieden hatte. Er hatte auch einen eigenen Kopf. Seine Vorstellung von Gerechtigkeit etwa besagte, dass Menschen darauf nicht bis zum Jüngsten Tag warten sollten. Vielmehr musste jemand im Zweifel nachhelfen – und wenn es Hochwürden höchstpersönlich war. Baltasar dachte daran, wie seine Neugierde ihn in der Vergangenheit schon mehrmals in brenzlige Situationen gebracht hatte.
Andere Schwächen, wie die Leidenschaft fürs Essen und Trinken, konnte man in diesem Amt gut verbergen. Bei Hochzeiten, Taufen und beim Leichenschmaus gebot es schon die Höflichkeit, eine Einladung ins Wirtshaus anzunehmen. Vor allem, wenn es sich um die Gaststätte einer gewissen Frau handelte ...
Das Knarren des Kirchenportals ließ ihn herumfahren. Eine Gestalt huschte herein, drückte sich an der Wand entlang. Baltasar rührte sich nicht. Hatte die Person ihn bemerkt? Die Meldung aus der Nachbarpfarrei von letzter Woche kam ihm in den Sinn, wo ein Unbekannter den Opferstock aufgebrochen hatte. Er duckte sich unter die Rückenlehne und schlich langsam zum Ende der Sitzbank. Die Statue der Heiligen Jungfrau Maria sah auf ihn herab, sie schien zu lächeln über sein Gehabe wie ein Indianer auf Kriegspfad. Baltasar spähte in den Gang, konnte im schwachen Kerzenschein aber nichts erkennen. Er hielt die Luft an. Nichts. Wo steckte der Eindringling?
Baltasar stahl sich zur nächsten Säule, wartete. Noch immer sah er niemanden. Der Opferstock am Eingang war unbeschädigt. Ein Geräusch, ein Kratzen, kam aus der letzten Reihe. Dann wieder Stille. Totenstille. Er versuchte, sich den hinteren Bänken von der Seite zu nähern. Der Dieb musste sich dort versteckt haben. Baltasar war nur noch drei Reihen entfernt. Er konzentrierte sich darauf, ihn gleich zu packen.
Da spürte er einen Luftzug von der Seite, von der Ecke des Beichtstuhls. Da hatte sich der Übeltäter also verborgen. Zu einem weiteren Gedanken kam er nicht. Bevor er sich auch nur halb dem Versteck zugewandt hatte, traf ihn ein Schlag am Oberarm und ließ ihn zurücktaumeln.
»Verbrecher!«
Eine schrille Stimme. Baltasar sah einen Stock auf seinen Kopf niedersausen, duckte sich weg und wurde an der Schulter getroffen. Ein Stromstoß schien durch seinen Körper zu schießen.
»Dass di traust, du Lump!«
Er fixierte den Angreifer. Eine zierliche Person, ganz in Schwarz gekleidet, mit einem schwarzen Kopftuch. Eine Frau. Leicht gebückt stand sie da und holte gerade zu einem neuen Schlag aus.
»Gibst jetzt auf?«
Baltasar schaffte es gerade noch, das Handgelenk der Frau zu fassen. Sie trat nach ihm und traf sein Schienbein. Er war überrascht, welche Kraft sie aufbrachte.
»Lass mi los, du Grattla!«
Er griff ihren anderen Arm und versuchte den Tritten auszuweichen. »Schluss jetzt, wir sind hier nicht im Wirtshaus!« Seine Stimme hallte in der Kirche nach.
Die Angreiferin ließ ihren Gehstock fallen, gab allen Widerstand auf. Er zog sie ans Licht. Unter dem Kopftuch lugte das tief gefurchte Gesicht einer alten Frau hervor.
»Mein Gott, Sie sind’s, Hochwürden.« Die Stimme der Alten hatte sich in ein Flüstern verwandelt. »Ich ... Ich hab Sie im Dunkeln gar ... gar nicht erkannt. Noch dazu in diesem Aufzug.« Sie schlug die Hände vors Gesicht. »Bei der Jungfrau Maria, das habe ich nicht gewollt. Gott ist mein Zeuge. Einen Priester schlagen. Noch dazu in der Kirche! Oh Gott, oh mein Gott!«
»Nun beruhigen Sie sich doch wieder, es ist ja nichts Schlimmes passiert.« Baltasar rieb sich seinen Oberarm. »Was haben Sie sich nur dabei gedacht?«
»Ich ... ich wollt ganz früh in die Kirch ... damit ich in Ruhe beten kann. Da hab ich eine verdächtige Gestalt gesehen, die sich versteckte ... also ... ich meine natürlich, ich ... ich wusste ja nicht, dass Sie es waren, Hochwürden.«
»Aber selbst wenn Sie mich nicht erkannt haben – auf Fremde prügelt man für gewöhnlich nicht mit dem Gehstock ein.«
»In der Zeitung hab ich von dem Einbruch in der andern Kirch gelesen. Da hab ich gedacht, der Bazi treibt sich jetzt bei uns rum und versucht’s schon wieder. Ich hab mich beim Beichtstuhl versteckt und gewartet, was der Dachara ... ich meine natürlich nicht Sie ... da treibt. Und weil er auf dem Weg zum Opferstock war, wollt ich ihn aufhalten. Zur Jungfrau Maria hab ich gebetet, wie ich da in der Eckn stand, gebetet hab ich, Jungfrau Maria, hilf, gib mir Kraft gegen den Deifi, bitte gib mir Kraft. Aber dass gerade Sie daherkommen ...«
»Nun, das ist meine Aufgabe als Pfarrer. Ich muss die Frühmesse vorbereiten. Sie sind herzlich dazu eingeladen.«
»Nun ja. Ich muss mal schau’n. Ich hoff, Sie sind mir nicht bös, Hochwürden, ich bitt Sie vielmals um Entschuldigung, es war a Sünd, ich weiß, a schlimme Sünd. Vergeben Sie mir?«
»Machen Sie sich keine Sorgen, Sie hatten keine bösen Absichten. Im Gegenteil – Sie wollten einen Dieb stellen. Das war mutig. Bleiben Sie ruhig hier und beten Sie. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich hab zu tun.«
Baltasar ging in die Sakristei und schloss den Schrank auf. Er kannte die Frau vom Sehen. Sie kam öfter allein in die Kirche, blieb häufig stundenlang auf der Bank sitzen, wobei unklar war, ob sie betete oder schlief. Sie musste weit über achtzig Jahre alt sein, ihr Name war Walburga Bichlmeier. Sie lebte allein außerhalb des Ortes und wenn sie sich mal sehen ließ, dann nur komplett in Schwarz gekleidet. Den Leuten war sie unheimlich, auch weil es hieß, sie sei nicht ganz richtig im Kopf. Klatsch und Tratsch eben. Genaues wusste keiner. Nur dass sie weder Freunde noch Verwandte hatte, darüber war man sich einig.
In der Kirche waren die ersten Besucher zu hören. Baltasar zog sein Hemd aus, sein Oberarm war geschwollen, an der Schulter hatte sich ein Bluterguss gebildet. Er streifte sich die Albe und Kasel, das Messgewand, über. Seine Laune war nach dem Vorfall gesunken. Auf was für Ideen die alte Frau kam! Zugegebenermaßen hatte ihn die Nachricht über den jüngsten Kirchendiebstahl auch ein wenig beunruhigt. Bisher hatte er die Kirchentüre immer offen gelassen und nie die Befürchtung gehabt, jemand könne sich an den paar Wertgegenständen seiner kleinen Pfarrei vergreifen. Was wollte jemand mit Gesangbüchern, vergoldeten Kerzenleuchtern oder Heiligenfiguren aus Holz?
Aus einer Kommode holte Baltasar die Zutaten für das Turibulum: sudanesischer Weihrauch, etwas Sandelholz und eine Kräutermischung, die er frisch aus dem Jemen bezogen hatte. Er zerstieß sie in einem Mörser und füllte sie in das Weihrauchfass. Er roch daran. Perfektes Aroma. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass es Zeit war für den Gottesdienst. Aber noch immer war der Ministrant nicht eingetroffen. Baltasar legte die Altarschellen bereit, sah wieder auf die Uhr. Er zündete die Kohletablette an und legte sie ins Turibulum. Der Duft seiner Spezialmixtur erfüllte den Raum. Wo blieb der Junge nur?
Gerade wollte sich Baltasar allein auf den Weg machen, als er den Buben hereinhuschen sah.
»Tschuldigung, Herr Pfarrer, ich bin spät dran.« Die Haare des Ministranten standen in alle Richtungen ab, das Hemd war falsch zugeknöpft, ein Schnürsenkel streifte am Boden. »Ich hab noch was erledigen müssen, was Dringendes.«
»Ich glaube eher, du bist nicht rechtzeitig aus dem Bett gekommen. Zieh dich um, Sebastian, aber schnell! Was war denn so dringend?«
»Ich wollt Sie was fragen, wenn ich darf, Herr Pfarrer.« Der Junge legte seinen Rucksack auf den Tisch.
»Nur zu.«
»Nun, nur mal angenommen, also rein theoretisch: Ist es erlaubt, etwas zu behalten, was einem nicht gehört?«
»Wenn es einem nicht gehört, muss man es selbstverständlich dem Eigentümer zurückgeben.«
»Aber wenn es keinen Eigentümer gibt, wenn man etwas findet, oder so.«
»Dann sollte man es im Fundbüro abgeben. Der, der es verloren hat, vermisst es sicher.«
Der Junge schlüpfte in sein Messgewand. Er schien zu überlegen, ob er fortfahren sollte. »Aber wenn man etwas findet, wo man sicher ist, dass es niemandem gehört? Was ist dann?«
Baltasar runzelte die Stirn. »Hast du etwas gefunden, Sebastian? Etwas Wertvolles?«
»Sie verraten aber nichts meinen Eltern, versprochen? Die werden immer so schnell grantig.«
»Ich müsste erst wissen, um was es überhaupt geht.«
»Ich hab’s dabei.« Der Bub öffnete seinen Rucksack und holte einen verdreckten Lappen heraus. Behutsam deponierte er ihn auf dem Tisch, als hantiere er mit Nitroglyzerin. »Aber niemandem etwas davon erzählen, ich bitt Sie.« Er entfaltete den Stoff, eine Kette kam zum Vorschein. Baltasar nahm sie in die Hand. Es war eine silberne Kette mit Gliedern aus Halbedelsteinen. Erde klebte an mehreren Stellen, als Anhänger dienten Reste eines Kreuzes aus Horn. »Das ist ein Rosenkranz. Wo hast du ihn gefunden?«
»Gleich bei uns am Weg. In der Erde. Gehört der nun mir? Ist er was wert?«
»Das weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall sehr alt aus. Wo genau hast du ihn gefunden, sagst du?«
»Im Acker. War Zufall. Darf ich den Rosenkranz nun behalten oder nicht? Den vermisst niemand mehr.«
»Wieso bist du dir so sicher? Zumindest sieht er so aus, als sei er schon länger in der Erde gelegen, das stimmt.«
»Genau, der ist uralt, der geht keinem mehr ab. Dann ist er doch meiner, schon allein wegen der Verjährung und so.«
»Das klären wir später. Jetzt geht’s zur Messe, mach schon, nimm den Weihrauchbehälter.«
»Der Rosenkranz ist nicht das Einzige, was ich gefunden hab.« Der Junge zog ein Zeitungspapier hervor, in dem etwas eingewickelt war. »Sieht komisch aus. Wollen’s sich anschauen?«
Baltasar wickelte den Gegenstand aus. Vor Schreck ließ er ihn auf den Tisch fallen und betrachtete ihn dann näher. Ein Knochenstück. Die Form, die Zähne – kein Zweifel.
Es war der Unterkiefer eines Menschen.
Kapitel 2
Er hatte nun schon das zweite Mal seinen Einsatz verpasst. Es war die Stelle, wo er sich eigentlich aufrichten und die Arme heben müsste. Stattdessen starrte Baltasar auf die Hostie, als erwarte er von dort die Ankunft des Jüngsten Gerichts. Sie war weiß wie der Menschenknochen, den der Junge gebracht hatte. Was hatte der makabre Fund zu bedeuten? Es war keine Gelegenheit mehr gewesen, Sebastian zur Rede zu stellen, die Messe hätte längst beginnen sollen. Der menschliche Unterkiefer lag noch auf dem Tisch in der Sakristei, Baltasar hatte in der Eile nicht gewusst, wohin damit. Wo war der dazugehörige Schädel, wo das Skelett? Baltasar schüttelte sich. Er blickte vom Altar auf und sah in die Kirche.
Der Raum war nur zur Hälfte gefüllt. Die Besucher drängten sich in den vorderen Bänken, ihre Gesichter spiegelten Ratlosigkeit, einige unterdrückten ein Gähnen oder vertieften sich in ihr Gesangbuch. Nun denn – er hatte einen Job zu erledigen. Doch Baltasar konnte sich nicht darauf konzentrieren, weil ihm das Bild des Knochens ständig vor Augen stand. Er nahm die Schale mit der Hostie und hob sie hoch.
»Er hat sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes.
Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan.«
Die Hostie hielt er in beiden Händen. Er machte eine Kniebeuge und stellte die Schale auf das Korporale, während alle Augen auf ihm ruhten. Immer noch funktionierte dieses uralte Ritual, ein Zauber, der die Zuschauer jedes Mal aufs Neue in seinen Bann zog, obwohl jeder den Ablauf kannte. Eigentlich war es nur eine Oblate, ähnlich der, die Hausfrauen in der Küche verwendeten. Durch die kirchliche Weihe jedoch verwandelte sie sich in ein Symbol für das Leben und das Sterben – und die Wiederauferstehung. Das Sakrament des Abendmahls. Baltasar brach die Hostie in der Mitte auseinander und hielt inne. Er legte sich die Oblate auf die Zunge, schloss den Mund. Auch wenn die Katholiken glaubten, dass sich das Brot in diesem Moment in den Leib Christi verwandelte, fühlte Baltasar sich jedes Mal – der Herr möge ihm verzeihen – ans Plätzchenbacken seiner Mutter zu Weihnachten erinnert, an den Geruch von Rumaroma und gemahlenen Haselnüssen, an den Geschmack des Teiges, nachdem er heimlich seinen Finger in die Schüssel getaucht hatte.
»Nehmt und esst alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.«
Zu welchem Leib mochte der Knochen gehören? Stammte er aus einem Grab? Baltasar nahm sich vor, der Sache auf den Grund zu gehen. Der Fund ließ ihm keine Ruhe. Er drehte sich zu Sebastian, der neben ihm mit dem Weihrauchkessel stand. Ihre Blicke trafen sich. Der Bub schien zu erschrecken, er schwenkte das Turibulum, eine Verlegenheitsgeste, und der Rauch verteilte sich. Baltasar sog die Luft ein. Wunderbar! Diese Würze. Weihrauch zu inhalieren begeisterte ihn immer wieder aufs Neue, vor allem, wenn er ihn mit besonderen Zutaten aufgepeppt hatte. Es half nichts, die Pflicht rief. Baltasar straffte sich und füllte Wein in den Kelch.
»Gedenke aller, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen,
nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf.«
Er nahm einen Schluck und rollte ihn unauffällig im Mund. Den Wein hatte er sich aus einem Kloster im Badischen kommen lassen, ein Trollinger. Ein Hauch von Kardamom, eine Ahnung von Zimt und Beeren. Ausgewogenes Bouquet. Baltasar musste sich beherrschen, nicht noch einen zweiten Schluck zu probieren. Er forderte die Kirchenbesucher auf, nach vorne zu kommen.
»Nehmt und trinkt alle daraus:
Das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden.«
Der Bürgermeister und seine Frau knieten vor ihm nieder. Für einen Moment genoss Baltasar diese Demutshaltung der Lokalprominenz, gerade bei Personen wie Xaver Wohlrab, die in dienstlichen Dingen oft sehr herrisch auftraten. Das Amt des Pfarrers zählte eben noch etwas im Bayerischen Wald. Die Leute erwiesen ihm Respekt und demonstrierten dabei gerne, dass sie gute Christen waren, genauer gesagt, gute Katholiken, eine andere Religion zählte nicht in diesem Landstrich. Was bigottes Verhalten nicht ausschloss, im Gegenteil. Er erinnerte sich an die Aufzeichnungen des königlich-bayrischen Beamten Joseph von Hazzi aus dem 19. Jahrhundert, wohl die erste zusammenfassende Dokumentation über die Gegend: »Den Rosenkranz, das Amulett, das Weihwasser und anderes verehrt man als Heiligtümer, überall stößt man auf Bilder, Figuren und andere Zeichen von Religionsschwärmerei. Die Menschen zeichnen sich durch Hartnäckigkeit, Bigotterie, Aberglaube und den Glauben an Hexereien aus«, notierte damals der Mann aus München und brachte zugleich seine Verwunderung über manch andere Sitten zu Papier: »Treue in der Liebe und Vaterpflicht scheint dem unverheirateten Volk ganz gleichgültig, denn häufig leugnen sie Vaterschaft und entziehen sich der Alimentationsbürde, sie überlassen sich dem Genuss der Liebe ohne Rückhalt und – leider oft gar zu früh. Streit endet in Beleidigungen und ist oft mit mörderischen Raufereien verbunden.«
Wie zivilisiert die Menschen doch heute sind, dachte Baltasar. Sie schlagen nur noch zu besonderen Anlässen zu, beispielsweise mit dem Bierkrug auf Volksfesten, wobei es sich von selbst verstand, dass man den Krug vorher ausgetrunken hatte – es wäre zu schade um das kostbare Bier.
Die Leute standen an, um Hostie und Wein zu empfangen. Die Frau des Metzgers hatte offenbar ihre Haare neu gefärbt, ein Bronzeton, der unnatürlich schimmerte. Ständig zupfte sie an ihren Strähnen, als sei sie mit der Frisur nicht zufrieden. Ein Mann aus dem Altenheim schob seine Lippen vor wie ein Karpfen bei der Fütterung, als Baltasar ihm die Oblate in den Mund schob, und kaute auf ihr herum, als wäre sie das erste Frühstück. Baltasar musterte die Bänke. Wo steckte eigentlich Walburga Bichlmeier? Einige Besucher waren sitzen geblieben, aber die schlagkräftige Rentnerin war nirgends zu sehen, auch nicht in den Seitengängen.
Der Rest der Messe verlief ohne Zwischenfälle, wenn auch zäh. Baltasar beschlich das Gefühl, in Honig zu waten. Die Minuten schienen sich zu dehnen, und beim Singen der Lieder ertappte er sich dabei, schon an das Ende zu denken. Selten hatte er sich den Abschluss so sehr herbeigewünscht, den Segen und das Kreuzzeichen vollzog er in Rekordzeit. Die Besucher strömten aus der Kirche, und Baltasar atmete auf. Er war schon auf dem Weg in die Sakristei, als ihn eine Stimme aufhielt.
»Hochwürden, haben Sie einen Moment Zeit?« Xaver Wohlrab stand im Seitengang.
»Herr Bürgermeister, schön Sie zu sehen. Was gibt’s denn? Wollen Sie etwa beichten?«
»Danke, nein, so dringend ist es im Augenblick nicht.«
»Und ich dachte, Politiker sind niemals ohne Sünden.« Baltasar lächelte Wohlrab an, der sich daraufhin verlegen räusperte.
»Ich wollte ein Projekt mit Ihnen besprechen. Etwas Geschäftliches, zum Wohle der Gemeinde. Das wird auch in Ihrem Interesse sein.«
»Meine Arbeit zielt vor allem auf das Seelenheil meiner Schäfchen.«
»Ich habe Sie in der Vergangenheit als einen Menschen kennen gelernt, der sich durchaus auch für weltliche Dinge interessiert. Wenn es den Menschen hier besser geht, kommt das auch Ihrer Kirchengemeinde zugute. Wir sitzen im gleichen Boot.«
»Also gut, raus mit der Sprache.«
»Sie erinnern sich doch noch an meinen Versuch, eine Futtermittelfabrik bei uns anzusiedeln?«
»Sie meinen die Firma, die in Norddeutschland mehrere Gerichtsverfahren wegen Verstoßes gegen die Umweltauflagen am Hals hat? Wie könnte ich das vergessen!«
»Das sind nur bösartige Verleumdungen, von neidischen Konkurrenten gestreut. Es ist alles eine Frage des Investitionsklimas. Und wir im Bayerischen Wald sind in dieser Hinsicht großzügiger als nördliche Bundesländer. Sie wissen selbst, wie dringend wir hier Arbeitsplätze brauchen.«
»Da gebe ich Ihnen recht. Arbeitsplätze schon – aber zu welchem Preis?«
Wohlrab hob die Arme. »Wir müssen das jetzt nicht zu Ende diskutieren. Das Thema hat sich sowieso erledigt, das Unternehmen hat sein Angebot zurückgezogen.«
»Schade drum – wo die Firma doch ein Grundstück erwerben wollte, das Ihnen persönlich gehört.«
»Na, na, daran ist nichts Verwerfliches. Aber das hat sich wie gesagt erledigt. Doch ich habe jetzt eine neue Chance aufgetan. Ein Investor will bei uns ein Sporthotel bauen, mit Spitzenrestaurant, Golfplatz, Wellness und so weiter. Eine einmalige Gelegenheit für den Ort.«
»Und welche Rolle haben Sie mir dabei zugedacht? Soll ich künftig Golfkurse geben?«
»Humor haben Sie, das muss man Ihnen lassen.« Der Bürgermeister sah verdrießlich drein. »Ich bitte Sie um Unterstützung für das Projekt. Sie haben Einfluss auf Ihre Gemeinde, wenn Sie ab und zu ein gutes Wort einlegen ...«
»Ich kenne den Investor und das Bauvorhaben noch gar nicht. Aber gut, wenn’s der Allgemeinheit hilft, will ich gern meinen Beitrag dazu leisten.«
»Das ist gut, sehr gut.« Wohlrab schien erleichtert. »Ich muss jetzt weiter, meine Frau wartet. Schönen Tag noch.«
Baltasar verabschiedete sich. Er ging in die Sakristei. Seltsam. Der Raum war leer. »Sebastian?« Er ging zum Kirchenvorplatz, von dem Ministranten keine Spur. Warum hatte der Junge nicht gewartet? Da kam Baltasar der Menschenknochen in den Sinn, den er auf dem Tisch zurückgelassen hatte – oder irrte er sich? Er hob das Zeitungspapier hoch, sah unter dem Tisch nach, vergebens. Vielleicht hatte der Bub das Fundstück in der Anrichte deponiert. Baltasar riss die Schubladen auf, untersuchte die Regale, nahm sich sogar den Kleiderschrank vor. Nichts.
Auf dem Stuhl lag ein Stoffknäuel, Baltasar entfaltete es. Der Ministrantenüberwurf. Rosenkranz und Rucksack hatten sich in Luft aufgelöst. Genauso wie Sebastian.
Kapitel 3
Baltasar zog sich im Pfarrheim um und rief Sebastians Mutter an, um sich nach dem Verbleib des Jungen zu erkundigen. Zu Hause war er noch nicht angekommen. Baltasar gab vor, nur einen neuen Termin für den nächsten Messdienst ausmachen zu wollen, und verabschiedete sich rasch. Teresa, seine polnische Haushälterin, streckte den Kopf zur Tür herein. »Soll ich Ihnen ein belegtes Brot machen? Habe frischen Wacholderschinken vom Metzger.«
»Danke, ich bedien mich selber. Ist noch Kaffee da? Ich bin noch nicht so richtig wach.«
»In Isolierkanne am Tisch.« Teresa sprach eigentlich sehr gut Deutsch, ein Ergebnis des Unterrichts in ihrer früheren Heimat Krakau. Ihr voller Name war Teresa Kaminski, sie hatte nach der Scheidung von ihrem Mann einen Job gesucht und war durch Vermittlung der Passauer Diözese in der Gemeinde gelandet. »Was Sie wollen heute Abend zum Essen?«
»Keine Ahnung. Ein paar Semmeln oder ein Salat würden reichen, ich muss noch mal weg und weiß nicht, wann ich zurückkomme.«
»Dann werde ich was zaubern. Lassen Sie sich überraschen. Mach eine Kleinigkeit, ist kein Aufwand.«
Baltasars Misstrauen gegenüber den schwach ausgeprägten Kochkünsten seiner Haushaltshilfe erwachte. »Machen Sie sich keine Mühe, ich kann mir auch unterwegs was besorgen.«
»Gar kein Thema. Ich koche gern. Ist doch mein Job. Bin dafür da, mich um Sie und das Haus zu kümmern.«
»Also gut, ich bin gespannt, was Sie auftischen.« Baltasar schenkte sich eine Tasse Kaffee ein. Er brauchte einen klaren Kopf, um zu überlegen, was er als Nächstes tun sollte. Das Verschwinden seines Ministranten bereitete ihm mehr Sorgen, als er sich eingestehen mochte. Es war nicht Sebastians Art, einfach so abzuhauen.
Der Junge stammte aus einem Bauernhof etwas außerhalb des Ortes, die Familie bewirtschaftete ihre Felder seit Generationen. Der Vater war auf eine unbeholfene Weise freundlich, wenn er dem Pfarrer begegnete. Er galt jedoch als jähzornig. Seine Frau musste letztes Jahr im Krankenhaus behandelt werden, Prellungen, Blutergüsse und blaue Flecken. Sie sei von der Treppe gestürzt, hatte sie erklärt, ein Versehen, eine Unaufmerksamkeit ihrerseits.
Vielleicht gab es für Sebastians überstürzten Aufbruch eine harmlose Erklärung. Nicht auszudenken, wenn etwas Schlimmes passiert wäre. War ein Fremder während des Gottesdienstes in die Sakristei eingedrungen? Bleib auf dem Teppich, dachte Baltasar, deine Fantasie geht mit dir durch. Der Junge war zu Fuß gekommen. Er konnte also nicht weit sein. Es sei denn ... Baltasar beschloss, nach Sebastian zu suchen.
Zuerst fuhr er die Strecke zum Grundstück der Familie ab. Aber niemand begegnete ihm. Er drehte um und bog in einen Feldweg ab, der in den Forst führte. Am Waldrand hielt er an. »Sebastian!«, rief er, »hallo, Sebastian!« Die Worte verloren sich zwischen den Bäumen. Ein Spaziergänger kam vorbei. Baltasar fragte ihn, ob er einen Jungen gesehen hatte. Fehlanzeige. Er fuhr wieder zurück zum Ort, versuchte es auf der entgegengesetzten Seite, probierte die anderen Nebenstraßen. Leute grüßten ihn, manche schienen sich zu wundern, wohin der Pfarrer um diese Zeit mit dem Fahrrad wollte und warum er immer wieder neue Wege nahm, ohne erkennbares Ziel.
Er kümmerte sich nicht darum. Nervosität kroch in ihm hoch. Hielt Sebastian sich irgendwo versteckt? War dem Jungen doch etwas zugestoßen? Baltasar kehrte zurück ins Pfarrheim, rief nochmals bei Sebastians Mutter an, sah sogar in der Kirche und in der Sakristei nach – vergebens. Er lief in der Küche auf und ab, trank eine Tasse Kaffee, lief wieder herum und sah unentwegt auf die Uhr. Seit fast drei Stunden war der Junge nun verschwunden.
Da fiel Baltasars Blick auf die Liste mit den Ministranten-Adressen: Jonas. Warum hatte er nicht gleich daran gedacht, Jonas war Sebastians bester Freund, die beiden gingen in dieselbe Klasse. Er rief die angegebene Telefonnummer an. Eine Männerstimme meldete sich.
»Hallo.«
»Guten Tag, hier spricht Pfarrer Senner, Baltasar Senner, entschuldigen Sie die Störung am Sonntag.«
»Macht doch nichts, Hochwürden.« Der Tonfall drückte das Gegenteil aus. »Was wollen’s denn?«
»Ich würde gern den Jonas sprechen wegen des Ministrantendienstes.«
»Warum? Hat sich der Saubua schlecht benommen?«
»Nein, nein, keine Sorge, alles in Ordnung. Ich sitze nur gerade an der Planung für die nächsten Termine und wollte klären, wann es dem Jungen passt.« Innerlich bat Baltasar den lieben Gott um Verzeihung für die Notlüge.
»Der Bua hat da gar nichts zum Reden, er soll antanzen, wann Sie es ihm sagen, damit basta!«
»Dazu müsste ich ihn eben kurz sprechen, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ihn ans Telefon zu holen.«
»Würd ich ja. Aber der Bua hat sich gleich nach dem Frühstück verdrückt, statt für die Schule zu lernen. Vermutlich steckt er in diesem Freizeittreff, bei seinen Freunden. Nichts als dumme Gedanken hat der Jonas grad im Schädel, sag ich Ihnen, und keine Zeit für Hausaufgaben.«
Mit einer weiteren Ausrede beendete Baltasar das Gespräch. Er wusste nun, wo er zu suchen hatte, und schwang sich aufs Rad. Sein Ziel war ein ehemaliger Lagerraum im Hinterhof der Metzgerei, der als provisorischer Treffpunkt für die Jugendlichen des Ortes eingerichtet worden war.
Baltasar musste sich erst an das Halbdunkel gewöhnen. Mitten im Raum stand ein Kicker, an der Wand zwei durchgesessene Sofas. Aus einer Stereoanlage dröhnte ein Lied der Rockgruppe Rammstein. Auf der anderen Seite stand ein Tisch mit zwei Computern, ein Gerät war eingeschaltet, davor saß ein Junge mit Kopfhörern.
»Jonas?«
Der Junge reagierte nicht. Baltasar drehte die Anlage leiser und schüttelte ihn an der Schulter. Jonas drehte sich um und nahm seine Kopfhörer ab. Auf dem Monitor war zu sehen, dass er gerade irgendwelche Soldaten mit Maschinenpistolen steuerte, die in Häuserruinen auf ihre Gegner lauerten.
»Sie sind’s, Herr Pfarrer. Was tun Sie denn hier? Wollen’s mitmachen? Ein Platz ist noch frei.« Er grinste und deutete auf den Computer neben sich.
»Nein, danke. Dein Vater hat mir gesagt, dass ich dich hier finde. Ich habe ein Problem, bei dem du mir helfen kannst.«
»Brauchen’s einen Ersatz als Ministranten? Kann ich machen, kein Problem, geht klar.«
»Ich bin auf der Suche nach Sebastian. Der ist heute nach der Messe einfach verschwunden. Vielleicht hast du eine Idee, wo er stecken könnte, ich mache mir Sorgen.«
»Da brauchen’s sich keinen Kopf zu zerbrechen, der Sebastian wird schon wieder auftauchen, so wie ich ihn kenn.«
»Wo könnte er denn sein? Ich hab schon den ganzen Ort nach ihm abgesucht.«
»Weiß nicht. Vielleicht auf dem Fußballplatz?«
»Da war ich schon.«
»Probieren Sie’s doch noch mal bei ihm daheim.« Jonas blinzelte. »Der liegt bestimmt wieder im Bett und pennt.«
»Hab erst vor Kurzem dort angerufen.«
»Das ist schon wieder ein Zeitlang her, denk ich. Schaun’s doch direkt dort vorbei. Sie wissen ja, wo er wohnt.«
Baltasar vernahm ein Surren in gleichmäßiger Tonlage, das nicht zu der Musik im Hintergrund passte. Es schien vom Lüfter des Computers direkt vor ihm herzurühren. Da kam ihm ein Gedanke. Er setzte sich auf den freien Platz. »Ich glaube, ich habe doch Lust, eine Runde zu spielen. Ist doch was anderes, als nur Weihrauchkessel zu schwenken, oder?« Er zwinkerte Jonas zu. Der blickte entgeistert. »Also, wie geht das?« Baltasar bewegte den Joystick. Sofort leuchtete der Bildschirm auf und zeigte dieselbe Spielszene, die auch auf dem anderen Computer zu sehen war: Soldaten in einer Ruinenlandschaft. Sein Verdacht hatte sich bestätigt, das Gerät war die ganze Zeit angeschaltet gewesen. »Wie ich sehe, läuft das Spiel im Multiplayer-Modus. Wir beide sind also ein Team, oder?« Wieder zwinkerte Baltasar zu Jonas hinüber. »Nun, was ist? Wo sind unsere Feinde? Wir sind doch die Guten, oder?« Baltasar steuerte seine Kunstfigur auf dem Monitor und feuerte ein paar Mal in eine Mauer. Ziegelbrocken flogen herum. »Geht doch.«
Noch immer schaute ihn der Junge an, als sei ihm gerade der Heilige Geist erschienen. Er setzte an zu reden, brachte aber kein Wort heraus.
»Wir als Team müssen zusammenarbeiten. Ich bin nicht dein Feind, Jonas.« Baltasar sah ihm direkt in die Augen. »Also, wo steckt der Sebastian?« Er wusste die Antwort längst.
»Ich kann nicht«, brach es aus Jonas heraus.
»Willst du mir nicht helfen?«
»Ich kann keinen Freund verraten, das kann ich nicht.« Er kaute auf den Worten wie auf einem Kanten Schwarzbrot.
»Das verstehe ich, einen Freund verrät man nicht.« Baltasar stand auf, ging zur Toilettentür und klopfte.
»Sebastian, bitte komm raus.«
Es dauerte eine Weile, bis sich die Tür öffnete. Vor ihm stand ein zitterndes Bündel Mensch. Sebastian.
Kapitel 4
Sebastian saß am Tisch der Sakristei und nestelte am Reißverschluss seiner Jacke.
»Ich bin froh, dass es dir gut geht«, sagte Baltasar. »Du kannst dir nicht vorstellen, wo ich überall nach dir gesucht habe.«
»Was haben’s denn bloß, Herr Pfarrer? Ich hab mich nur mit meinem Freund zum Spielen getroffen. Das ist doch nicht verboten, oder?« Trotz lag in der Stimme.
»Niemand will dir was verbieten, ich schon gleich gar nicht. Ich hab mir nur Sorgen gemacht, sonst nichts. Mein Fehler.«
»Gut, kann ich jetzt gehen? Meine Eltern erwarten mich sicher schon.«
»Den Eindruck hatte ich nicht, als ich mit deinem Vater telefoniert habe.«
Sebastian blickte ihn erstmals an, seitdem sie zurückgekommen waren. »Sie haben mit meinem Vater gesprochen?«
»Ich musste mich doch vergewissern, ob du zu Hause warst. Keine Sorge, ich hab nichts verraten.«
»Kann ich jetzt gehen?«
»Wir müssen nochmals über deinen Fund reden.«
»Aber Sie haben doch gesagt, ich darf’s behalten. Schließlich hab ich’s gefunden, ich allein. Sie wollen’s mir wieder abnehmen, ich hab’s gleich gewusst.«
»Sméagol hat seinen Schatz verloren, Sméagol will seinen Schatz zurück«, imitierte Baltasar die Stimme von Gollum aus dem Film Der Herr der Ringe. »Sei nicht albern, niemand will dir was wegnehmen.«
»Doch, wollen Sie!«
»Finderlohn gibt’s auf jeden Fall. Aber ist dir bewusst, was das für ein Knochen ist?«
»Na, der Kiefer von einem Tier, einem Reh oder einem Fuchs oder so was.«
»Da täuschst du dich gewaltig. Das ist der Unterkiefer eines Menschen.« Baltasar holte den Knochen aus dem Rucksack, verfolgt von den Blicken des Jungen. »Guck genau hin, lass dich nicht von den Erdklumpen irritieren.«
Sebastian starrte auf das Kieferfragment. »Ich seh nix.«
Baltasar deutete auf einen Zahn. »Hast du schon mal ein Reh gesehen, das eine Plombe trägt?«
Der Junge hielt das Fundstück hoch. »Leck mich, Sie haben recht, eine vergammelte Zahnplombe, verreck!«
Eine Zeitlang sagten beide nichts, sondern betrachteten nur das Knochenstück, als sei es die Reliquie eines Heiligen.
»Und was machen wir jetzt, Herr Pfarrer?«
»Ich möchte dich darum bitten, dass du mir die Sachen leihst, auch den Rosenkranz, damit ich sie untersuchen lassen kann. Dir ist sicher klar, dass du den Teil eines Menschen nicht behalten kannst.«
»Aber das Sweatshirt meines Bruders habe ich auch behalten«, protestierte Sebastian, »also wollen Sie mir doch was wegnehmen.«
»Ein Menschenknochen ist etwas anderes. Davor muss man Respekt haben. Der gehört wieder beerdigt.«
»Aber die Ärzte haben doch auch Skelette bei sich rumstehen, das hab ich im Fernsehen gesehen. Warum ich nicht?«
»Weil die Verstorbenen vor ihrem Tod in ihr Testament geschrieben haben, was mit ihrem Körper und ihren Knochen geschehen soll.«
»Und wozu brauchen Sie den Rosenkranz? Der besteht doch nicht aus Knochen.«
»Er kann vielleicht helfen festzustellen, zu wem das Kieferstück gehört. Wo hast du denn alles gefunden?«
»Bei uns draußen im Feld.«
»Es wäre schön, wenn du etwas präziser sein könntest. Wo genau war der Fundort?«
»Ich hab’s doch schon gesagt, im Feld.«
Baltasar seufzte. »Okay, okay, ich seh schon, so kommen wir nicht weiter. Ich schlage vor, nach dem nächsten Gottesdienst zeigst du mir die Stelle.« Er blickte auf die Uhr und reichte dem Jungen den Ministrantenumhang. »Wir müssen uns vorbereiten, es geht bald los. Und nicht wieder davonlaufen.«
Baltasar konnte es gar nicht erwarten, bis die Messe zu Ende ging. Aber je mehr er sich den erlösenden Schlusssegen herbeisehnte, desto länger schien sich die Andacht zu ziehen. In solchen Momenten verwünschte er den starren Ablauf der Liturgie. Wie gern hätte er das Ganze im Stile eines Improvisationstheaters abgekürzt... Warum nicht einfach das »Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade« nach dem ersten Satz abschneiden? Oder ein paar Lieder auslassen? Baltasar malte sich die Gesichter der Besucher aus, wenn er solche Programmänderungen vornehmen würde. Wo doch alle Gläubigen dieses Landstriches treu der katholischen Kirche folgten und Experimente angeblich verabscheuten. Doch er wusste, in Wirklichkeit war das Leben viel komplizierter. Gerade das geistliche Leben. Menschen konnten in einem Moment ewige Treue schwören und im nächsten Moment den Partner betrügen. Sie sagten am Sonntag die Zehn Gebote auf und verstießen am Montag gegen mehrere. Baltasar konnte und wollte niemanden dafür verdammen, Menschen waren eben so, manchmal auch schwach und fehlbar, und die Sünden wurden einem sowieso vom lieben Gott vergeben – vorausgesetzt, man beichtete und bereute. Das war ein überaus praktisches Arrangement der katholischen Kirche, das den Sünder genauso zufrieden stellte wie den Heiligen. Weswegen gerade im Bayerischen Wald ein gewisser Hang zu Frömmelei und Bigotterie festzustellen war – und zu Toleranz.
Sebastian erledigte seine Aufgabe als Ministrant ohne erkennbare Gefühlsregungen. Baltasar schob ihn nach Ende der Messe zum Ausgang, bis er die Kirchgänger verabschiedet hatte. »Hol deinen Rucksack, wir marschieren los.« Er winkte dem Jungen zu. »Das Knochenstück und den Rosenkranz lass bitte auf dem Tisch.«
Sie gingen wortlos nebeneinander her, bis sie den Ort hinter sich gelassen hatten. »Wohin jetzt?«
Der Junge deutete auf einen Feldweg, der links von der Hauptstraße abzweigte. »Der macht einen Bogen und trifft später auf die Straße, die zu uns nach Hause führt. Da entlang müssen wir.«
Nach gut einem Kilometer erreichten sie offenes Land, vereinzelte Bäume, Wiesen und Felder beherrschten das Bild. »Da vorn ist es.« Von fern sah es aus wie eine Gruppe von Stelen, beim Näherkommen löste sich das Bild auf in ein Kreuz mit Jesusfigur und zwei Holzplanken, die aussahen wie senkrecht gestellte, mannshohe Bügelbretter.
Die Gruppe stand am Wegesrand, an der Kreuzung zweier Feldwege. Die Ackerfurchen bogen rechtwinklig ab, ein Muster in Schwarz, wie mit einem überdimensionalen Rechen gezogen. Auf dem Boden unter dem Kreuz duckten sich eine Vase mit frischen Blumen und eine Friedhofskerze, die bereits erloschen war. Die Planken waren Totenbretter, Mahnmale und Erinnerung an die Verstorbenen, eine Besonderheit des Bayerischen Waldes, früher häufig, heute kaum mehr anzutreffen. Das obere Ende der Bretter lief spitz zu und wurde von einem Holzdach begrenzt. Auf dem einen Mal stand unter einem eingeritzten Kreuz:
»Andenken des ehrgeachteten
HERRN LUDWIG AUER
geb. am 17.3.1897, gest. am 5.11.1969
Wenn Liebe könnte Wunder tun
und Tränen Tote wecken,
Dann würde dich, o teures Herz,
nicht die kalte Erde decken.
R.I.P.«
Die vertieften Buchstaben hatte ein Unbekannter mit schwarzer Farbe nachgezogen. Dennoch war ein Teil der Schrift bereits verblasst, die Ränder des Brettes faulten. Das zweite Totenbrett war in einem noch schlechteren Zustand. Wind und Wetter hatten die Farben ausgelöscht. Baltasar betrachtete die Gedenktafel von mehreren Seiten, um die eingekerbte Inschrift entziffern zu können.
»Gedenktafel der achtbaren
FRAU O. REISNER
Bäuerin zu ...
gest. am 1. März 1979 im ... Lebensjahre
Weinet nicht Ihr Lieben mein,
Daß ich Euch so schnell verließ.
Denn in des Himmels Höhn
Ist ja unser Paradies.«
Er wandte sich an Sebastian. »An dieser Stelle hast du die Sachen gefunden? Wo denn genau?«
»Na, hier halt.« Der Junge fühlte sich sichtlich unwohl.
»Unter dem Marterl, unter den Totenbrettern? Lass dir bitte nicht jede Antwort aus der Nase ziehen.«
»Direkt neben den Tafeln.« Sebastian deutete auf eine Stelle seitlich davon. »Ich bin diesen Weg von zu Hause aus gegangen. Am Vortag hat’s ziemlich geregnet. Als ich hier vorbeikam, leuchtete was aus dem Acker. Ich schaute genauer hin und dachte zuerst, jemand hat etwas weggeworfen, ein Bonbon oder Plastikspielzeug. Das hat mich neugierig gemacht, ich bin näher hingegangen und hab das Teil aus der Erde gezogen. So hab ich die Kette entdeckt.«
»Und das Kieferfragment?«
»Ich dacht, vielleicht find ich noch was, wenn da eine Kette rumliegt, dann könnten da noch andere Sachen sein. Drum hab ich ein bisserl rumgebuddelt, hab tiefer gegraben, und dabei bin ich auf den Knochen gestoßen. Ich hab mir gedacht, den nehm ich mit, wer weiß, vielleicht kann ich ihn noch brauchen. Ich wusst doch nicht, dass das ein Menschenknochen ist, wusst ich nicht, wirklich, Sie müssen mir das glauben, Herr Pfarrer. Später hab ich noch ein wenig weitergegraben, mit den Händen, ich hatte ja kein Werkzeug, aber da war nix mehr.«
Baltasar hielt die Erklärung des Jungen für plausibel. Die starken Regenfälle der vergangenen Tage hatten wohl die Erde weggespült und den Rosenkranz freigelegt. Vermutlich gehörte der Kieferrest zu dem Menschen, der bei den Totenbrettern beerdigt worden war. Es war das Beste, den Knochen an dieser Stelle zu bestatten und die Totenruhe wiederherzustellen. Doch welche der beiden Tafeln war der richtige Ort für die Bestattung?
Kapitel 5
Baltasar betrachtete das Knochenfragment gegen das Licht. Es war ein seltsames Gefühl, Überreste eines Toten in der Hand zu halten, berührend und ein wenig gruselig. Er hatte nie verstehen können, wie Bestatter oder Totengräber die Abgebrühtheit aufbrachten, mit den sterblichen Hüllen umzugehen, als wären sie Müllsäcke. Wer mochte dieser Mensch gewesen sein? Wie hatte er gelebt, wie war er gestorben? Ein Teil eines Unterkiefers als Symbol einer vergangenen Existenz. Baltasar war sich unsicher, wie er weiter vorgehen sollte. Am einfachsten wäre es, den Knochen bei den Totenbrettern zu bestatten. Aber irgendetwas in ihm sträubte sich dagegen, die Sache auf diese Weise zu erledigen. Schließlich stand ein Schicksal dahinter, der Verstorbene hatte ein Anrecht auf würdevolle Behandlung. Deshalb war es naheliegend zu versuchen, den Toten zu identifizieren, um ihn der richtigen Gedenktafel zuordnen zu können und ihm einen Namen zu geben.
Ein Hausarzt konnte wohl nicht weiterhelfen, deshalb entschloss sich Baltasar, den Fund ins Krankenhaus in Freyung zu bringen. Er telefonierte mit der Zentrale, und es dauerte, bis ihm ein Sachbearbeiter riet, einfach vorbeizukommen und auf eine Gelegenheit zu warten, um mit einem Arzt zu sprechen, schließlich sei montags immer viel los. Der zweite Anruf galt seinem Freund Philipp Vallerot, einem Privatier mit französischen Wurzeln, der von seinem Vermögen lebte und nur zum Zeitvertreib arbeitete, wenn er etwa kostenlos Nachhilfeunterricht gab. Offiziell bezeichnete er sich als Sicherheitsberater, aber niemand im Ort wusste, Baltasar eingeschlossen, wer seine Kunden waren und ob es überhaupt Kunden gab. Das Schlimmste aber, eine unverzeihliche Sünde, zumindest in den Augen der Einheimischen: Vallerot war Atheist, der sich mit seiner Meinung über Gott und die Welt nicht zurückhielt.
Baltasar schreckte das nicht. Er lieh sich Vallerots Auto für die Fahrt nach Freyung, denn ein eigenes Fahrzeug wollte die Diözese nicht zur Verfügung stellen, und er selbst sparte das Geld lieber für Gemeindeprojekte, das Budget war knapp bemessen. Das Krankenhaus war ein Bau mit dem Charme eines Betonbunkers, Baltasar probierte es bei der Notaufnahme.
»Wo fehlt’s Ihnen?« Die Krankenschwester blickte nur kurz von ihren Unterlagen auf. »Haben’s Ihre Karte dabei?«
»Ich suche einen Arzt, der mir bei einem speziellen Problem helfen kann.« Die Frau erwiderte sein Lächeln nicht.
»Die Prostata vermutlich, da brauchn’s einen Urologen. Haben Sie Schwierigkeiten beim Harnlassen oder mit der Potenz?«
»Ich habe was dabei, das ich von einem Doktor begutachten lassen möchte.«
»Sagen’s doch gleich, dass Sie Ihre Urinprobe abgeben wollen. Wo ham’s denn des Becherl?« Sie streckte die Hand aus.
Er nahm das Kieferfragment aus der Tasche und drückte es ihr ohne Kommentar in die Hand. Sie zuckte zurück. »Was soll das? Was ist das?«
»Genau dafür brauche ich die Meinung eines Fachmanns. Es ist ein menschlicher Knochen.«
Die Krankenschwester hatte ihre Fassung wiedergewonnen. »Was glauben Sie denn, wo wir hier sind? Im archäologischen Museum? Schaun’s da drüben«, sie deutete auf die Reihe der wartenden Patienten, »jeder braucht schnell einen Arzt. Und da kommen Sie mir mit Ihrem Hobby? Als Nächstes zeigen Sie mir vielleicht noch Ihren Mammutknochen. Wo samma denn? Schaun’s, dass Sie sich wieder schleichen.«
Baltasar versuchte es nochmals mit seiner Bitte, aber die Frau beachtete ihn nicht weiter, wedelte mit ihrer Akte und rief: »Der Nächste bitte!«
Er versuchte es im ersten Stock im Schwesternzimmer. Diesmal trug er das Fundstück sichtbar vor sich her. Eine Frau sah vom Schreibtisch auf. Baltasar erklärte ihr seinen Wunsch. »Warten Sie, bis der Arzt von der Visite zurückkommt. Er kann Ihnen weiterhelfen.«
Nach einer Viertelstunde federte ein Mann im weißen Kittel heran, in der Brusttasche ein Stethoskop. Baltasar begrüßte ihn und stellte sich vor.
»Guten Tag, ich bin Doktor Bauer, Sie haben Glück, mich gerade zu erwischen. Ich muss noch in den OP.« Er war vielleicht vierzig Jahre alt, die dünnen Haare waren nach hinten gekämmt.
»Ich hoffe, es geht schnell.« Baltasar zeigte ihm das Stück Unterkiefer und berichtete über den Fundort.
»Sie wollen also genauere Auskunft über den verstorbenen Menschen. Dazu müsste ich ins Labor. Wenn Sie mir folgen, ein paar Minuten Pause habe ich noch.« Der Doktor stürmte los, Baltasar hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Sie betraten einen von Deckenstrahlern hell erleuchteten Raum. An den Wänden reihten sich Regale mit Reagenzgläsern, Petrischalen und Kartons, auf Sideboards standen Bunsenbrenner und elektrisch betriebene Analysegeräte.
»Darf ich?« Der Arzt nahm den Knochen an sich und trug ihn zu einem Mikroskop, das auf einem Arbeitstisch in der Mitte stand. »Interessant. So was habe ich das letzte Mal im Studium in der Pathologie gemacht.« Er betrachtete das Fundstück eine Zeitlang unter dem Mikroskop, dann gab er es Baltasar zurück. »Also, ich kann nur einen vorläufigen Befund geben. Um Genaueres zu sagen, bräuchte man chemische Untersuchungen und eine DNA-Analyse. Wie lange der Kiefer schon in der Erde liegt, ist schwierig zu taxieren, das hängt von der Bodenbeschaffenheit ab und von der Tiefe des Skeletts. Denn irgendwo bei dem Fundort muss natürlich das restliche Skelett liegen. Wenn man das hätte, könnte man wesentlich präzisere Aussagen treffen. Wie es jetzt aussieht, war der Leichnam mindestens zehn Jahre unter der Erde, vielleicht auch deutlich länger. Form und Beschaffenheit des Kiefers führen mich zu einer Schlussfolgerung: Es handelt sich um eine Frau, dem Gebiss nach zu urteilen etwa zwanzig Jahre alt, plus minus fünf Jahre. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für Sie habe. Ich muss jetzt los, schön, Sie kennen gelernt zu haben.« Sprach’s und verschwand.
Baltasar packte sein Mitbringsel ein und machte sich auf den Heimweg. Die Auskunft des Arztes hatte ihn verwirrt. Wie passte das geschätzte Alter der Frau mit der Inschrift auf dem Totenbrett zusammen? Danach müsste die Tote wesentlich älter sein. Vermutlich war die Schätzung des Doktors viel zu ungenau, er hatte ja selbst zugegeben, aus der Übung zu sein; solche Arbeiten waren etwas für Spezialisten. Außerdem war die Knochenprobe nicht ausreichend für ein abschließendes Gutachten. Man sollte es damit auf sich beruhen lassen, dachte Baltasar, aber im selben Moment wusste er, dass er das nicht konnte, weil er sich bereits zu sehr in die Angelegenheit vertieft hatte. Außerdem gab seine angeborene Neugierde keine Ruhe, eine Schwäche, für die der liebe Gott sicher Verständnis hatte.
Am nächsten Tag fasste Baltasar einen Entschluss: Er würde sich selbst Gewissheit verschaffen, auch wenn er dafür unkonventionelle Wege gehen musste. Sein Plan erforderte Geheimhaltung, schließlich wollte er sich nicht blamieren und als Spinner abstempeln lassen. Das nötige Werkzeug hatte er bereits im Keller des Pfarrhauses entdeckt, er wickelte alles in eine Decke und befestigte es auf seinem Fahrrad. Glücklicherweise begegnete er niemandem auf der Straße, bevor er sein Ziel erreicht hatte.
Das Wetter spielte ihm in die Hände, Wind zog auf und schob die Wolken zu einer zähen, dunkelgrauen Masse zusammen, das Licht verblasst wie in der Abenddämmerung, obwohl es erst Vormittag war. Blätter wirbelten auf, die Vögel schienen zu verstummen. Der Boden war bereits umgeackert worden, Furchen zogen ein Linienmuster in das Feld. Baltasar nahm die Schaufel und ritzte ein Rechteck von der Größe einer Tür in die Erde. Systematisch trug er den Boden ab. Die Erde, schwarz und schwer, klebte am Spaten, als wollte sie Widerstand leisten gegen die Arbeit. Baltasar kam außer Atem, obwohl er erst eine Grube von dreißig Zentimetern Tiefe ausgehoben hatte. Außer Steinen und Wurzelresten fand er nichts, und er ärgerte sich, weil er den Jungen nicht genauer nach der Stelle befragt hatte. Bei einem halben Meter Tiefe legte Baltasar eine Pause ein. Es war wohl die falsche Stelle, so tief konnte das Skelett nicht liegen – wenn es überhaupt ein Skelett gab und der Bub die Wahrheit gesagt hatte. Schweiß rann ihm den Rücken hinab. Nach der dritten Grube in einem Meter Tiefe war er davon überzeugt, dass er reingelegt worden war.