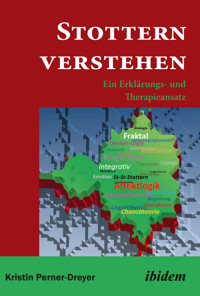
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In Deutschland sind rund 800.000 Menschen von einer Redeflussstörung betroffen, und zwar in allen Bildungs-, Sozial- und Altersschichten. Insbesondere in der Schule begegnen junge Betroffene sehr häufig Vorurteilen und Ausgrenzung, was tiefe und weitreichende psychologische Auswirkungen haben und bis in die persönliche Isolation führen kann. Kristin Perner-Dreyer setzt Stottern als psychoreaktive Redestörung mit Affekten und deren inhärenter Logik in Verbindung. Das vermeintliche Chaos von Emotionen funktioniert nach eigenen Regeln, deren Analyse einen Teufelskreis durchbrechen kann. Mit theoretischen Erkenntnissen und praktischen Beispielen wird eine Therapie umrissen, deren Hintergründe zwar sehr komplex sind, deren Erfolg aber frappant erscheint. Ein wertvolles Buch für Sprachheilpädagogen, Psychologen, Lehrer und Betroffene sowie deren Angehörige und alle, die in pädagogischen Kontexten arbeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
„Besserschweigenund alsNarrscheinen, als sprechen und jedenZweifelbeseitigen.“(Abraham Lincoln)
„Letzte Gelegenheit vor der Zeugniskonferenz. Jetzt noch mal guten Eindruck machen. Und die drohende vier in Französisch abwenden. Der Subjonctif ist dran. Susa K. kennt die Verbformen im Französischen ganz genau. Ist ihr Lieblingsfach. Sie erinnert sich an die schönen Sommer am Atlantik. Die MitschülerInnen quälen sich. Wie war das noch?‚Il faut absolument que tu … fais? … fasse?‘Keine weiß Antwort. Sie kennt sie.‚Que tu fasses‘, ist doch klar. Dennoch wünscht sich Susa K. weit weg. Sie wird sich nicht melden, sie meidet den Blick des Lehrers. Nicht dass er auf die Idee kommt, sie auch noch aufzurufen. Zu spät.‚Susa‘, ruft er. Das Herz schlägt wild, Achselzucken als Antwort. Jetzt sprechen, das hätte stottern bedeutet. Bloß nicht. Nicht schon wieder“ (Rapp 2005).
Personen, die stottern, (wobei hier der Fokus auf erwachsenen Personen liegt)fühlen sich oft in einer Eigenwelt gefangen. Sie sind sich genau darüber im Klaren, was sie gerne sagen würden – aber oft kommt alles anders als gewollt. Stotternde sind sich dessen bewusst, dass sie in der Kommunikation mit ihrer Umwelt die Kontrolle über ihr Sprechen verlieren können. Nicht selten ist eine Isolation aus bestimmten gesellschaftlichen Aktivitäten die Folge. Die vorliegende Arbeit behandelt zunächst die Symptomatik, Ätiologie, Diagnose und sozialpsychologische Aspekte des Stotternserwachsener Personen. Das Konzept der Integrativen Stottertherapie wird auf dasjenige von Bindel eingegrenzt. Im dritten Kapitel wird die fraktale Affektlogik vorgestellt und erklärt, wie Fühlen, Denken und Verhalten sich wechselseitig beeinflussen. Anschließend wird verdeutlicht, wie Gefühle allgemein und im spezifischen das Denken und Verhalten steuern. Basierend auf chaostheoretische Erkenntnisse wird die Bedeutung von affektiv-kognitiven „Schienen“ entschlüsselt. Praktische Konsequenzen der Affektlogik für die Therapie runden diesen Teil ab. Abschließend wird die Integrative Therapie aus der Sicht der fraktalen Affektlogik dargestellt und erläutert welche Auswirkungen dies für die integrative Stottertherapie hat.





























