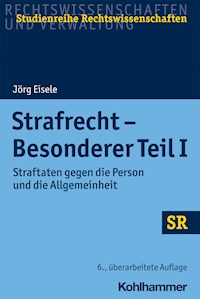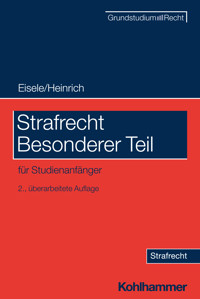Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Studienbuch Strafrecht - Besonderer Teil II bietet zusammen mit dem ebenfalls umfassend überarbeiteten Werk von Jörg Eisele zum Strafrecht - Besonderer Teil I eine umfassende Darstellung zu den einzelnen Straftaten des Besonderen Teils des Strafrechts. Der Band ist systematisch aufgebaut und stellt die Grundstrukturen des jeweiligen Deliktes in den Vordergrund. Zu jedem Straftatbestand findet sich ein detailliertes Aufbauschema, an dem sich die nachfolgende Darstellung orientiert. Prägnante Beispiele, zahlreiche Fälle sowie Schaubilder veranschaulichen und ergänzen diese. Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche neue prüfungsrelevante Entscheidungen sowie aktuelle Gesetzesänderungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1077
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Studienreihe Rechtswissenschaften
herausgegeben vonProfessor Dr. Winfried Boecken und Professor Dr. Heinrich Wilms (†)
fortgeführt vonProfessor Dr. Winfried Boecken und Professor Dr. Stefan Korioth
Strafrecht – Besonderer Teil II
Eigentumsdelikte und Vermögensdelikte
von
Professor Dr. Jörg Eisele
6., überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
6. Auflage 2021
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-039716-3
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-039717-0
epub: ISBN 978-3-17-039718-7
mobi: ISBN 978-3-17-039719-4
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Das Studienbuch Strafrecht – Besonderer Teil II bietet zusammen mit dem ebenfalls umfassend überarbeiteten Werk von Jörg Eisele zum Strafrecht – Besonderer Teil I eine umfassende Darstellung zu den einzelnen Straftaten des Besonderen Teils des Strafrechts. Der Band ist systematisch aufgebaut und stellt die Grundstrukturen des jeweiligen Deliktes in den Vordergrund. Zu jedem Straftatbestand findet sich ein detailliertes Aufbauschema, an dem sich die nachfolgende Darstellung orientiert. Prägnante Beispiele, zahlreiche Fälle sowie Schaubilder veranschaulichen und ergänzen diese. Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche neue prüfungsrelevante Entscheidungen sowie aktuelle Gesetzesänderungen.
Professor Dr. Jörg Eisele ist Inhaber des Lehrstuhls für Deutsches und Europäisches Straf- und Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Computerstrafrecht an der Universität Tübingen.
Vorwort zur 6. Auflage
Da sich die beiden Lehrbücher zum Besonderen Teil I und II ungebrochener Beliebtheit erfreuen, kann nun bereits die 6. Auflage vorgelegt werden. Für Studierende, die im 2. oder 3. Semester einen ersten Zugriff auf die wichtigsten Fragen des Besonderen Teils haben möchten, ist nunmehr parallel das noch stärker didaktisch ausgerichtete Buch Eisele/Heinrich, Strafrecht Besonderer Teil für Studienanfänger, das in einem Band die grundlegenden Fragestellungen behandelt, erschienen. Beide Reihen ergänzen sich in idealer Weise.
Das Lehrbuch behält auch weiterhin seine bewährte Grundkonzeption bei, übergeordnete Linien, Querbezüge innerhalb des Besonderen Teils und Verknüpfungen mit dem Allgemeinen Teil herauszuarbeiten, um so dem Nutzer eine bessere Orientierung innerhalb der nur schwer zu überschauenden Einzelheiten und Verästelungen des Besonderen Teils zu ermöglichen (ausführlich zur Konzeption vgl. das nachstehend abgedruckte Vorwort zur 1. Auflage). Inhaltlich war erneut eine große Anzahl neuer höchstrichterlicher Entscheidungen und wissenschaftlicher Publikationen einzuarbeiten.
Für ihre wertvolle Mithilfe bei den Recherche- und Korrekturarbeiten danke ich ganz herzlich meinen Mitarbeiter/Innen Hanna Becher, Dr. Alexander Bechtel, Eva Beier, Kristine Böhm, Michael Dinkel, Irmak Duman LL.M, Julia Felbinger, Sebastian Fetzer, Rasim Mustafi und Maren Straub sowie meiner Sekretärin, Frau Heidrun Leibfarth.
Für Anregungen, Hinweise, Kritik und Wünsche bin ich immer sehr dankbar (per E-mail: [email protected]).
Tübingen, den 3. Oktober 2020Jörg Eisele
Vorwort zur 1. Auflage
Dieser Band zu den Eigentumsdelikten, Vermögensdelikten und Urkundendelikten schließt an meinen Besonderen Teil 1 an. Hinsichtlich Konzeption und Struktur kann daher auf das Vorwort zu Band 1 verwiesen werden. Die vielen positiven Rückmeldungen aus dem Kreis der Studierenden und Kollegen haben mich sehr gefreut und bestätigen das gewählte Konzept.
Für vielfältige Mitwirkung und wertvolle Hinweise als Assistenten schulde ich Ann-Kathrin Sasse, Dr. Karol Thalheimer, Daniel Scholze und Lukas Lehmann besonderen Dank. Ebenso großer Dank gilt Meike Feiri, Franziska Kraus, Mara Linder, Swantje Retsch, Daniela Schulte, Anja Tschierschke und Daniel Fehrenbach für ihre hervorragende Mitarbeit. Herzlich zu danken habe ich auch diesmal meiner Sekretärin Frau Gabi Reichle für die gelungene Formatierung des Buches.
Anregungen und Kritik sind jederzeit willkommen (per E-mail: [email protected]).
Konstanz, den 22. Juli 2008Jörg Eisele
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 6. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Literaturübersicht
Abkürzungsverzeichnis
Teil I:Einführung
§ 1Übersicht: Eigentums- und Vermögensdelikte
1.Eigentumsdelikte
2.Vermögensdelikte i. w. S.
3.Vermögensdelikte i. e. S.
4.Besondere subjektive Absichten
Teil II:Straftaten gegen das Eigentum
1. Kapitel:Diebstahl und Unterschlagung
§ 2Diebstahl, § 242
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
1.Rechtsgut
2.Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Rechtswidrigkeit als allgemeines Verbrechensmerkmal
V.Versuch, Vollendung und Beendigung
§ 3Diebstahl in einem besonders schweren Fall, § 243
I.Systematik
1.Mischform
2.Strafzumessungslösung
3.Tatbestandslösung
II.Regelbeispielsmethode
1.Indizwirkung
2.Analogiewirkung
3.Gegenschlusswirkung
III.Die einzelnen Regelbeispiele
1.Einbruchs- und Nachschlüsseldiebstahl, Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
2.Diebstahl von Sachen, die besonders gesichert sind, Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
3.Gewerbsmäßiger Diebstahl, Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
4.Kirchendiebstahl, Abs. 1 Satz 2 Nr. 4
5.Diebstahl öffentlicher Sachen, Abs. 1 Satz 2 Nr. 5
6.Diebstahl unter Ausnutzung von Hilflosigkeit, Unglücksfall oder gemeiner Gefahr, Abs. 1 Satz 2 Nr. 6
7.Diebstahl von Waffen oder Sprengstoff, Abs. 1 Satz 2 Nr. 7
IV.Anwendbarkeit der Vorschriften des Allgemeinen Teils
1.Vorsatz
2.Täterschaft und Teilnahme
3.Versuch und Rücktritt
V.Die Geringwertigkeitsklausel des § 243 Abs. 2
1.Anwendungsbereich
2.Dogmatische Einordnung
3.Beurteilung der Geringwertigkeit
4.Fälle des Vorsatzwechsels
VI.Konkurrenzen
§ 4Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl, Wohnungseinbruchsdiebstahl, § 244
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
1.Geschütztes Rechtsgut
2.Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.§ 244 Abs. 1 Nr. 1 lit. a
2.§ 244 Abs. 1 Nr. 1 lit. b
3.§ 244 Abs. 1 Nr. 2
4.§ 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4
IV.Konkurrenzen
§ 5Schwerer Bandendiebstahl, § 244a
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Folgen der Verweisung
2.Auswirkung auf andere Bandenmitglieder
IV.Konkurrenzen
§ 6Unterschlagung, § 246
I.Systematik und geschütztes Rechtsgut
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Qualifikation des § 246 Abs. 2
1.Anvertrauen
2.Rechts- und sittenwidriges Überlassen
V.Konkurrenzen
1.Subsidiaritätsklausel des § 246 Abs. 1 a. E.
2.Konkurrenzen außerhalb der Subsidiaritätsklausel
§ 7Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs, § 248b
I.Systematik und geschütztes Rechtsgut
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Konkurrenzen
§ 8Entziehung elektrischer Energie, § 248c
I.Systematik und geschütztes Rechtsgut
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
§ 9Strafantragserfordernisse
I.Strafantrag gemäß § 248a
II.Strafantrag gemäß § 247
2. Kapitel:Raub
§ 10Raub, § 249
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
1.Rechtsgut
2.Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Versuch
V.Beteiligung
1.Sukzessive Beteiligung nach Vollendung der Wegnahme
2.Beteiligung zwischen Versuchsbeginn und Vollendung
VI.Konkurrenzen
§ 11Schwerer Raub, § 250
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Qualifikationen des § 250 Abs. 1
2.Qualifikationstatbestand des § 250 Abs. 2
§ 12Raub mit Todesfolge, § 251
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Verwirklichung des Grundtatbestands
2.Schwere Folge i. S. d. § 18
IV.Versuch und Rücktritt
1.Versuch
2.Rücktritt
V.Beteiligung
VI.Konkurrenzen
3. Kapitel:Raubähnliche Delikte
§ 13Räuberischer Diebstahl, § 252
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Versuch
V.Täterschaft und Teilnahme
1.Strafbarkeit des Diebstahltäters
2.Strafbarkeit des Diebstahlsgehilfen
VI.Konkurrenzen
§ 14Räuberischer Angriff auf einen Kraftfahrer, § 316a
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Versuch und Vollendung
1.Vollendung
2.Versuch
V.Erfolgsqualifikation, § 316a Abs. 3
VI.Konkurrenzen
4. Kapitel:Sachbeschädigung
§ 15Sachbeschädigung, § 303
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Rechtswidrigkeit
1.Unbestellt zugesandte Ware
2.Graffiti und Kunst
§ 16Gemeinschädliche Sachbeschädigung, § 304
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
§ 17Zerstörung von Bauwerken, § 305
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
§ 18Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, § 305a
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
§ 19Datenveränderung, § 303a
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
1.Reform
2.Rechtsgut
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Konkurrenzen
§ 20Computersabotage, § 303b
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Qualifikation
Teil III:Vermögensdelikte
1. Kapitel:Betrug und betrugsähnliche Delikte
§ 21Betrug, § 263
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
3.Objektive Rechtswidrigkeit der erstrebten Bereicherung und Vorsatz diesbezüglich
IV.Versuch, Vollendung und Beendigung
V.Täterschaft und Teilnahme
VI.Strafzumessungsregel für besonders schwere Fälle, § 263 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 1 bis 5
1.Gewerbsmäßigkeit und Bandenmitgliedschaft (Nr. 1)
2.Vermögensverlust (Nr. 2)
3.Wirtschaftliche Not (Nr. 3)
4.Amtsträger (Nr. 4)
5.Versicherungsbetrug (Nr. 5)
VII.Qualifikation, § 263 Abs. 5
VIII.Konkurrenzen
IX.Strafantrag
§ 22Computerbetrug, § 263a
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema zu § 263a Abs. 1
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand und Rechtswidrigkeit der erstrebten Bereicherung
IV.Konkurrenzen
§ 23Versicherungsmissbrauch, § 265
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
3.Tätige Reue
4.Formelle Subsidiarität gegenüber § 263
§ 24Erschleichen von Leistungen, § 265a
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Versuch und Vollendung
V.Formelle Subsidiarität, § 265a Abs. 1 a. E.
VI.Strafantrag
§ 25Subventionsbetrug, § 264
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Strafzumessungsregel für besonders schwere Fälle mit Regelbeispielen, § 264 Abs. 2
1.Subvention großen Ausmaßes (Nr. 1)
2.Amtsträger (Nr. 2)
3.Ausnutzung der Mithilfe eines Amtsträgers (Nr. 3)
V.Qualifikation
VI.Tätige Reue, § 264 Abs. 6
VII.Konkurrenzen
§ 26Kapitalanlagebetrug, § 264a
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Grundzüge
§ 27Kreditbetrug, § 265b
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Grundzüge
2. Kapitel:Erpressung, erpresserischer Menschenraub und Geiselnahme
§ 28Erpressung, § 253
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
3.Rechtswidrigkeit der erstrebten Bereicherung und Vorsatz diesbezüglich
IV.Rechtswidrigkeit
V.Versuch und Vollendung
VI.Konkurrenzen
§ 29Räuberische Erpressung, § 255
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Rechtswidrigkeit
V.Strafschärfungen
1.Qualifikation des § 250
2.Erfolgsqualifikation des § 251
VI.Konkurrenzen
1.Innertatbestandliche Konkurrenz bei mehreren Nötigungshandlungen
2.Außertatbestandliche Konkurrenz
§ 30Erpresserischer Menschenraub, § 239a
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand des Abs. 1 Var. 1
2.Subjektiver Tatbestand des Abs. 1 Var. 1
3.Objektiver Tatbestand des Abs. 1 Var. 2
4.Subjektiver Tatbestand des Abs. 1 Var. 2
IV.Erfolgsqualifikation, § 239a Abs. 3
1.Allgemeine Voraussetzungen
2.Gefahrspezifischer Zusammenhang
V.Tätige Reue, § 239a Abs. 4
VI.Konkurrenzen
§ 31Geiselnahme, § 239b
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand des Abs. 1 Var. 1
2.Subjektiver Tatbestand des Abs. 1 Var. 1
3.Objektiver Tatbestand des Abs. 1 Var. 2
4.Subjektiver Tatbestand des Abs. 1 Var. 2
IV.Erfolgsqualifikation und tätige Reue, § 239b Abs. 2 i. V. m. § 239a Abs. 3 und Abs. 4
3. Kapitel:Untreue und untreueähnliche Delikte
§ 32Untreue, § 266
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
1.Geschütztes Rechtsgut
2.Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Spezielle Voraussetzungen des Missbrauchstatbestands, Abs. 1 Var. 1
2.Treubruchstatbestand, Abs. 1 Var. 2
3.Subjektiver Tatbestand
IV.Rechtswidrigkeit
V.Täterschaft und Teilnahme
VI.Strafzumessungsregel für besonders schwere Fälle mit Regelbeispielen, § 266 Abs. 2 i. V. m. § 263 Abs. 3 Satz 2
VII.Konkurrenzen
VIII.Strafantrag
§ 33Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten, § 266b
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Konkurrenzen
4. Kapitel:Insolvenz- und Vollstreckungsdelikte, Pfandkehr
§ 34Bankrott, § 283
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
1.Geschütztes Rechtsgut
2.Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Objektive Bedingung der Strafbarkeit
1.Voraussetzungen
2.Kausalität und Zurechnung
V.Täterschaft und Teilnahme
VI.Strafzumessungsregel für besonders schwere Fälle, § 283a
VII.Konkurrenzen
§ 35Verletzung der Buchführungspflicht, § 283b
I.Überblick
II.Aufbauschema
§ 36Gläubigerbegünstigung, § 283c
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Objektive Bedingung der Strafbarkeit
V.Täterschaft und Teilnahme
§ 37Schuldnerbegünstigung, § 283d
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Objektive Bedingung der Strafbarkeit
V.Täterschaft und Teilnahme
VI.Strafzumessungsregel für besonders schwere Fälle, § 283d Abs. 3
§ 38Vereitelung der Zwangsvollstreckung, § 288
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Konkurrenzen
§ 39Pfandkehr, § 289
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
5. Kapitel:Unerlaubtes Glücksspiel, Jagd- und Fischwilderei
§ 40Unerlaubtes Veranstalten eines Glücksspiels, § 284
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Qualifikation, § 284 Abs. 3
§ 41Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel, § 285
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
§ 42Jagdwilderei, § 292
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Rechtswidrigkeit
1.Analoge Anwendung von § 228 BGB
2.Tötung eines kranken Tieres
V.Strafzumessungsregeln
1.Abs. 2 Satz 2 Nr. 1
2.Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
3.Abs. 2 Satz 2 Nr. 3
VI.Strafantrag, § 294
VII.Konkurrenzen
§ 43Fischwilderei, § 293
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
Teil IV:Anschlussdelikte
§ 44Begünstigung, § 257
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Strafausschließungsgrund des § 257 Abs. 3 Satz 1
1.Strafausschließungsgrund
2.Gegenausnahme des Satzes 2
V.Analoge Anwendung von Vorschriften über die tätige Reue
VI.Verfahrensvoraussetzungen des § 257 Abs. 4
VII.Konkurrenzen
§ 45Strafvereitelung und Strafvereitelung im Amt, §§ 258, 258a
I.Geschützes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand des § 258 Abs. 1
2.Objektiver Tatbestand des § 258 Abs. 2
3.Subjektiver Tatbestand
IV.Persönlicher Strafausschließungsgrund, § 258 Abs. 5
V.Angehörigenprivileg, § 258 Abs. 6
VI.Konkurrenz zu § 145d
VII.Qualifikation: Strafvereitelung im Amt, § 258a
1.Amtsträgereigenschaft
2.Unterlassen
§ 46Hehlerei, § 259
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Versuch
V.Qualifikationen
VI.Strafantrag
VII.Wahlfeststellung und Postpendenz
§ 47Geldwäsche, § 261
I.Geschützes Rechtsgut und Systematik
II.Aufbauschema
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
2.Subjektiver Tatbestand
IV.Strafzumessungsregel für besonders schwere Fälle mit Regelbeispielen, § 261 Abs. 4
V.Persönliche Strafausschließungs- und Strafaufhebungsgründe
1.Tätige Reue und Vortatbeteiligung
2.Aufklärungshilfe
VI.Konkurrenzen
Anhang:Definitionen
Stichwortverzeichnis
Literaturübersicht
A.(Zitierte) Lehrbücher Strafrecht Besonderer Teil
Arzt, Gunther/Weber, Ulrich/Heinrich, Bernd/Hilgendorf, Eric, Strafrecht Besonderer Teil, 3. Aufl. 2015 (zitiert: A/W/H/H-Bearbeiter)
Bock, Dennis, Strafrecht Besonderer Teil 2, Vermögensdelikte, 2018 (zitiert: Bock, BT 2)
Eisele, Jörg, Strafrecht Besonderer Teil 1, Straftaten gegen die Person und die Allgemeinheit, 6. Aufl. 2021 (zitiert: Eisele, BT 1)
Gössel, Karl Heinz/Dölling, Dieter, Strafrecht Besonderer Teil 1: Straftaten gegen Persönlichkeits- und Gemeinschaftswerte, 2. Aufl. 2004 (zitiert: Gössel/Dölling, BT 1)
Haft, Fritjof, Strafrecht Besonderer Teil II, Delikte gegen die Person und die Allgemeinheit, 8. Aufl. 2005 (zitiert: Haft, BT 2)
Heghmanns, Michael, Besonderer Teil, 2009 (zitiert: Heghmanns, BT)
Jäger, Christian, Examens-Repetitorium, Strafrecht Besonderer Teil, 8. Aufl. 2019 (zitiert: Jäger, BT)
Kindhäuser, Urs/Schramm, Edward, Strafrecht Besonderer Teil 1, Straftaten gegen Persönlichkeitsrechte, Staat und Gesellschaft, 9. Aufl. 2019 (zitiert: Kindhäuser/Schramm, BT 1)
Kindhäuser, Urs/Böse, Martin, Strafrecht Besonderer Teil 2, Straftaten gegen Vermögensrechte, 11. Aufl. 2021 (zitiert: Kindhäuser/Böse, BT 2)
Klesczewski, Diethelm, Strafrecht Besonderer Teil, Aufl. 2016 (zitiert: Klesczewski, BT)
Krey, Volker/Hellmann, Uwe/Heinrich, Manfred, Strafrecht Besonderer Teil, Band 1, Besonderer Teil ohne Vermögensdelikte, 16. Aufl. 2015 (zitiert: Krey/Hellmann/Heinrich, BT 1)
Krey, Volker/Hellmann, Uwe/Heinrich, Manfred, Strafrecht Besonderer Teil, Band 2, Vermögensdelikte, 17. Aufl. 2015 (zitiert: Krey/Hellmann/Heinrich, BT 2)
Küper, Wilfried/Zopfs, Jan, Strafrecht Besonderer Teil, Definitionen mit Erläuterungen, 10. Aufl. 2018 (zitiert: Küper/Zopfs, BT)
Küpper, Georg/Börner, René, Strafrecht Besonderer Teil 1: Delikte gegen Rechtsgüter der Person und Gemeinschaft, 4. Aufl. 2017 (zitiert: Küpper/Börner, BT 1)
Maurach, Reinhart/Schroeder, Friedrich-Christian/Maiwald, Manfred/Hoyer, Andreas/Momsen, Carsten, Strafrecht Besonderer Teil, Teilband 1, Straftaten gegen Persönlichkeits- und Vermögenswerte, 11. Aufl. 2019 (zitiert: Maurach/Schroeder/Maiwald/Hoyer/Momsen, BT 1)
Maurach, Reinhart/Schroeder, Friedrich-Christian/Maiwald, Manfred, Strafrecht Besonderer Teil, Teilband 2, Straftaten gegen Gemeinschaftswerte, 10. Aufl. 2013 (zitiert: Maurach/Schroeder/Maiwald/Hoyer/Momsen, BT 2)
Mitsch, Wolfgang, Strafrecht Besonderer Teil 2, Vermögensdelikte, 3. Aufl. 2015 (zitiert: Mitsch, BT 2)
Otto, Harro, Grundkurs Strafrecht, Die einzelnen Delikte, 7. Aufl. 2007 (zitiert: Otto, BT)
Rengier, Rudolf, Strafrecht Besonderer Teil I, Vermögensdelikte, 22. Aufl. 2020 (zitiert: Rengier, BT 1)
Rengier, Rudolf, Strafrecht Besonderer Teil II, Delikte gegen Personen und gegen die Allgemeinheit, 20. Aufl. 2019 (zitiert: Rengier, BT 2)
Schramm, Edward, Strafrecht Besonderer Teil I, Eigentums- und Vermögensdelikte, 2017 (zitiert: Schramm, BT 1)
Sonnen, Bernd-Rüdeger, Strafrecht Besonderer Teil, 2005 (zitiert: Sonnen, BT)
Tiedemann, Klaus, Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Teil, 5. Aufl. 2017 (zitiert: Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht BT)
Wessels, Johannes/Hettinger, Michael/Engländer, Armin, Strafrecht Besonderer Teil 1, Straftaten gegen Persönlichkeits- und Gemeinschaftswerte, 44. Aufl. 2020 (zitiert: Wessels/Hettinger/Engländer, BT 1)
Wessels, Johannes/Hillenkamp, Thomas/Schuhr, Jan, Strafrecht Besonderer Teil 2, Straftaten gegen Vermögenswerte, 43. Aufl. 2020 (zitiert: Wessels/Hillenkamp/Schuhr, BT 2)
Wittig, Petra, Wirtschaftsstrafrecht, 5. Aufl. 2020 (zitiert: Wittig, Wirtschaftsstrafrecht)
B.(Zitierte) Lehrbücher Strafrecht Allgemeiner Teil
Baumann, Jürgen/Weber, Ulrich/Mitsch, Wolfgang/Eisele, Jörg, Strafrecht Allgemeiner Teil, 12. Aufl. 2016 (zitiert: B/W/M/E-Bearbeiter)
Freund, Georg/Rostalski, Frauke, Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2019 (zitiert: Freund/Rostalski, AT)
Haft, Fritjof, Strafrecht Allgemeiner Teil, 9. Aufl. 2004 (zitiert: Haft, AT)
Heinrich, Bernd, Strafrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2019 (zitiert: Heinrich, AT)
Jakobs, Günther, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1991(zitiert: Jakobs, AT)
Jescheck, Hans-Heinrich/Weigend, Thomas, Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996 (zitiert: Jescheck/Weigend, AT)
Krey, Volker/Esser, Robert, Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2016 (zitiert: Krey/Esser, AT)
Kühl, Kristian, Strafrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017 (zitiert: Kühl, AT)
Maurach, Reinhart/Gössel, Karl-Heinz/Zipf, Heinz, Strafrecht Allgemeiner Teil, Teilband 2, 8. Aufl. 2014 (zitiert: Maurach/Gössel/Zipf, AT 2)
Murmann, Uwe, Grundkurs Strafrecht, 5. Aufl. 2019 (zitiert: Murmann, Grundkurs)
Otto, Harro, Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre, 7. Aufl. 2004 (zitiert: Otto, AT)
Rengier, Rudolf, Strafrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl. 2019 (zitiert: Rengier, AT)
Roxin, Claus/Greco, Luis, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band 1, 5. Aufl. 2020 (zitiert: Roxin/Greco, AT 1)
Roxin, Claus, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band 2, 2003 (zitiert: Roxin, AT 2)
Stratenwerth, Günter/Kuhlen, Lothar, Strafrecht Allgemeiner Teil, Die Straftat, 6. Aufl. 2011 (zitiert: Stratenwerth/Kuhlen, AT)
Wessels, Johannes/Beulke, Werner/Satzger, Helmut, Strafrecht Allgemeiner Teil, 50. Aufl. 2020 (zitiert: Wessels/Beulke/Satzger, AT)
C.(Bei den Übungsfällen zitierte) Fallsammlungen zum Besonderen Teil
Beck, Susanne/Valerius, Brian, Fälle zum Wirtschaftsstrafrecht, 2009 (zitiert: Beck/Valerius)
Beulke, Werner/Zimmermann, Frank, Klausurenkurs im Strafrecht II, ein Fall- und Repetitionsbuch für Fortgeschrittene, 4. Aufl. 2019 (zitiert: Beulke/Zimmermann II)
Beulke, Werner, Klausurenkurs im Strafrecht III, ein Fall- und Repetitionsbuch für Examenskandidaten, 5. Aufl. 2018 (zitiert: Beulke III)
Bock, Dennis, Wiederholungs- und Vertiefungskurs Strafrecht Besonderer Teil – Vermögensdelikte, 2. Aufl. 2016 (zitiert: Bock, BT)
Gössel, Karl-Heinz, Strafrecht. Mit Anleitungen zur Fallbearbeitung und zur Subsumtion, 8. Aufl. 2001 (zitiert: Gössel)
Gropp, Walter/Küpper, Georg/Mitsch, Wolfgang, Fallsammlung zum Strafrecht, 2. Aufl. 2012 (zitiert: Gropp/Küpper/Mitsch)
Haft, Fritjof, Fallrepetitorium zum Allgemeinen und Besonderen Teil, 5. Aufl. 2004 (zitiert: Haft, Fallrepetitorium)
Hellmann, Uwe, Fälle zum Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. 2018 (zitiert: Hellmann)
Hilgendorf, Eric, Fallsammlung zum Strafrecht, 5. Aufl. 2008 (zitiert: Hilgendorf, Fallsammlung)
Hilgendorf, Eric, Fälle zum Strafrecht für Fortgeschrittene, 3. Aufl. 2020 (zitiert: Hilgendorf, Fälle Fortgeschrittene)
Hilgendorf, Eric, Fälle zum Strafrecht für Examenskandidaten, 2. Aufl. 2016 (zitiert: Hilgendorf, Fälle Examen)
Hillenkamp, Thomas/Cornelius, Kai, 40 Probleme aus dem Strafrecht, Besonderer Teil, 13. Aufl. 2020 (zitiert: Hillenkamp/Cornelius, 40 Probleme BT)
Kudlich, Hans, Strafrecht Besonderer Teil 2 (Prüfe dein Wissen), 4. Aufl. 2016 (zitiert: Kudlich, Prüfe dein Wissen, BT 2)
Marxen, Klaus, Kompaktkurs Strafrecht Besonderer Teil, 2004 (zitiert: Marxen)
Otto, Harro/Bosch, Nikolaus, Übungen im Strafrecht, 7. Aufl. 2010 (zitiert: Otto/Bosch)
Sonnen, Bernd-Rüdeger/Mitto, Lutz/Nugel, Michael, Strafrecht Besonderer Teil, Fälle, 2006 (zitiert: Sonnen/Mitto/Nugel)
Strauß, Rainer, Strafrecht, Fälle und Lösungen, 3. Aufl. 1998 (zitiert: Strauß)
Wagner, Heinz, Fälle zum Strafrecht, Besonderer Teil, 4. Aufl. 1998 (zitiert: Wagner)
Wolters, Gereon, Fälle mit Lösungen für Fortgeschrittene im Strafrecht, 2. Aufl. 2006 (zitiert: Wolters)
D.(Zitierte) Kommentare zum Strafgesetzbuch
Anwaltkommentar, Strafgesetzbuch, hrsg. von Leipold, Klaus/Tsambikakis, Michael/Zöller, Mark, 3. Aufl. 2020 (zitiert: AnwK-Bearbeiter)
Beck’scher Online-Kommentar, Strafgesetzbuch, hrsg. von v. Heintschel-Heinegg, Bernd, Edition 47, Stand: 1.8.2020 (zitiert: Beck-OK-Bearbeiter)
Dölling, Dieter/Duttge, Gunnar/Rössner, Dieter (Hrsg.), Gesamtes Strafrecht, Handkommentar, 4. Aufl. 2017 (zitiert: HK-Bearbeiter)
Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 68. Aufl. 2021 (zitiert: Fischer)
Joecks, Wolfgang/Jäger, Christian, Studienkommentar StGB, 13. Aufl. 2021 (zitiert: Joecks/Jäger)
Kindhäuser, Urs/Hilgendorf, Eric, Strafgesetzbuch, Lehr- und Praxiskommentar, 8. Aufl. 2019 (zitiert: LPK-Kindhäuser/Hilgendorf)
Lackner, Karl/Kühl, Kristian, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 29. Aufl. 2018 (zitiert: L-Kühl/Bearbeiter)
Leipziger Kommentar, Strafgesetzbuch, 12., 13. Aufl. 2006 ff., hrsg. von Laufhütte, Heinrich Wilhelm/Rissing-van Saan, Ruth/Tiedemann, Klaus (zitiert: LK-Bearbeiter)
Matt, Holger/Renzikowski, Joachim, Strafgesetzbuch Kommentar, 2. Aufl. 2020 (zitiert: M/R-Bearbeiter)
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, hrsg. von Joecks,Wolfgang/Miebach, Klaus, 8 Bände, 3., 4. Aufl. 2016 ff. (zitiert: MünchKomm-Bearbeiter)
Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch, hrsg. von Kindhäuser, Urs/Neumann, Ulfried/Paeffgen, Hans-Ullrich, 5. Aufl. 2017 (zitiert: NK-Bearbeiter)
Satzger, Helmut/Schluckebier, Wilhelm/Widmaier, Gunter, Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019 (zitiert: SSW-Bearbeiter)
Schönke, Adolf/Schröder, Horst, Strafgesetzbuch, 30. Aufl. 2019 (zitiert: Schönke/Schröder/Bearbeiter)
Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, hrsg. von Wolter, Jürgen, 9. Aufl. 2015 ff. (zitiert: SK-Bearbeiter)
Abkürzungsverzeichnis
Teil I:Einführung
§ 1Übersicht: Eigentums- und Vermögensdelikte
1Die in diesem Band behandelten Eigentums- und Vermögensdelikte lassen sich grob nach dem unten dargestellten Schema einteilen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass bei einzelnen Delikten – etwa §§ 257 (Begünstigung) oder § 261 (Geldwäsche) – die Schutzrichtung problematisch und streitig ist1. Auch können bei einzelnen Delikten weitere Rechtsgüter hinzutreten; zu nennen sind neben § 316a, der auch die Sicherheit des Straßenverkehrs schützt, vor allem die §§ 264, 264a und 265b, die nach h. M. neben dem Vermögen jeweils Rechtsgüter der Allgemeinheit schützen2.
2
Eigentumsdelikte
Straftaten gegen das Vermögen als Ganzes
Straftaten gegen einzelne Vermögenswerte
1. Zueignungsdelikte
a) Diebstahl, §§ 242 ff.
b) Unterschlagung, § 246
c) Raub, §§ 249 ff.
d) Räuberischer Diebstahl, § 252
2. Sachbeschädigungsdelikte, §§ 303 ff.
1. Erpressung, §§ 253, 255, und erpresserischer Menschenraub, § 239a2
2. Betrugsdelikte, §§ 263, 263a, 264, 264a, 265b, 298
3. Versicherungsmissbrauch, § 265 und Erschleichen von Leistungen, § 265a
4. Untreuedelikte, §§ 266, 266a, 266b
5. Anschlussdelikte, §§ 257, 259, 261
6. Wucher, § 291
7. Unerlaubtes Glückspiel, §§ 284 bis 287
1. Gebrauchsanmaßung, §§ 248b, 290, und Entziehung elektrischer Energie, § 248c
2. Delikte gegen Aneignungsrechte, §§ 292 ff.
3. Insolvenzdelikte, §§ 283 ff., und Straftaten gegen Gläubiger, Nutzungsrechte usw., §§ 288, 289
4. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, § 1423
1.Eigentumsdelikte
3Geschütztes Rechtsgut ist das Eigentum an einzelnen Sachen. Unter Eigentum versteht man dabei die rechtliche Zuordnung von Sachen zu einer Person3. Nicht erfasst werden Rechte, Forderungen, Anwartschaften usw. Das Eigentum bestimmt sich nach den Regelungen des Bürgerlichen Rechts, wobei Rückwirkungsvorschriften (§ 142 Abs. 1 BGB: ex tunc-Wirkung) keine Berücksichtigung finden4. Bei den Eigentumsdelikten sind immer ganz bestimmte Gegenstände in den Blick zu nehmen. Daher entfällt etwa die Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung bei § 242 nur, wenn der Täter einen Anspruch auf die konkrete Sache besitzt5.
Bsp. (1): O hat dem T seinen Wagen veräußert und einen Kaufvertrag gemäß § 433 BGB geschlossen. Weil O den Wagen später nicht übereignen möchte, holt T den Wagen einfach ab. – T verwirklicht zwar den objektiven Tatbestand des § 242, weil er eine fremde bewegliche Sache weggenommen hat, jedoch ist die erstrebte Zueignung nicht rechtswidrig, weil er einen Anspruch auf Übereignung der Sache besaß. Rechtswidrig wäre die erstrebte Zueignung hingegen, wenn T einen anderen Wagen mitnehmen würde, da insoweit kein Anspruch besteht.
Bsp. (2): Wie Bsp. 1, jedoch gibt O den Wagen dem T freiwillig mit, weil dieser ihn über eine Probefahrt täuscht. – Nunmehr kommt Betrug, § 263, in Betracht. Weil T jedoch einen Anspruch auf die Sache besitzt, kann man bereits den Vermögensschaden, jedenfalls aber die Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung verneinen. Würde T einen anderen Wagen mit demselben Wert erhalten, bliebe er ebenfalls straffrei, da nur die Vermögenslage insgesamt, nicht aber die Beziehung zu einer bestimmten Sache entscheidend ist.
2.Vermögensdelikte i. w. S.
4Die Eigentumsdelikte kann man den Vermögensdelikten i. w. S. zuordnen, weil hier zwar kein Vermögensschaden erforderlich ist, jedoch dem Eigentum zumeist ein bestimmter Sachwert zukommt und daher bei diesen Delikten in aller Regel ein Vermögensschaden bewirkt wird6. Zwingend ist dies freilich nicht, weil Eigentumsdelikte – wie etwa Diebstahl und Sachbeschädigung – auch bei Sachen ohne wirtschaftlichen Wert bzw. mit rein ideellem Wert (z. B. gepflückte Blumen, altes Foto) in Betracht kommen7. Wie § 903 BGB zum Ausdruck bringt, ist das Recht, mit der Sache als Eigentümer nach Belieben zu verfahren, unabhängig vom Wert geschützt.
3.Vermögensdelikte i. e. S.
5Diese Delikte schützen das Vermögen als Summe aller Vermögenswerte umfassend8. Es sind demnach auch Forderungen usw. mit einbezogen. Der Schutz erstreckt sich freilich nur auf einzelne, gesetzlich bestimmte Angriffsrichtungen. Einen allgemeinen Vermögensschädigungstatbestand gibt es nicht. Bei Delikten gegen einzelne Vermögensrechte sind nur bestimmte Ausschnitte des Vermögens – bei den §§ 292 ff. etwa Aneignungsrechte – geschützt. Daneben gibt es Delikte, die neben dem Vermögen auch Interessen der Allgemeinheit schützen, wie dies etwa beim Subventions-, Kapitalanlage- und Kreditbetrug der Fall ist.
4.Besondere subjektive Absichten
6Bei den Eigentums- und Vermögensdelikten ist nicht zwingend erforderlich, dass der Täter einen Vermögensvorteil i. w. S. tatsächlich erlangt. Eine Ausnahme stellt aber die Unterschlagung dar, weil dort bereits der objektive Tatbestand eine Zueignung der Sache voraussetzt. Im Übrigen genügt es, dass der Täter in subjektiver Hinsicht einen Vorteil i. w. S. anstrebt. Daher ist es beim Diebstahl notwendig – aber auch ausreichend –, dass der Täter die Sache in Zueignungsabsicht wegnimmt; entsprechend verlangt § 263 beim Betrug eine Bereicherungsabsicht. Abgesehen vom räuberischen Diebstahl des § 252 genügt es dabei auch, dass der Täter das Eigentum oder den Vermögensvorteil nicht für sich, sondern einen Dritten anstrebt.
7Einen Überblick über die grobe Struktur der „Kerntatbestände“ gibt nachstehendes Schaubild:
Grobstruktur der „Kerntatbestände“
(Erstrebte) Verschiebung von Vermögenswerten i. w. S.
Vernichtung/Beeinträchtigung von Vermögenswerten
Eigentumsdelikte:
Bezug zu einer bestimmten Sache
§§ 242 ff., Diebstahl: Wegnahme einer Sache (ohne Gewalt oder Drohung) in Zueignungsabsicht
§§ 249 ff., Raub: Wegnahme einer Sache mit Gewalt gegen eine Person oder qualifizierter Drohung in Zueignungsabsicht
§ 252, Räuberischer Diebstahl: Wegnahme einer Sache und nachfolgende Gewaltausübung gegen eine Person oder qualifizierte Drohung nach Vollendung und vor Beendigung des Diebstahls (oder Raubs) in Besitzerhaltungsabsicht
§ 246, Unterschlagung: Objektive Zueignung einer Sache, ohne dass eine Wegnahme erforderlich ist
§ 303, Sachbeschädigung: Beschädigen, Zerstören, Verunstalten einer Sache
Vermögensdelikte:
Bezug zum Vermögen als Ganzes
§ 263, Betrug: Freiwillige Vermögensverschiebung des Opfers aufgrund einer Täuschung und mit Bereicherungsabsicht
§ 253, Erpressung (§ 255, räuberische Erpressung): „Bedingt freiwillige“ Vermögensverschiebung aufgrund von Gewalt oder Drohung und mit Bereicherungsabsicht
§ 266, Untreue: Vermögensschädigung durch Verletzung einer Vermögensbetreuungspflicht
Teil II:Straftaten gegen das Eigentum
1. Kapitel:Diebstahl und Unterschlagung
§ 2Diebstahl, § 242
Einführende Aufsätze: Börner, Zum Stand der Zueignungsdogmatik in den §§ 242, 246 StGB, Jura 2005, 389; Ceffinato, Vollendung des Diebstahls in fremden Gewahrsamssphären, Jura 2019, 1234; Ernst, „Schwarztanken“ an Selbstbedienungstankstellen – Plädoyer für eine Strafbarkeit wegen Unterschlagung, Jura 2013, 454; Jüchser, Gewahrsam – ein Begriff, der es nicht leicht macht, ZJS 2012, 195; Kudlich/Noltensmeier, Die Fremdheit der Sache als Tatbestandsmerkmal in strafrechtlichen Klausuren, JA 2007, 863; Kretschmer, Das Tatbestandsmerkmal „Sache“ im Strafrecht, JA 2015, 105; Kudlich, Die Wegnahme in der Fallbearbeitung, JA 2017, 428; Kudlich/Oğlakcıoğlu, „Auf die inneren Werte kommt es an“ – Die Zueignungsabsicht in der Fallbearbeitung, JA 2012, 321; Kühl, Vollendung und Beendigung bei den Eigentums- und Vermögensdelikten, JuS 2002, 729; Lange/Trost, Strafbarkeit des Schwarztankens an der SB-Tankstelle, JuS 2003, 961; Oğlakcıoğlu, Ein Tag im Supermarkt – Teil I, JA 2012, 902 und Teil II, JA 2013, 107; ders., Die Karten in meiner Brieftasche, Teil I, JA 2018, 279; Poisel/Ruppert, Über Trick- und Täuschungsreichtum, Die Abgrenzung von Diebstahl und Betrug – Teil I, JA 2019, 353 und Teil II, JA 2019, 421; Rönnau, Grundwissen – Strafrecht, Die Zueignungsabsicht, JuS 2007, 806; Schmitz/Goeckenjan/Ischebeck, Das (zivilrechtliche) Mysterium des Flaschenpfandes – strafrechtlich betrachtet, Jura 2006, 821; Schramm, Grundfälle zum Diebstahl, JuS 2008, 678 und 773; Zopfs, Der Tatbestand des Diebstahls, ZIS 2009, 506 und 649.
Übungsfälle: Ambos/Rackow, Die (Dienst-) Feldflasche, JuS 2008, 810; Beulke/Zimmermann II, Fall 3: Frühstück bei Tiffany, S. 55, Fall 5: Teures Benzin (bringt Ärger), S. 103; Beulke III, Fall 4: Alter schützt vor Torheit nicht, S. 118; Blaue, Ein hundsgemeiner Coup, JA 2018, 113; Bock, BT, Fall 2: Gratis Tanken und Kiffen, S. 29, Fall 3: Beutezug im Warenhaus, S. 63; Börner, „Müllers Mühle“, Jura 2003, 855; Celik, Für eine Handvoll Leergut, JA 2010, 855; Dietrich/Bechtel, Bowling und andere Sünden, JSE 2015, 250; Ernst, Schwarze Geschäfte, AL 2014, 131; Esser/Herz, Home, sweet home, 2017, 997; Esser/Lutz, One man’s trash is another man’s treasure, Jura 2016, 311; Esser/Scharnberg, Containern, JuS 2012, 809; Fahl, Variationen eines Diebstahls, JuS 2004, 885; Gaede, Täterschaft und Teilnahme beim Bandendiebstahl, JuS 2003, 774; Gössel, Fall 12: Selbstbedienung, S. 199, Fall 13: Spanner und Spannung, S. 213; Gropp/Küpper/Mitsch, Fall 13: Mobilitätsprobleme, S. 233, Fall 14: Essen auf Rädern, S. 251, Fall 17: Sauberes Geld, S. 305; Heinrich, Einkaufsfreuden, Jura 1997, 366; Hilgendorf, Fälle Examen, Fall 6: Gepflegtes Erbe, S. 73, Fall 7: Kaufhaustrubel, S. 89, Fall 12: Experte für EC-Karten, S. 165; Hilgendorf, Fälle Fortgeschrittene, Fall 4: Im Selbstbedienungsladen, S. 39; Jänicke, Keine Unschuldslämmer, Jura 2014, 446; Koch/Exner, Bücherklau – Die Jugendsünden des Professors, JuS 2007, 40; Kromrey, Schussfahrt auf der schiefen Bahn, Jura 2013, 533; Mitsch, Täterschaft und Teilnahme sowie Vermögensdelikte, JuS 2004, 323; Neubacher/Bachmann, Ein Jurastudent auf Verbrecherjagd, JA 2010, 711; Otto/Bosch, Fall 8: Tankstellenfall, S. 178; Otto/Bosch, Fall 15: Gams und Bart, S. 312; Safferling, Mittäterschaftlicher Diebstahl, JuS 2005, 135; Schumann/Zivanic, Breit gebaut, braun gebrannt, Schlüssel unter der Hantelbank, JA 2018, 504; Thoss, Ladendiebstahl und Folgen, Jura 2002, 351; Walter, Jupitersinfonie und Schlagerparade, Jura 2002, 415; Weißer, (Banden-)Diebstahl, JuS 2005, 620; Wolters, Fall 4: Zum Golde drängt doch alles, S. 85; Zopfs, Verrat unter Freunden, Jura 2013, 1072.
Rechtsprechung: BGHSt 16, 190 – Spritztour (Enteignungsvorsatz bei Rückführungswille); BGHSt 16, 271 – Selbstbedienungsladen (Zeitpunkt des Gewahrsamsbruchs); BGHSt 17, 87 – Moos-raus (Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung); BGHSt 19, 387 – Dienstmütze (Zueignungsabsicht); BGHSt 22, 45 – Spritztour (Abgrenzung von § 242 und § 248b); BGHSt 35, 152 – EC-Karte (Abheben von Geld mittels entwendeter EC-Karte); BGHSt 41, 198 – Einkaufswagen (Gewahrsamsbruch in Selbstbedienungsläden); BGH StraFo 2005, 433 – Selbsthilfe (Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung); BayObLG JR 1965, 26 – Pseudobote (Zueignung des Sachwerts); OLG Celle NJW 1967, 1921 – Kriminalroman (Zueignung des Sachwerts); OLG Düsseldorf NJW 1988, 922 – Selbstbedienungsladen (Verstecken von Zubehör); BGH NStZ-RR 2013, 309 – Stofftasche (fehlende Aneignungsabsicht).
I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
1.Rechtsgut
8§ 242 schützt richtigerweise nur das Eigentum an der Sache, nicht aber zusätzlich den Gewahrsam einer vom Eigentümer verschiedenen Person1. Einen bloßen Besitzschutz kennt das Strafgesetzbuch nicht. Folgerichtig ist auch nur der Eigentümer – also etwa der Vermieter, nicht aber der Mieter – als Verletzter i. S. d. § 77 zur Stellung des Strafantrags nach §§ 247, 248a befugt. Eine rechtfertigende Einwilligung kann ebenfalls nur vom Eigentümer erteilt werden2. Liegt allerdings ein Einverständnis des Gewahrsaminhabers vor, so ist das objektive Tatbestandsmerkmal der Wegnahme zu verneinen3.
2.Systematik
9§ 242 stellt den Grundtatbestand dar; § 243 enthält hierzu nach h. M. (nur) eine Strafzumessungsregel nach der Regelbeispielsmethode, die die Rechtsfolgenseite betrifft und erst nach der Prüfung der Schuld bzw. eines etwaigen Rücktritts (beim Versuch) zu prüfen ist. Qualifiziert wird § 242 durch die Vorschriften der §§ 244, 244a. Strafantragserfordernisse finden sich in §§ 247, 248a.
10a)§ 248b (Unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeugs) und § 248c (Entziehung elektrischer Energie) sind eigenständige Delikte, die in der Fallbearbeitung regelmäßig erst im Anschluss an § 242 zu prüfen sind.
11b)Auch § 246 (Unterschlagung) ist ein eigenständiges Delikt. Da es Auffangcharakter hat und § 246 Abs. 1 a. E. formelle Subsidiarität anordnet, ist es ebenfalls im Anschluss an § 242 und andere Eigentums- und Vermögensdelikte zu prüfen. Im Unterschied zu § 242 ist keine Wegnahme und damit kein Gewahrsam einer anderen Person erforderlich. Ferner ist die Zueignung hier objektives Tatbestandsmerkmal, wobei für den subjektiven Tatbestand dolus eventualis ausreicht.
12c)Letztlich sind auch § 249 (Raub) und § 252 (räuberischer Diebstahl) eigenständige Delikte. Kommt ein Raub in Betracht, sollte dieser in der Klausur vorab geprüft werden und (im Falle der Verneinung) erst im Anschluss daran § 242. Hingegen kann § 252 nur geprüft werden, wenn zuvor überhaupt ein vollendeter Diebstahl bejaht wurde. Beide Delikte sind stets getrennt zu prüfen (keine Inzidentprüfung des Diebstahls).
II.Aufbauschema
131. Tatbestand
a) Objektiver Tatbestand
aa) Fremde bewegliche Sache
bb) Wegnahme
b) Subjektiver Tatbestand
aa) Vorsatz (mind. dolus eventualis) bzgl. Wegnahme einer fremden beweglichen Sache
bb) (Dritt-)Zueignungsabsicht
(1) Zumindest dolus eventualis bzgl. einer dauerhaften Enteignung
(2) Dolus directus 1. Grades bzgl. einer zumindest vorübergehenden Aneignung
c) Objektive Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung und Vorsatz (mind. dolus eventualis) diesbezüglich
2. Rechtswidrigkeit
3. Schuld
4. Strafzumessungsregel für besonders schwere Fälle mit Regelbeispielen, § 243
a) Verwirklichung eines Regelbeispiels nach Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 7
b) Vorsatz bzgl. objektiver Regelbeispiele Nrn. 1, 2, 4 bis 7
c) Keine Widerlegung der Indizwirkung
d) Bei Regelbeispielen nach Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 6: Keine Geringwertigkeit, § 243 Abs. 2
5. Strafantrag, §§ 247, 248a
14Aufbauhinweis zum versuchten Diebstahl:
1. Tatbestand
a) Tatentschluss
aa) Tatentschluss (mind. dolus eventualis) bzgl. Wegnahme einer fremden beweglichen Sache
bb) (Dritt-)Zueignungsabsicht
(1) Zumindest dolus eventualis bzgl. einer dauerhaften Enteignung
(2) Dolus directus 1. Grades bzgl. einer zumindest vorübergehenden Aneignung
cc) Tatentschluss (mind. dolus eventualis) bzgl. objektiver Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung
b) Unmittelbares Ansetzen
2. Prüfungspunkte 2. bis 5. wie beim vollendeten Delikt; ggf. Rücktrittsprüfung
III.Tatbestand
1.Objektiver Tatbestand
15Dieser setzt die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache voraus. Anders als bei § 246 ist eine (objektive) Zueignung nicht erforderlich; vielmehr genügt es, dass der Täter in subjektiver Hinsicht die Zueignung der Sache erstrebt.
16a)Unter Sachen sind nur körperliche Gegenstände i. S. d. § 90 BGB unabhängig von ihrem Wert oder ihrem Aggregatszustand (fest, flüssig, gasförmig) zu verstehen4. Erforderlich ist für ihre Eigentumsfähigkeit lediglich, dass sie hinreichend abgrenzbar sind. Tiere werden vom Sachbegriff des StGB unmittelbar erfasst5, wie die Gleichstellung in §§ 324a Abs. 1 Nr. 1, 325 Abs. 1, 6 Nr. 1 von Tieren mit „anderen Sachen“ bestätigt6. Auf die Regelung des § 90a BGB, die zum gleichen Ergebnis führen würde, kommt es richtigerweise nicht an7, da keine Akzessorietät zu den zivilrechtlichen Regelungen besteht.
17aa)Rechte – wie Forderungen oder Patente – sind von § 242 nicht geschützt. Diese werden nur partiell von §§ 288, 289, 292 ff. und den Strafvorschriften des Urheberrechts erfasst. Papiere, die ein Recht verbriefen, sind jedoch taugliches Tatobjekt. Strahlen und elektrische Energie sind ebenfalls keine Sachen; die Anwendung des § 242 wäre daher eine nach Art. 103 Abs. 2 GG verbotene Analogie zu Lasten des Täters8. Um die damit verbundene Strafbarkeitslücke zu schließen, hat der Gesetzgeber für elektrische Energie die Vorschrift des § 248c geschaffen9. Auch Daten sind keine Sachen; die Kopie eines Computerprogramms ist daher nicht tatbestandsmäßig10. Allerdings kommt ein Diebstahl am Datenträger in Betracht, wenn etwa eine CD weggenommen wird.
18bb)Dem Körper eines lebenden Menschen kommt keine Sachqualität zu. Dies gilt auch für damit fest verbundene künstliche Teile (z. B. Keramikkrone, künstliches Hüftgelenk, Herzschrittmacher), die Bestandteil des Menschen werden und damit mit Einfügung in den Körper ihre Sachqualität verlieren11. Werden Körperteile abgetrennt (z. B. Zähne oder Haare) oder entnommen (z. B. Organe oder Blut), so fallen diese als Sachen unmittelbar in das Eigentum der jeweiligen Person, ohne dass es eines weiteren Aneignungsakts bedarf12. Dies gilt richtigerweise auch dann, wenn der Körperbestandteil – wie bei einer Sperma- oder Organspende – einem fremden Körper wieder eingefügt werden soll13.
19cc)Leichen sind nach h. M. zwar Sachen14, es fehlt jedoch regelmäßig an der Eigentumsfähigkeit, wenn diese bestattet werden sollen15. Werden der Körper oder Körperteile eines verstorbenen Menschen unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten weggenommen, so kommt eine Störung der Totenruhe nach § 168 oder Verwahrungsbruch nach § 133 in Betracht16. Implantierte Hilfsmittel, die bei einem lebenden Menschen keine Sachqualität besitzen, können nach dem Tod wieder Sachqualität erlangen und damit eigentumsfähig sein17.
Bsp.: Arzt T entnimmt dem bei einer Operation verstorbenen O sogleich den Herzschrittmacher, um diesen später anderweitig zu verwenden. – T macht sich nach § 246 strafbar. Wird der Herzschrittmacher später einem anderen Patienten als neuwertig eingesetzt, so kommt ggf. tatmehrheitlich noch ein Betrug, § 263, zu Lasten des Patienten in Betracht.
20Soweit der Körper oder Körperteile nach dem Tod – wie etwa plastinierte Leichen oder Mumien – nicht zur Bestattung bestimmt sind, handelt es sich um eigentumsfähige Sachen, so dass insoweit Eigentumsdelikte verwirklicht sein können18.
21b)Beweglich sind alle Sachen, die bewegt werden können. Es genügt, wenn sie erst durch die Wegnahme beweglich gemacht werden.
Bsp. (1):19 Schäfer T lässt eine fremde Weide durch seine Schafe „abmähen“. – Das Gras wird durch das Abkauen der Tiere beim Gewahrsamwechsel beweglich, was für § 242 genügt. In Tateinheit hierzu kann § 303 stehen, wenn die Tiere die Weide abgrasen und zertreten; im Gegensatz zu § 242 werden von § 303 auch unbewegliche Sachen erfasst.
Bsp. (2): T bricht nach bestandener Staatsprüfung zur Erinnerung einen Stein aus dem Universitätsgebäude und stellt diesen als Denkmal in seiner Wohnung auf. – § 242 ist (unproblematisch) verwirklicht.
22c)Eine Sache ist fremd, wenn sie im Allein-, Mit- oder Gesamthandseigentum einer anderen natürlichen oder juristischen Person steht. Dabei kommt es nur darauf an, dass ein anderer als der Täter Eigentümer ist. Wer einem Dieb die Sache wegnimmt, begeht demnach selbst einen weiteren Diebstahl zu Lasten des Eigentümers. Für die Bestimmung des Eigentums gelten die Regelungen des BGB, wobei Rückwirkungsvorschriften – etwa die ex tunc-Wirkung bei der Anfechtung nach § 142 Abs. 1 BGB oder die Rückwirkung der Genehmigung nach § 184 Abs. 1 BGB – keine Berücksichtigung finden können, weil für die Beurteilung der Strafbarkeit der Zeitpunkt der Tathandlung entscheidend ist und andernfalls rückwirkend eine Strafbarkeit begründet würde20. Im Rahmen der strafrechtlichen Fallbearbeitung müssen bei diesem Merkmal also ggf. sorgfältig zivilrechtliche Vorschriften (insb. §§ 929 ff. BGB) geprüft werden.
Bsp.: Erblasser E verstirbt in seinem Haus in Stuttgart, in dem auch seine Tochter T wohnt. T und O, der in Hamburg lebt und keinen Schlüssel zum Haus besitzt, sind Miterben (§ 2032 BGB). T nimmt einige Gegenstände aus dem Haus und veräußert diese für sich. – Für T handelt es sich aufgrund des Miteigentums des O um fremde Sachen. Fraglich ist dann, ob T fremden Gewahrsam gebrochen hat und damit eine Wegnahme vorliegt. Dies ist aber zu verneinen, weil nach dem Tod des E die Gegenstände im Alleingewahrsam der T standen. O besaß keine Zugriffsmöglichkeit und der fiktive Erbenbesitz nach § 857 BGB vermag eine tatsächliche Sachherrschaft nicht zu begründen21. Es kommt damit lediglich eine Strafbarkeit nach § 246 in Betracht.
23aa)Herrenlose Sachen, gleichgültig ob von Natur aus oder durch Eigentumsaufgabe nach §§ 958 ff. BGB (Dereliktion), sind nicht fremd; in Betracht kommt in solchen Fällen aber eine Wilderei nach §§ 292, 293. Davon sind verlorene Sachen zu unterscheiden, bei denen kein Eigentums-, sondern allenfalls einen Gewahrsamsverlust anzunehmen ist22. Werden Altkleider oder Sperrmüll zur Abholung an den Straßenrand gestellt, so ist darin keine Dereliktion, sondern – entsprechend dem Verwendungszweck des Eigentümers – ein Angebot zur Übereignung zu sehen23. Keine Dereliktion liegt auch vor, wenn eine Sache in Vernichtungsabsicht zum Abfall gegeben wird24.
Bsp.:25 O stellt einen Sack mit alten Kleidern zur Abholung durch das Rote Kreuz an den Gehweg vor seinem Haus. T öffnet den Sack und nimmt erfreut einige hübsche Stücke mit. – Da O das Eigentum nicht aufgegeben hat, handelte es sich für T um fremdes Eigentum. Da der verschlossene Sack vor seinem Haus stand, hatte er unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung auch noch Gewahrsam daran, so dass T § 242 verwirklicht.
23aDies gilt richtigerweise auch für das sog. Containern von Lebensmitteln. Gemeint sind Fälle, in denen Supermärkte Lebensmittel in Abfallcontainern entsorgen, die jedoch genießbar sind und daher von den Containern entnommen werden26. Auch im Entsorgen in den Containern kann keine Dereliktion gesehen werden27. Auch wird man jedenfalls bei abgesperrtem Gelände oder abgesperrten Containern auch von keiner mutmaßlichen Einwilligung ausgehen können28. Dafür spricht schon das Interesse des Eigentümers, Risiken im Zusammenhang mit verdorbener Ware durch die Vernichtung auszuschließen29. Letztlich ist es Aufgabe des Gesetzgebers, eine nachhaltige Verwendung von Lebensmitteln zu regeln.
24bb)Problematisch sind die Eigentumsverhältnisse an Betäubungsmitteln. Zu erkennen ist zunächst, dass (ausnahmsweise) nicht nur das zugrunde liegende Verpflichtungsgeschäft, sondern auch die rechtsgeschäftliche Übereignung der Betäubungsmittel30 und des gezahlten Kaufpreises31 nach § 134 BGB in Verbindung mit den Vorschriften des BtMG unwirksam sind. Daher wird teilweise bereits mangels Verkehrsfähigkeit der Sache die Anwendbarkeit von Eigentumsdelikten verneint. Das Eigentum, das nur originär erworben werden kann (vgl. §§ 950, 953 BGB), sei zu einer leeren „Begriffshülse“ reduziert32. Dabei muss man sehen, dass nicht nur Verfügungen ausgeschlossen sind, sondern auch bereits der Besitz als solcher mit Strafe bedroht ist33. Der 2. Strafsenat des BGH erwog ebenfalls – im Zusammenhang mit der Frage nach der Schutzwürdigkeit von Betäubungsmitteln im Rahmen der Vermögensdelikte (§§ 253; 263)34 – eine „teleologische Reduktion“ der Eigentumsdelikte35. Letztlich behielt er aber, nach durchweg ablehnenden Stellungnahmen der übrigen Senate, seine Rechtsprechung bei, wonach Betäubungsmittel aufgrund ihrer (originären) Eigentumsfähigkeit tauglicher Gegenstand der Eigentumsdelikte sind36. Dem ist beizupflichten, da der Schutz des Eigentums durch Eigentumsdelikte formaler Natur ist und daher der Wert der Sache sowie die tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten, mit der Sache (nach Belieben) zu verfahren, unerheblich sind37. Auch würde bei Betäubungsmitteln ansonsten das von § 903 BGB gewährte Recht auf Eigentumsaufgabe und Vernichtung der Sache geleugnet.
Bsp. (1):38 O kauft Heroin bei Dealer D. T nimmt O dieses zum Eigenverbrauch weg. – O konnte an dem Heroin aufgrund § 134 BGB kein Eigentum erwerben, da das dingliche Rechtsgeschäft unwirksam war. Dennoch handelte es sich für T um eine fremde Sache, da jedenfalls der Betäubungsmittelproduzent Eigentümer blieb, wenn alle nachfolgenden Veräußerungsakte unwirksam waren. T macht sich daher nach § 242 strafbar.
Bsp. (2):39 T kauft bei O Heroin an. Gleich nach dem Konsum fasst er den Entschluss, das als Kaufpreis übergebene Geld wieder an sich zu nehmen. – Für die Lösung des Falles ist entscheidend, dass auch die Übereignung des Kaufpreises nach § 134 BGB unwirksam ist40. Da das Geld daher weiterhin im Eigentum des T stand, handelte es sich um keine fremde Sache. Ein Betrug nach § 263 scheidet schon deshalb aus, weil T den Entschluss erst nach Abwicklung des Rechtsgeschäfts fasste.
25d)Unter Wegnahme ist der Bruch fremden und die Begründung neuen, nicht notwendigerweise tätereigenen Gewahrsams zu verstehen41. Dabei ist zu beachten, dass die „Wegnahme“ in § 168 (Bruch eines tatsächlichen Obhutsverhältnisses42) und § 289 (jedes Entziehen aus dem Machtbereich) im Lichte des geschützten Rechtsguts abweichend ausgelegt wird (sog. Relativität der Rechtsbegriffe43). Für die Wegnahmeprüfung kann zur Orientierung folgendes Schema zugrunde gelegt werden, ohne dass dies freilich in der Falllösung detailliert „abgearbeitet“ werden sollte44:
1. Fremder Gewahrsam
a) Gewahrsam
aa) Sachherrschaftsverhältnis (objektive Komponente)
bb) Natürlicher Sachherrschaftswille (subjektive Komponente)
b) Fremder Gewahrsam: Alleingewahrsam, über- oder gleich geordneter Gewahrsam einer anderen Person
2. Bruch des fremden Gewahrsams
a) Aufhebung des Gewahrsams, nicht bloße Gewahrsamslockerung
b) Gegen bzw. ohne den Willen des Gewahrsamsinhabers → ansonsten tatbestandsausschließendes Einverständnis; dabei aufgrund des Exklusivitätsverhältnisses Abgrenzung zum Betrug nach § 263
3. Begründung neuen, nicht notwendigerweise tätereigenen Gewahrsams
26aa)Bruch fremden Gewahrsams bedeutet die Aufhebung der Sachherrschaft gegen den Willen bzw. ohne das Einverständnis des bisherigen Gewahrsamsinhabers45. In einem ersten Schritt ist zu prüfen, welche Person vor der Tathandlung Gewahrsam an dem Gegenstand besaß. Unter Gewahrsam versteht man die Sachherrschaft (objektive Komponente), die von einem natürlichen Sachherrschaftswillen getragen wird (subjektive Komponente)46. Entfällt eine der beiden Komponenten, so endet der Gewahrsam.
27(1)Ein Sachherrschaftsverhältnis liegt vor, wenn für den Berechtigten die Möglichkeit zur physisch-realen Einwirkung auf die Sache besteht und der Ausübung der Herrschaft keine wesentlichen Hindernisse entgegenstehen. Dabei sind die konkreten Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung entscheidend, wobei eine normative Betrachtung im Vordergrund steht47. Im Rahmen einer solchen normativen Betrachtung kann für einen Gewahrsam sprechen, dass sich der Gegenstand in der räumlichen Sphäre einer Person befindet (Einwurf in den Briefkasten, Verwahrung im Lager usw.). Umgekehrt ist der Gewahrsam nicht schon deshalb beendet oder ausgeschlossen, wenn aufgrund räumlicher Distanz die faktische Zugriffsmöglichkeit gelockert ist48.
Bsp. (1): O stellt seinen Wagen auf einem Parkplatz ab und fährt in den Urlaub; O lässt seinen Kater durch den ganzen Ort streunen; das Postpaket wird vor der Haustür des abwesenden O abgelegt; die Zeitungen werden am frühen Morgen auf der Straße vor dem Kiosk des O abgelegt. – Nimmt T die Sachen, so bricht er den gelockerten, aber dennoch fortbestehenden Gewahrsam und begeht einen Diebstahl.
Bsp. (2): T nimmt das silberne Besteck im Restaurant des O mit. – Zwar hält T dieses während des Essens in seinen Händen. Jedoch hat O in seiner räumlichen Sphäre weiterhin jederzeit die Zugriffsmöglichkeit und auch einen entsprechenden Sachherrschaftswillen, so dass er mindestens Mitgewahrsam besaß. Diesen hat T spätestens gebrochen, als er das Restaurant verließ.
28Der Gewahrsam ist im Übrigen unabhängig von den zivilrechtlichen Eigentums- und Besitzregelungen zu beurteilen. Zivilrechtlicher Besitz und strafrechtlicher Gewahrsam können zwar gleichlaufen, unterscheiden sich aber vor allem in folgenden Fällen: Der mittelbare Besitzer (§ 868 BGB) hat häufig keinen Gewahrsam; die tatsächliche Sachherrschaft wird zumeist beim unmittelbaren Besitzer liegen. Auch der (fiktive) Erbenbesitz (§ 857 BGB) begründet keine tatsächliche Sachherrschaft. Umgekehrt kann der Besitzdiener (§ 859 BGB), der selbst nicht Besitzer ist, die tatsächliche Sachherrschaft und daher Gewahrsam erlangen; je nach Sachverhaltsgestaltung kann dieser jedoch auch – ohne eigenen Gewahrsam – bloßer Gewahrsamsgehilfe bzw. Gewahrsamshüter des Geschäftsherrn sein.
29(2)An den natürlichen Sachherrschaftswillen als subjektive Komponente werden recht geringe Anforderungen gestellt. Es genügt zunächst ein genereller Sachherrschaftswille, der nicht auf einen konkreten Gegenstand bezogen sein muss, sich vielmehr grundsätzlich auf alle Sachen erstreckt, die sich im Herrschaftsbereich bzw. in der räumlichen Sphäre des Betreffenden befinden49. Anderes kann freilich bei Gegenständen gelten, die dem Betroffenen aufgedrängt werden und seinen Interessen zuwiderlaufen.
Bsp. (1): An einem verlorenen Geldschein in einem Ladengeschäft hat der Ladeninhaber Gewahrsam, selbst wenn er keine Kenntnis von dem Geldschein hat. Steckt die Putzfrau oder ein Kunde den Geldschein ein, so liegt daher Diebstahl (§ 242) und nicht lediglich Unterschlagung (§ 246) vor. Entsprechendes gilt für andere in Behördengebäuden, Stadthallen, Gaststätten, öffentlichen Verkehrsmitteln usw. liegen gebliebene Gegenstände.
Bsp. (2): O vergisst nach dem Abheben am Bankautomaten das Geld aus dem Ausgabefach mitzunehmen. Bevor es wieder eingezogen wird, greift T erfreut zu. – Das Geld war für T eine fremde bewegliche Sache; es stand weiterhin im Eigentum der Bank (mangels Übergabe keine Übereignung an O). Auch der Gewahrsam stand der innerhalb der Bank zuständigen natürlichen Person zu, da das Ausgabefach des Bankautomaten deren Gewahrsamssphäre zuzuordnen ist50. Dieser Fall kann ersichtlich nicht anders behandelt werden, wie wenn der Kunde außerhalb eines Abhebungsvorgangs am Automaten Geld liegen lässt oder verliert51.
30Es wird ferner kein ständig aktualisiertes Herrschaftsbewusstsein gefordert, so dass auch ein Schlafender oder Bewusstloser – selbst wenn dieser vor seinem Tod nicht mehr aus der Bewusstlosigkeit erwacht – weiterhin Gewahrsam haben kann52. Auch Kinder können den natürlichen Herrschaftswillen haben. Der Sachherrschaftswille endet erst mit dessen Aufgabe oder durch Tod des Gewahrsamsinhabers.
31Da nur natürliche Personen einen Herrschaftswillen bilden können, kommen juristische Personen nicht als Gewahrsamsinhaber in Betracht53. Wenn etwas unpräzise vom Gewahrsam eines Unternehmens, eines Warenhauses, einer Behörde usw. gesprochen wird, ist damit der Gewahrsam (und damit auch der Gewahrsamswille) der jeweils zuständigen Person (z. B. Geschäftsinhaber, Behördenleiter, Organ oder sonst beauftragte Person) gemeint54. Nimmt eine solche Person einen Gegenstand mit, so scheidet – sofern nicht Mitgewahrsam eines Dritten besteht – § 242 aus. In Betracht kommt eine Strafbarkeit nach § 246 Abs. 1 und 2 sowie nach § 266.
32(3)Die Beurteilung der Gewahrsamverhältnisse kann bei der Beteiligung mehrerer Personen kompliziert sein, weil hier neben dem Alleingewahrsam einer Person auch ein gleichrangiger oder mehrstufiger Mitgewahrsam anderer Personen in Betracht kommt, der mitunter von diffizilen Erwägungen abhängig gemacht wird.
Klausurhinweis: Für Klausuren ist nicht entscheidend, dass die unzähligen Fallkonstellationen auswendig gelernt werden, sondern anhand der verschiedenen Kriterien argumentiert wird.
33Bevor auf Einzelheiten dieser Gewahrsamsverhältnisse eingegangen wird, soll die Bedeutung dieser Einteilung verdeutlicht werden: Steht die Sache im Alleingewahrsam des Täters, so scheidet § 242 immer aus, da in diesem Fall kein fremder Gewahrsam gebrochen wird; in Betracht kommt nur eine Strafbarkeit nach § 246. Hat der Täter hingegen selbst keinen Gewahrsam an der Sache und wird fremder Gewahrsam – sei es Alleingewahrsam, sei es Mitgewahrsam – gebrochen, so ist § 242 verwirklicht, wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen. Steht die Sache im Gewahrsam von mehreren Personen, so spricht man von Mitgewahrsam. Nehmen alle Mitgewahrsamsinhaber einverständlich die Sache weg, so liegt kein Gewahrsamsbruch vor. Gleichrangigen Mitgewahrsam (z. B. unter Ehegatten) kann jeder Mitgewahrsamsinhaber brechen und damit § 242 verwirklichen55. Mehrstufiger Mitgewahrsam kann nur „von unten nach oben“ und nicht „von oben nach unten“ gebrochen werden. § 242 kann daher nur derjenige verwirklichen, der untergeordneten Mitgewahrsam, nicht aber derjenige, der übergeordneten Gewahrsam hat56. Mehrstufiger Mitgewahrsam kommt vor allem in Dienst-, Arbeits- und Auftragsverhältnissen in Betracht57. Bei genauer Betrachtung ist die Figur des untergeordneten Gewahrsams (und damit zugleich diejenige des übergeordneten Gewahrsams) jedoch entbehrlich. Man kann in diesen Fällen im Wege einer normativen Betrachtung ebenso gut davon ausgehen, dass der Geschäftsherr (Allein-)Gewahrsam besitzt, der von seinem Angestellten usw. oder einem Dritten gebrochen werden kann58.
Bsp.: Die Mitnahme eines Computers durch den Geschäftsinhaber ist – unabhängig davon, ob dieser Alleingewahrsam oder übergeordneten Mitgewahrsam hat – nicht tatbestandsmäßig; nimmt dagegen der Auszubildende (auch mit untergeordnetem Mitgewahrsam) das Gerät mit, kann § 242 verwirklicht sein.
34Diese abstrakten Grundsätze sollen anhand einiger wichtiger Fallgruppen exemplarisch verdeutlicht werden, wobei darauf hinzuweisen ist, dass bereits kleine Änderungen des Sachverhalts zu einer abweichenden rechtlichen Beurteilung des Gewahrsamsverhältnisses führen können.
35Bei verschlossenen, aber transportablen Behältnissen (z. B. Geldkassette, Koffer) hat regelmäßig derjenige Alleingewahrsam am Inhalt, der auch die Sachherrschaft am Behältnis hat. Der Schlüsselinhaber oder Codeinhaber hat nach h. M. insoweit keinen Mitgewahrsam, da er keinen Einfluss auf das Schicksal der Sache hat. Eine Ausnahme wird man aber zulassen müssen, wenn dieser weiß, wo sich das Behältnis befindet und er ungehinderten Zugriff auf das Behältnis und damit den Inhalt hat59. Ist das Behältnis fest mit einem Gebäude verbunden bzw. kann es nur mit großen Anstrengungen fortgeschafft werden (z. B. Wand- oder Stahltresor, Automaten), wird man entgegen der h. M. nicht Alleingewahrsam des Schlüsselinhabers60, sondern Mitgewahrsam desjenigen anzunehmen haben, der die räumliche Sphäre beherrscht. Dies wird vor allem in Fällen deutlich, in denen dem Schlüsselinhaber der Zugang zu den Räumlichkeiten nicht ohne weiteres möglich ist61.
36An verlorenen Gegenständen, bei denen der ursprüngliche Gewahrsamsinhaber nicht weiß, wo sie sich befinden, hat er keinen Gewahrsam mehr62. Denn in diesem Fall besteht mangels Kenntnis von der Belegenheit der Sache keine faktische Einwirkungsmöglichkeit. In fremder räumlicher Sphäre kann allerdings ein Dritter – geht man von dessen generellem Sachherrschaftswillen aus – aufgrund seiner Einwirkungsmöglichkeit nunmehr Alleingewahrsam erlangen.
Bsp.: O weiß nicht, dass er seine Uhr in einem Park liegen gelassen hat. T findet diese und steckt sie ein. – Da O keinen Gewahrsam mehr besitzt, d. h. die Sache gewahrsamslos ist, begeht T „nur“ eine Unterschlagung nach § 246 Abs. 1. Verliert O die Uhr hingegen in der Bäckerei des B, so erlangt B Alleingewahrsam an der Uhr; nimmt T diese mit, so bricht er den Gewahrsam des B und begeht einen Diebstahl zu Lasten des O (Eigentümer).
37Hinsichtlich vergessener Gegenstände, bei denen der ursprüngliche Gewahrsamsinhaber weiß, wo sich die Sache befindet, ist zu differenzieren: Hier besteht der Gewahrsam solange fort, wie der Gegenstand ohne wesentliche Hindernisse zurückerlangt werden kann63. Denn dann ist noch eine hinreichende Einwirkungsmöglichkeit gegeben. Der BGH möchte dies jedoch für Fälle einschränken, in denen die Sache in „einem öffentlichen, mithin für jede Person zugänglichen Bereich liegt und der ortsabwesende Geschädigte nicht in der Lage ist, auf die Sache einzuwirken“64. Sofern sich die Sache in einer fremden Herrschaftssphäre befindet, besteht aufgrund des generellen Sachherrschaftswillens des Dritten Mitgewahrsam am vergessenen Gegenstand65. Der (Mit-)Gewahrsam endet jedoch, wenn ein Zugriff auf die Sache nicht möglich ist.
Bsp.: Student O vergisst seinen Füller im Hörsaal. Als er ihn am Abend abholen möchte, steht er vor verschlossener Tür. Putzfrau T nimmt den Füller später mit. – O hat trotz Kenntnis vom Standort keinen Gewahrsam mehr, da er keinen Zugriff auf den Füller hat. Da er diesen in fremder Sphäre vergessen hat, steht der Füller im Gewahrsam des zuständigen Personals der Universität (Hausmeister, Verwaltung). T hat diesen Gewahrsam mit der Mitnahme gebrochen und daher § 242 verwirklicht.
38Nach h. M. haben Angestellte in Ladengeschäften, die unter Leitung bzw. Mitwirkung des Geschäftsherrn arbeiten, an den Waren, der Kasse und den Geldern, die sie von den Kunden in Empfang nehmen, keinen Mitgewahrsam. Sie sind lediglich Gewahrsamsgehilfen bzw. Gewahrsamshüter; der Geschäftsherr hat in diesem Fall Alleingewahrsam66. Entsprechendes gilt auch für kleinere Handwerksbetriebe, wenn der Arbeitnehmer Materialien oder Werkzeug mitnimmt. Selbst wenn man dies anders sieht und gleich- oder untergeordneten Mitgewahrsam annimmt, liegt immer noch ein Bruch fremden Gewahrsams vor.67 Angestellte, die in Kaufhäusern mit einem gewissen Maß an Eigenverantwortlichkeit einen räumlich abgegrenzten Bereich betreuen, können ggf. Mitgewahrsam an den darin befindlichen Sachen haben, der freilich dem Mitgewahrsam des Abteilungsleiters, Filialleiters, Geschäftsführers, Geschäftsinhabers usw. untergeordnet ist. Mit guten Gründen kann man aber auch hier die Figur des untergeordneten Gewahrsams als überflüssig ansehen68. Wer selbstständig eine Niederlassung oder Filiale leitet69 oder einen Sachbestand ganz selbstständig verwaltet70 hat Alleingewahrsam.
Bsp.: Der Angestellte T der Uhrenabteilung steckt nach Ladenschluss eine Uhr in seine Hosentasche, um diese anderweitig zu veräußern. – Da T nur untergeordneten Mitgewahrsam besitzt, bricht er bereits mit dem Einstecken der Uhr in seine Tasche (Gewahrsamsenklave)71 den übergeordneten Mitgewahrsam und macht sich daher nach § 242 strafbar.
39Ein Kassierer, der die Kasse eigenverantwortlich führt, soll nach h. M. regelmäßig Alleingewahrsam haben, wenn niemand bis zur Abrechnung das Geld gegen den Willen des Kassierers entnehmen darf72. Für einen Alleingewahrsam spricht auch die alleinige Zugriffsmöglichkeit, etwa durch den Besitz des einzigen Kassenschlüssels. Anders (Mitgewahrsam) kann aber zu entscheiden sein, wenn weitere Personen – etwa beim Zählen des Geldes – eingeschaltet sind73.
Bsp.: Studentin T jobbt als Bedienung in einer Cocktailbar. Hierzu rechnet sie mit einer eigenständig geführten Geldbörse an den Tischen ab, trennt das Trinkgeld von den Einnahmen und rechnet nach Schließung der Bar ab. Als sie in Zahlungsschwierigkeiten ist, nimmt sie das Geld einfach mit. – T hat, obwohl sie sich in der räumlichen Sphäre des Lokals befindet, Alleingewahrsam am Geld, da nur sie Zugriff auf die Geldbörse hat. Es liegt daher keine Wegnahme vor; T macht sich aber nach § 246 Abs. 1 und Abs. 2 strafbar.
40Beim Warentransport per LKW liegt zunächst ein Alleingewahrsam des Fahrers nahe, da dieser alleinigen Zugriff auf Wagen und Ladung hat. Allerdings bedarf es auch hier einer normativen Betrachtung unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung74. Alleingewahrsam des Fahrers ist dann anzunehmen, wenn nach Art der Fallgestaltung keine Einflussnahme oder Kontrolle durch den Geschäftsherrn mehr möglich ist. Indizien dafür sind eine lange Dauer der Fahrt, eine große Fahrtstrecke (Fernfahrten)75, eine Vielzahl anzufahrender Kunden mit nur kurzem Aufenthalt bei diesen sowie eine freie Wahl der Fahrtroute. Übergeordneter Mitgewahrsam des Geschäftsherrn ist hingegen anzunehmen, wenn trotz der Lockerung der Herrschaftsbeziehung noch erhebliche Einflussmöglichkeiten bestehen. Dies ist dann der Fall, wenn nur kurze Strecken gefahren werden, der Fahrer in der Bestimmung der Fahrtroute praktisch keine Freiheiten hat und per Funk Weisungen erhält.76
Bsp. (1): T fährt für die Firma Fri-Frost Tiefkühlkost zu einem festen Kundenstamm. Als er dabei an seiner Wohnung vorbeifährt, füllt er seine eigene Gefriertruhe auf. – T macht sich nach § 242 strafbar, da es sich um eine Fahrt im örtlichen Umkreis mit einer bestimmten Route (Kunden) handelt und er daher übergeordneten Mitgewahrsam gebrochen hat.
Bsp. (2): A und B fahren mit ihrem LKW quer durch Europa, um für den O Computerzubehör auszuliefern. Sie sind in Planung und Fahrtroute frei. Unterwegs füllt A – von B unbemerkt – seinen Kleiderkoffer mit teurer Ware, um diese nach der Rückkehr zu veräußern. – Zwar besaß O mangels Einwirkungsmöglichkeit keinen Gewahrsam an der Ware; jedoch hat A gleichrangigen Mitgewahrsam des B gebrochen und daher § 242 verwirklicht.
41(4)Unter Bruch des Gewahrsams ist die vollständige Aufhebung des Gewahrsams gegen oder zumindest ohne das Einverständnis des Gewahrsamsinhabers zu verstehen77. Erforderlich ist, dass der bisherige Gewahrsamsinhaber die Zugriffsmöglichkeit auf die Sache verliert78. Die Begründung des neuen Gewahrsams ist das Spiegelbild zum Gewahrsamsbruch und zugleich das Ergebnis des Gewahrsamswechsels. Die Kriterien des Gewahrsams müssen nun auf eine andere Person – nicht zwingend den Täter selbst – zutreffen79.
Bsp.:80 LKW-Fahrer T soll mit einem Fahrzeug seines Arbeitgebers verschiedene Waren beim Unternehmen O abholen. Als er einige teure Fernsehgeräte in den Lagerhallen entdeckt, lädt er diese „zusätzlich“ ein, um diese später für sich zu verkaufen. Für den vollendeten Gewahrsamsbruch mit Verladen der Fernsehgeräte kommt es nicht darauf an, ob T oder sein Arbeitgeber Gewahrsam an den Fernsehgeräten im LKW erlangt, da kein tätereigener Gewahrsam begründet werden muss.
Der Täter (bzw. ein Dritter) muss infolge des Gewahrsamswechsels die Sachherrschaft dergestalt erlangen, dass er sie ohne wesentliche Hindernisse ausüben kann und der bisherige Gewahrsamsinhaber nicht mehr über die Sache verfügen kann, ohne seinerseits die Verfügungsmacht des Täters zu brechen81. Eine bloße Gewahrsamslockerung genügt für einen Gewahrsamsbruch und damit einen Gewahrsamswechsel nicht. In solchen Fällen ist jedoch zu beachten, dass der endgültige Gewahrsamsbruch noch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann. Die zeitlich exakte Festlegung der Wegnahme und damit der Vollendung ist vor allem für das Verhältnis zu § 252, aber auch für die streitige Frage der sukzessiven Beteiligung und der Anwendbarkeit der Qualifikationen nach Vollendung von Bedeutung. Auch scheidet ab diesem Zeitpunkt ein Rücktritt nach § 24 aus.
Bsp.: T steckt im Supermarkt heimlich eine Packung Zigaretten in die Einkaufstasche der Rentnerin R. – Hier ist der Gewahrsam des Marktleiters usw. mit dem Einstecken gebrochen. Zwar befand sich die Sache noch im Rahmen der räumlichen Sphäre des Ladens, jedoch kann auf Gegenstände, die in Kleidung und Taschen von Kunden verborgen werden, nicht einfach zugegriffen werden. Es liegt eine vollendete Wegnahme vor, weil T neuen Gewahrsam bei R begründet hat und der Gewahrsamswechsel ohne den Willen des Gewahrsamsinhabers erfolgte.
42Bei den im Alltag (aber auch in Klausuren) häufig vorkommenden Ladendiebstählen ist der Gewahrsamswechsel, solange der Täter die Sachen noch in der Hand trägt, regelmäßig erst vollzogen, wenn er den räumlichen Herrschaftsbereich des Geschäftsinhabers verlässt82. Im Einzelfall kann Vollendung aber auch schon nach dem Passieren der Kasse anzunehmen sein; so beispielsweise, wenn in einem Einkaufszentrum unmittelbar nach der Kasse der Bereich des Ladengeschäfts endet und sich eine andere Fläche (Flur, weiteres Geschäft) anschließt. Andererseits kann der Herrschaftsbereich auch Flächen vor dem Gebäude erfassen, wenn dort ebenfalls Waren angeboten werden83. Das bloße Ergreifen kann den Gewahrsamswechsel allenfalls bei ganz kleinen Gegenständen – wie bei Geld – bewirken. Ansonsten genügt bei kleineren beweglichen Sachen für einen Gewahrsamsbruch auch in fremden räumlichen Sphären bereits das Verbergen am Körper, in der Kleidung oder in einer mitgeführten Tasche des Täters (Gewahrsamsenklave), weil der Zugriff hier wesentlich erschwert ist und eine Beeinträchtigung des höchstpersönlichen „Tabubereichs“ erfordert84. Entsprechendes gilt auch, wenn der Täter in einem Warenhaus Kleidungsstücke wie eigene davon trägt85