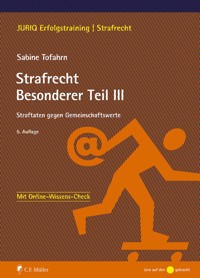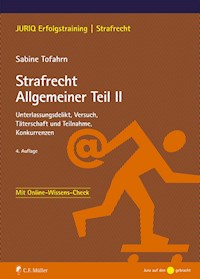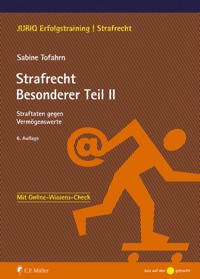
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Inhalt: Aus dem Besonderen Teil des Strafgesetzbuchs werden die Straftaten gegen Vermögenswerte behandelt. Nach einer Einführung sind die Straftaten gegen das Eigentum (u.a. Diebstahlsdelikte, Raubdelikte, Sachbeschädigung) sowie die Straftaten gegen einzelne Vermögenswerte (u.a. Betrugsdelikte, Erpressungsdelikte, Untreue) ausführlich dargestellt. Ein Teil zu den Anschlussdelikten (u.a. Begünstigung und Hehlerei) rundet das Skript ab. Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: - Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; - begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; - im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; - Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; - Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; - ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Strafrecht Besonderer Teil II
Straftaten gegen Vermögenswerte
von
Sabine Tofahrn
6., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-6126-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 6221 1859 599Telefax: +49 6221 1859 598
www.cfmueller.de
© 2024 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
•
ein nach didaktischen Gesichtspunkten ausgewähltes Farblayout
•
optische Verstärkung durch einprägsame Graphiken und
•
wiederkehrende Symbole am Rand
[Bild vergrößern]
[Bild vergrößern]
[Bild vergrößern]
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre strafrechtlichen Kenntnisse!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Dieses Skript behandelt die Straftaten gegen Vermögenswerte, der Band Strafrecht Besonderer Teil I die Straftaten gegen Persönlichkeitswerte und im Strafrecht Besonderer Teil III setzen wir fort mit denjenigen gegen Gemeinschaftswerte.
Auf geht's – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen.
Köln, im Januar 2024
Sabine Tofahrn
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müller mit Online-Wissens-Check
[Bild vergrößern]
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Littenstraße 11, 10179 Berlin zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Literaturverzeichnis
1. TeilEinführung
2. TeilStraftaten gegen das Eigentum
A.Überblick5 – 7
B.Diebstahl, § 2428 – 98
I.Überblick8, 9
II.Objektiver Tatbestand10 – 66
1.Tatobjekt: fremde bewegliche Sache11 – 23
a)Sache11 – 16
b)Beweglichkeit der Sache17
c)Fremdheit der Sache18 – 23
2.Tathandlung: Wegnahme24 – 65
a)Schritt 1: Stand die Sache im Gewahrsam eines anderen?27 – 45
b)Schritt 2: Wurde dieser Gewahrsam aufgehoben und neuer Gewahrsam beim Täter oder einem Dritten begründet?46 – 54
c)Schritt 3: Zum Schluss muss überprüft werden, ob der festgestellte Gewahrsamswechsel gegen oder ohne den Willen des Gewahrsamsinhabers erfolgte55 – 65
3.Vollendung – Beendigung66
III.Subjektiver Tatbestand67 – 93
1.Vorsatz68 – 70
2.Zueignungsabsicht71 – 86
a)Aneignungsabsicht77 – 80
b)Enteignungsvorsatz81 – 86
3.Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung87 – 93
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld94
V.Täterschaft und Teilnahme95, 96
VI.Übungsfall Nr. 197, 98
C.Besonders schwere Fälle des Diebstahls99 – 159
I.Überblick99 – 108
II.Diebstahl aus besonders geschützten Räumen, § 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 1109 – 129
1.Überblick109 – 113
2.Geschützte Räumlichkeit114 – 119
a)Umschlossener Raum114 – 116
b)Gebäude117, 118
c)Geschäftsraum119
3.Tathandlung120 – 129
a)Einbrechen121 – 123
b)Einsteigen124, 125
c)Eindringen mit einem falschen Schlüssel oder Werkzeug126 – 128
d)Sich-Verborgen-Halten129
III.Diebstahl von besonders gesicherten Sachen, § 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 2130 – 136
IV.Der gewerbsmäßige Diebstahl, § 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 3137, 138
V.Kirchendiebstahl, § 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 4139
VI.Der gemeinschädliche Diebstahl, § 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 5140
VII.„Schmarotzerdiebstahl“, § 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 6141
VIII.Diebstahl von Waffen, § 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 7142
IX.Ausschluss eines besonders schweren Falles143 – 148
X.Versuch und Regelbeispiel149 – 157
1.Der Täter hat den Diebstahl nur versucht, aber dabei eines der Regelbeispiele verwirklicht150
2.Der Täter hat den Diebstahl nur versucht und auch das Regelbeispiel nur „versucht“ (Konstellation 1) und der Täter hat den Diebstahl vollendet, aber das Regelbeispiel nur „versucht“ (Konstellation 2)151 – 157
XI.Teilnahme am Diebstahl in einem besonders schweren Fall158, 159
D.Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl, Wohnungseinbruchsdiebstahl160 – 208
I.Überblick160 – 162
II.Der Diebstahl mit Waffen und gefährlichen Werkzeugen, § 244 Abs. 1 Nr. 1a163 – 180
1.Überblick163, 164
2.Tatmittel165 – 173
a)Waffe166 – 168
b)Gefährliches Werkzeug169 – 173
3.Tathandlung: Bewusstes Beisichführen174 – 180
a)Räumliche Komponente178, 179
b)Zeitliche Komponente180
III.Diebstahl mit sonstigen Werkzeugen oder Mitteln, § 244 Abs. 1 Nr. 1b181 – 190
1.Überblick181, 182
2.Objektiver Tatbestand183 – 188
3.Subjektiver Tatbestand189, 190
IV.Bandendiebstahl, § 244 Abs. 1 Nr. 2191 – 202
1.Bande193 – 195
2.Unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds196 – 200
3.Strafbarkeit des Teilnehmers201, 202
V.Wohnungseinbruchsdiebstahl, § 244 Abs. 1 Nr. 3 und § 244 Abs. 4203 – 206
VI.Übungsfall Nr. 2207, 208
E.Schwerer Bandendiebstahl, § 244a209
F.Konkurrenzen210, 211
G.Unterschlagung, § 246212 – 241
I.Überblick212 – 215
II.Einfache Unterschlagung216 – 236
1.Objektiver Tatbestand216 – 234
a)Tatobjekt: Fremde bewegliche Sache217
b)Tathandlung: Sich oder einem Dritten zueignen218 – 233
c)Rechtswidrigkeit der Zueignung234
2.Subjektiver Tatbestand235
3.Rechtswidrigkeit und Schuld236
III.Veruntreuende Unterschlagung, § 246 Abs. 2237 – 241
H.Privilegierungen, §§ 247, 248a242 – 247
I.Strafantrag, § 247243, 244
II.Strafantrag, § 248a245 – 247
I.Raub, § 249248 – 296
I.Überblick248 – 255
II.Objektiver Tatbestand256 – 285
1.Fremde bewegliche Sache257
2.Wegnahme258 – 269
a)Auffassung 1261 – 264
b)Auffassung 2265 – 267
c)Diskussion268, 269
3.Nötigungsmittel270 – 278
a)Gewalt gegen eine Person271 – 275
b)Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben276 – 278
4.Finalzusammenhang279 – 285
III.Subjektiver Tatbestand286, 287
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld288
V.Täterschaft und Teilnahme289 – 295
1.Aufstiftung291, 292
2.Abstiftung293, 294
3.Umstiftung295
VI.Konkurrenzen296
J.Schwerer Raub, § 250297 – 327
I.Überblick297 – 300
II.Objektiver Tatbestand, § 250 Abs. 1 Nr. 1c301 – 309
1.Andere Person303
2.Gefahr einer schweren Gesundheitsbeschädigung304 – 306
3.Durch die Tat307 – 309
III.Objektiver Tatbestand, § 250 Abs. 2310 – 322
1.Raub unter Verwendung einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeuges, § 250 Abs. 2 Nr. 1310 – 316
2.Bandenraub mit Waffen, § 250 Abs. 2 Nr. 2317
3.Schwere körperliche Misshandlung, § 250 Abs. 2 Nr. 3a318 – 321
4.Gefahr des Todes, § 250 Abs. 2 Nr. 3b322
IV.Subjektiver Tatbestand323 – 325
V.Rechtswidrigkeit und Schuld326
VI.Konkurrenzen327
K.Raub mit Todesfolge, § 251328 – 352
I.Tatbestand331 – 341
1.Eintritt der Folge331, 332
2.Kausalität333
3.Unmittelbarkeitszusammenhang334 – 339
4.Leichtfertigkeit340, 341
II.Rechtswidrigkeit und Schuld342
III.Versuch und Rücktritt bei § 251343 – 347
IV.Täterschaft und Teilnahme348 – 350
V.Konkurrenzen351, 352
L.Räuberischer Diebstahl, § 252353 – 390
I.Überblick353 – 355
II.Objektiver Tatbestand356 – 369
1.Diebstahl oder Raub als Vortat357
2.Auf frischer Tat betroffen358 – 367
a)Frische Tat358 – 363
b)Betroffen364 – 367
3.Gewalt oder Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben368, 369
III.Subjektiver Tatbestand370 – 373
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld374
V.Täterschaft und Teilnahme375 – 381
VI.Qualifikation, § 250 und § 251 zwischen Vollendung und Beendigung – Abgrenzungsschwierigkeit zwischen § 249 und § 252382 – 387
VII.Konkurrenzen388 – 390
M.Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, § 316a391 – 418
I.Überblick391 – 395
II.Objektiver Tatbestand396 – 410
1.Kraftfahrzeugführer und Mitfahrer397 – 400
2.Tathandlung: Verüben eines Angriffs auf Leib, Leben oder die Entschlussfreiheit401 – 404
3.Ausnutzen der besonderen Verhältnisse des Straßenverkehrs405 – 410
III.Subjektiver Tatbestand411 – 413
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld414
V.Erfolgsqualifikation, § 316a Abs. 3415
VI.Konkurrenzen416
VII.Übungsfall Nr. 3417, 418
N.Sachbeschädigung419 – 439
I.Überblick419 – 425
II.Objektiver Tatbestand426 – 437
1.Tatobjekt: fremde Sache427
2.Tathandlung/Taterfolg428 – 435
a)Beschädigen und Zerstören, § 303 Abs. 1428 – 435
b)„Rechtswidrig“, § 303 Abs. 1
3.Verändern des Erscheinungsbildes, § 303 Abs. 2436, 437
III.Subjektiver Tatbestand438
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld439
3. TeilStraftaten gegen einzelne Vermögenswerte
A.Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges, § 248b440 – 454
I.Überblick440
II.Objektiver Tatbestand441 – 450
III.Subjektiver Tatbestand451
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld452
V.Täterschaft und Teilnahme453
VI.Konkurrenzen454
B.Pfandkehr, § 289455 – 477
I.Überblick455 – 458
II.Objektiver Tatbestand459 – 473
1.Täter460
2.Tatobjekt461 – 469
a)Nutznießungsrechte463
b)Pfandrechte464 – 467
c)Gebrauchsrechte468
d)Zurückbehaltungsrechte469
3.Tathandlung: Wegnehmen470 – 473
III.Subjektiver Tatbestand474
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld475
V.Strafantrag, § 289 Abs. 3476
VI.Konkurrenzen477
C.Betrug, § 263478 – 598
I.Einführung478 – 485
II.Objektiver Tatbestand486 – 572
1.Täuschungshandlung487 – 518
a)Ausdrückliche Täuschung496
b)Konkludente Täuschung497 – 506
c)Täuschung durch Unterlassen507 – 518
2.Irrtumserregung519 – 525
3.Vermögensverfügung526 – 551
a)Handeln, Dulden, Unterlassen528, 529
b)Vermögensbegriff530 – 544
c)Abgrenzung Trickdiebstahl – Sachbetrug545 – 551
4.Vermögensschaden552 – 572
a)Schaden trotz objektiver Kompensation557
b)Schadensgleiche Vermögensgefährdung558 – 564
c)Schaden bei bewusster Selbstschädigung565 – 567
d)Abgrenzung Dreiecksbetrug vom Diebstahl in mittelbarer Täterschaft568 – 572
III.Subjektiver Tatbestand573 – 579
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld580
V.Besonders schwere Fälle des Betruges581 – 592
1.§ 263 Abs. 3 S. 2 Nr. 1582
2.§ 263 Abs. 3 S. 2 Nr. 2583, 584
3.§ 263 Abs. 3 S. 2 Nr. 3585
4.§ 263 Abs. 3 S. 2 Nr. 4586
5.§ 263 Abs. 3 S. 2 Nr. 5587 – 591
6.§ 263 Abs. 5592
VI.Konkurrenzen593 – 596
VII.Übungsfall Nr. 4597, 598
D.Computerbetrug, § 263a599 – 633
I.Objektiver Tatbestand604 – 630
1.Die vier Tathandlungen606 – 628
a)Unrichtige Gestaltung des Programms, § 263a Abs. 1 Alt. 1606 – 608
b)Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten609, 610
c)Unbefugte Verwendung von Daten, § 263a Abs. 1 Alt. 3611 – 617
d)Exkurs: missbräuchliche Verwendung von Giro- und Kreditkarten618 – 627
e)Sonstige unbefugte Einwirkung auf den Ablauf628
2.Zwischenerfolg: Beeinflussung des Ergebnisses eines Datenverarbeitungsvorgangs629
3.Taterfolg: Vermögensschaden630
II.Subjektiver Tatbestand631
III.Rechtswidrigkeit und Schuld632
IV.Konkurrenzen633
E.Versicherungsmissbrauch, § 265634 – 647
I.Überblick634 – 636
II.Objektiver Tatbestand637 – 642
1.Versicherte Sache638, 639
2.Tathandlungen640 – 642
III.Subjektiver Tatbestand643 – 645
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld646
V.Konkurrenzen647
F.Erschleichen von Leistungen, § 265a648 – 663
I.Überblick648 – 651
II.Objektiver Tatbestand652 – 661
1.Erschleichen der Leistung eines Automaten653, 654
2.Erschleichen der Leistung eines Telekommunikationsnetzes655
3.Erschleichen des Zutritts zu einer Veranstaltung656, 657
4.Erschleichen der Beförderung durch ein Verkehrsmittel658 – 661
III.Subjektiver Tatbestand662
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld663
G.Erpressung und räuberische Erpressung, §§ 253 und 255664 – 689
I.Überblick664 – 669
II.Objektiver Tatbestand670 – 686
1.Bekannte Voraussetzungen670 – 672
2.Vermögensverfügung673 – 686
a)Der Täter nimmt eine eigene Sache unter Anwendung von Nötigungsmitteln weg680 – 683
b)Der Täter nimmt eine fremde Sache ohne Zueignungsabsicht weg684, 685
c)Der Täter nimmt mit Zueignungsabsicht eine fremde bewegliche Sache weg686
III.Subjektiver Tatbestand687
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld688
V.Konkurrenzen689
H.Untreue, § 266690 – 728
I.Überblick690 – 694
II.Objektiver Tatbestand695 – 721
1.Missbrauchsalternative, § 266 Abs. 1 Alt. 1696 – 712
a)Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten697 – 701
b)Missbrauch der dem Täter eingeräumten Befugnis702 – 708
c)Vermögensbetreuungspflicht709 – 712
2.Treuebruchstatbestand713 – 721
a)Vermögensbetreuungspflicht714 – 717
b)Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht718 – 721
III.Taterfolg: Vermögensschaden722
IV.Subjektiver Tatbestand723
V.Rechtswidrigkeit und Schuld724
VI.Täterschaft und Teilnahme725
VII.Konkurrenzen726 – 728
I.Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten, § 266b729 – 742
I.Überblick729 – 731
II.Objektiver Tatbestand732 – 735
1.Täter: Inhaber einer Kreditkarte733
2.Missbrauch der vom Aussteller eingeräumten Möglichkeit, diesen zu einer Zahlung zu veranlassen734
3.Schaden735
III.Subjektiver Tatbestand736
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld737
V.Strafantrag738
VI.Täterschaft und Teilnahme739
VII.Konkurrenzen740
VIII.Übungsfall Nr. 5741, 742
4. TeilAnschlussdelikte
A.Einführung743, 744
B.Begünstigung, § 257745 – 769
I.Überblick745 – 748
II.Objektiver Tatbestand749 – 762
1.Vortat750
2.Tathandlung: Hilfe leisten751 – 762
III.Subjektiver Tatbestand763 – 766
1.Vorsatz764
2.Vorteilssicherungsabsicht765, 766
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld767
V.Täterschaft und Teilnahme768, 769
C.Hehlerei, § 259770 – 806
I.Überblick770 – 774
II.Objektiver Tatbestand775 – 799
1.Tatobjekt776 – 785
a)Sache776
b)die ein anderer777, 778
c)durch eine gegen fremdes Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat erlangt779 – 785
2.Tathandlung786 – 799
a)Ankaufen oder sonst einem Dritten oder sich verschaffen787 – 792
b)Absetzen793 – 796
c)Absatzhilfe797 – 799
III.Subjektiver Tatbestand800 – 803
1.Vorsatz801
2.Bereicherungsabsicht802, 803
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld804
V.Täterschaft und Teilnahme sowie Konkurrenzen805, 806
D.Geldwäsche, § 261807 – 818
I.Überblick807, 808
II.Objektiver Tatbestand809 – 813
1.Tatobjekt809
2.Tathandlungen810 – 813
a)Tathandlungen gem. § 261 Abs. 1810
b)Tathandlungen gem. § 261 Abs. 2811 – 813
III.Subjektiver Tatbestand814
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld815
V.Konkurrenzen816
VI.Übungsfall Nr. 6817, 818
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Fischer
Strafgesetzbuch 70. Aufl. 2022
Jäger
Examens-Repetitorium Strafrecht Besonderer Teil 9. Aufl. 2021
Joecks/Jäger
Studienkommentar Strafgesetzbuch 13. Aufl. 2021
Krey/Hellmann/Heinrich
Strafrecht Besonderer Teil II 18. Aufl. 2021
Küper/Zopfs
Strafrecht Besonderer Teil 11. Aufl. 2022
Lackner/Kühl/Heger
Strafgesetzbuch 30. Aufl. 2023
Leipziger Kommentar
Strafgesetzbuch 12. Aufl. 2007 ff.
Maurach/Schroeder/Maiwald
Strafrecht Besonderer Teil Teilbd. 1 11. Aufl. 2019
Mitsch
Strafrecht Besonderer Teil II 3. Aufl. 2015
Münchener Kommentar
Strafgesetzbuch 2003 ff.
Otto
Grundkurs Strafrecht Die einzelnen Delikte 8. Aufl. 2015
Rengier
Strafrecht Besonderer Teil I 25. Aufl. 2023
Sonnen
Strafrecht Besonderer Teil 2005
Systematischer Kommentar
Strafgesetzbuch Band II 5.–7. Aufl. 2002
Schönke/Schröder
Strafgesetzbuch 30. Aufl. 2019
Wessels/Hettinger/Engländer
Strafrecht Besonderer Teil I 47. Aufl. 2023
Wessels/Hillenkamp/Schuhr
Strafrecht Besonderer Teil II 46. Aufl. 2023
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 4Grundlagen: Lernen, Behalten und Erinnern
Die Lern- und Gedächtnispsychologie hat einige praktische Ideen, die Ihr Lernen erleichtern werden. Sie können damit effektiver lernen, mehr behalten und später den Lernstoff wieder gut abrufen. Sie können diese Methoden und Techniken sofort in die Praxis umsetzen und deren Erfolg unmittelbar feststellen. Lerntipps gibt es zu den Themen Arbeitsplanung, Techniken zum Warmlaufen, Einteilung des Lernpensums, Pausenmanagement und positive Abschlussgestaltung. Übrigens: Sie brauchen nicht alle Tipps auf einmal anzuwenden. Testen Sie ruhig einen nach dem anderen!
Lerntipps
Fangen Sie nicht einfach an!
Viele wollen das große Arbeitspaket möglichst schnell hinter sich bringen und fangen einfach an. Verschaffen Sie sich besser zu Beginn eine Übersicht über folgende Punkte:
•
Inhalte, die erarbeitet werden müssen
•
Tätigkeiten, die erbracht werden müssen (Lesen, Schreiben, Sammeln, Gliedern, Auswendiglernen)
•
Benötigte Arbeitszeiten
•
Dringlichkeit und Priorisierung einzelner Inhalte und Tätigkeiten
Schreiben Sie auf Arbeitskarten (Karteikartengröße), welche Arbeiten im folgenden Zeitabschnitt von ca. 2 bis 4 Stunden zu erledigen sind. Sie können das Ganze in eine optimale Reihenfolge bringen und an eine Pin-Wand heften. Damit bekommen Sie eine sinnvolle Ordnung, die Ihr Lernleben erleichtert. Und immer, wenn eine Tätigkeit beendet ist, vernichten Sie die Zettel als positiven Abschluss. Die Planungstechnik eignet sich auch für langwierige schriftliche Ausarbeitungen sehr gut.
Machen Sie Ihren Denkapparat warm!
Ein Sportler macht sich vor Beginn des Wettkampfes warm, um körperlich, aber auch mental auf „Betriebstemperatur“ zu kommen. Ein Musiker spielt sich vor seinem Konzert ein. Auch der Denkapparat braucht eine Warmlaufphase, da zu Beginn einer Lerneinheit die Aufnahmefähigkeit noch relativ gering ist. Starten Sie also mit möglichst einfachen Tätigkeiten, Dingen, die Ihnen persönlich eher leicht von der Hand gehen.
Startarbeiten können sein:
•
Definitionen erst einmal nur durchlesen
•
Begriffe aus einem Buch zu einem Thema heraussuchen, kennzeichnen, mit Seitenzahlen versehen
•
Einfache Texte lesen
•
Karteikarten schreiben und ordnen
•
Material abheften
Bei umfassenderen Arbeiten das wiederholte Warmlaufen nicht vergessen!
Wenn Sie an einer Hausarbeit oder an einem umfangreicheren Lernstoff sitzen, starten Sie nach Pausen immer wieder neu. Sie können sich das Denken für einen Neustart erleichtern, wenn Sie sich am Ende einer Arbeitsphase kurze Merksätze notieren, was Sie nach der Pause konkret lesen, erarbeiten, vergleichen oder welche Fragen Sie beantworten wollen. Mit diesen Notizen können Sie sehr schnell wieder Gedankengänge aktivieren und in Ihr Gesamtkonzept einsteigen. Sie können aber auch die Feingliederung für den geplanten Teil noch einmal durchgehen oder zwei Seiten zurückzublättern, um sich wieder einzulesen.
Den Lernstoff in 5 bis 7 Lernportionen einteilen!
Es gibt auch beim Lernen eine optimale Menge der „akuten Lernbelastbarkeit“. Ein Lernumfang von 5 bis 7 Elementen („Chunks“) kann leicht auf einmal gespeichert werden. Wird diese Menge überschritten, ist Ihr Arbeitsspeicher (Speicherdauer 15 bis 30 Sekunden) überfordert, und es wird weniger ins Langzeitgedächtnis („Festplatte“) befördert, also behalten. „Chunks“ sind sinnvolle Gruppierungen von Informationen, – z. B. 7 Aufbauschemata, 7 Definitionen etc. Der mögliche Umfang Ihrer „Chunks“ hängt von Ihrem Vorwissen zu einem Lerngebiet ab.
Fazit für die Praxis:
•
Bereiten Sie Ihr Lernmaterial so auf, dass die Zahl von 5 bis 7 Fachbegriffen, Definitionen, Merksätzen, Kategorien nicht überschritten wird.
•
Teilen Sie umfangreicheres Material in Einheiten mit Untereinheiten (ebenfalls max. 7), die sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
•
Denn: Sinnvoll gruppiertes Material wird besser behalten als beziehungslos nebeneinanderstehendes.
•
Stabilisieren Sie das Wissen durch regelmäßiges Wiederholen in kleineren Portionen.
Testen Sie den Positionseffekt beim Lernen!
Es gibt nicht nur bevorzugte Plätze im Stadion oder Konzertsaal, sondern auch in einer Reihe von Lernelementen. Der Anfang und das Ende werden besser behalten und erinnert (Erfahrung des Autors als Coach: auch die ersten und letzten Stellenbewerber werden besser erinnert als die in der Mitte eines Bewerbungsprozesses). Stellen Sie sich vor, Sie müssen 20 Aufbauschemata oder Definitionen lernen. Die erste und die letzte Definition machen 10% des Lernmaterials aus, das Sie sich ohne besonderes Zutun besser einprägen können. Bei 2 Lernpaketen wären das 20%, bei 4 Paketen à 5 Definitionen schon 40% erleichterte Aufnahme.
Fazit für die Praxis:
•
Nutzen Sie den Vorteil, dass Anfang und Ende einer Reihe leichter behalten werden!
•
Teilen Sie Ihre Gesamtmenge in Portionen von 5 bis 7 Elementen auf, dann haben Sie entsprechend mehr Randelemente!
•
Lernen Sie die Einheiten stets mehrfach in einer jeweils anderen Reihenfolge, dadurch wird der Positionseffekt mehrfach genutzt und sie werden damit flexibler bereitgestellt!
Beseitigen Sie die „Ähnlichkeitshemmung“!
Sind Lernelemente einander sehr ähnlich, so hemmen sie sich gegenseitig beim Lernen (= Ähnlichkeitshemmung). Man kann z. B. 5 unterschiedliche Begriffe besser abspeichern als 5 ähnliche. Lernen Sie ähnliche Inhalte stets zeitlich voneinander getrennt. Sie können diese dann „verwechslungssicherer“ abrufen. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn Sie inhaltlich unterschiedliche Dinge lernen. Das ist sogar eher förderlich.
Mit verteiltem Lernen behalten Sie auf die Dauer mehr!
Unsere Aufnahmefähigkeit ist begrenzt. Das haben Sie und ich schon mehrfach festgestellt. Selbst nach einem Warmstart dürfen wir nicht mit einer gleichmäßig ansteigenden Zunahme unseres Wissens rechnen. Es mag Sie zwar enttäuschen, aber wir behalten nach längerer Lernzeit immer weniger. Wir erreichen dann ein Lernplateau, wenn wir zu lange oder zu häufig denselben Stoff wiederholen. Es wird dann oft ohne Gewinn unnötiger Energieaufwand betrieben. Es kann sogar zu einer Abnahme schon erworbenen Wissens führen. Mehrarbeit kann also auch schaden. Das Gehirn braucht zum effektiven Lernen Zeit, um neue neuronale Verknüpfungen zu bilden, damit das Lernen auch „Spuren“ hinterlässt.
Die Konsequenz heißt „verteiltes statt massiertes Lernen“, den Lernstoff also mit Zwischenpausen bearbeiten.
•
Zuerst langsam und aufmerksam lesen und nicht direkt einprägen wollen.
•
Pause: Etwas ganz anderes tun.
•
Wesentliche einzelne Begriffe und Zusammenhänge aufschreiben.
•
Pause: Wieder ganz andere Dinge tun, auch Geistiges, jedoch möglichst unähnlich zu dem bisherigen Lernstoff.
•
Wieder Begriffe und Zusammenhänge einprägen.
•
usw.
Für Definitionen und Aufbauschemata zu einem Thema sind Abstände von 20 bis 40 Minuten zu empfehlen, bei größeren Textabschnitten wie Buchkapiteln können das auch mehrere Stunden sein.
Den Lernmotor und Ihre Motivation vor Überbelastung schützen!
Die maximale Leistungsfähigkeit kann nur in einem begrenzten Zeitraum erreicht werden. Bei Überschreitung passieren Fehler, die Leistung wird gemindert und die Motivation möglicherweise dauerhafter geschädigt. Vor Eintritt in eine solche Negativphase sollten Sie ein für Sie passendes Pausenmanagement einrichten.
Generell gilt:
•
Häufige Pausen von weniger als 20 Minuten sind besonders effektiv und besser als wenige lange Pausen.
•
Pausen sollten nicht mit lernnahen Tätigkeiten oder speicherbelastenden Aktivitäten (PC-Spiele) ausgefüllt werden.
Beispiele für unterschiedliche Pausenarten, die in den Tages- und Lernablauf integriert werden sollten:
•
Abspeicherpausen (Augen zu): 10 bis 20 Sekunden nach Definitionen, Begriffen und komplexen Lerninhalten zum sicheren Abspeichern und zur Konzentration.
•
Umschaltpausen: 3 bis 5 Minuten nach ca. 20 bis 40 Minuten Arbeit, um Abstand zum vorher Gelernten zu bekommen und dadurch besser Neues aufzunehmen.
•
Zwischenpausen: 15 bis 20 Minuten nach 90 Minuten intensiver Arbeit, also nach zwei Arbeitsphasen, dient dem Erholen und Abschalten.
Und nicht vergessen:
•
Die lange Erholungspause von 1 bis 3 Stunden, z. B. mittags oder zum Feierabend nach 3 Stunden Arbeit sollten Sie ebenfalls zum richtigen Abschalten, Regenerieren, Sich-Belohnen nutzen!
Die Lernarbeit positiv abschließen!
Unsere Erinnerung behält vor allem die letzten Erlebnisse. Endet ein an und für sich schöner Abend mit einem Streit, so wird der Abend rückwirkend als unangenehm empfunden. Ein Kellner bietet uns nach dem Essen auf Rechnung des Hauses einen Espresso oder Schnaps an. Wenn wir uns erinnern, werden wir geneigt sein, das gute Essen noch besser zu erinnern. D. h. wenn eine Tätigkeit positiv beendet wird, wird sie insgesamt als positiver erlebt.
Nach einer längeren Arbeitsphase von 1 bis 3 Stunden können Sie Folgendes tun:
•
Bewusst feststellen, was Sie alles geschafft haben, beachten Sie dabei weniger die unbearbeitete Menge.
•
Vergleichen Sie, was Sie zu Beginn einer Lernphase konnten oder wussten – und was Sie nun beherrschen.
•
Legen Sie eventuell ein Karteikartensystem an, mit dem Sie sehr leicht feststellen können, was Sie können (z. B. eine Kartei mit Aufbauschemata, Definitionskartei; siehe dazu auch die Arbeitskarten aus dem ersten Lerntipp)
Jeden Tag das gleiche Ritual!
Der Abschluss eines Lerntages sollte auch symbolisch eine Zäsur setzen, analog dem Wechsel von Arbeit zu Freizeit mit der Schulklingel oder dem Kleidungswechsel nach der Arbeit.
Abschlussrituale am Ende eines Tages können sein:
•
Denken Sie bereits 10 Minuten vor dem Arbeitsende eines Tages an das Ende der Arbeit.
•
Denken Sie kurz aber bewusst darüber nach, an welcher Stelle Sie die Arbeit für heute beenden.
•
Sagen Sie sich bewusst: Für heute ist die Arbeit für mich beendet.
•
Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Geleistete.
•
Machen Sie sich kurze Notizen, welche Aspekte in der nächsten Arbeitsphase zu berücksichtigen sind. Das erleichtert den Einstieg am Folgetag.
•
Klappen Sie den Ordner bewusst zu, fahren Sie den PC bewusst herunter und sagen Sie sich „Ich habe jetzt Freizeit!“
•
Verlassen Sie den Arbeitsplatz und den Arbeitsbereich. Wenn möglich, ziehen Sie sich um.
•
Gestalten Sie dieses Abschlussritual jeden Tag!
1. TeilEinführung
1
In diesem Skript werden die Vermögensdelikte dargestellt. Die Vermögensdelikte, insbesondere Diebstahl, Betrug, Raub und räuberische Erpressung, gehören im Examen zu den „Klassikern“, weswegen Sie ihnen beim Lernen besondere Aufmerksamkeit schenken sollten!
Die Straftatbestände der Vermögensdelikte schützen die geldwerten Güter eines Rechtsgutsträgers und gehören damit zu den Straftaten, die sich gegen Individualrechtsgüter richten.
Man unterscheidet zwischen Vermögensdelikten im engeren und im weiteren Sinne. Wir werden uns in diesem Skript mit den nachfolgend dargestellten Vermögensdelikten beschäftigen, wobei die weniger examensrelevanten Delikte in der gebotenen Kürze behandelt werden.
[Bild vergrößern]
2
Zu den Vermögensdelikten im weiteren Sinne gehören die Straftatbestände, die spezielle Vermögensbestandteile schützen, so z.B. das Eigentum in § 242, das Gebrauchsrecht in § 248b, Pfandrechte in § 289 oder Gläubigerrechte in § 288.
3
Die Straftatbestände der Vermögensdelikte im engeren Sinne hingegen schützen das Vermögen in seiner Gesamtheit als Inbegriff seiner wirtschaftlichen Güter. In dieser Gruppe finden sich zum einen Delikte, die den Eintritt eines Vermögensschadens voraussetzen, wie der Betrug gem. § 263, die Untreue gem. § 266 und die Erpressung gem. § 253, zum anderen aber auch sog. Anschlussdelikte wie die Begünstigung gem. § 257 und die Hehlerei gem. § 259.
4
Selbstverständlich ist diese Einteilung nicht abschließend und auch nicht frei von Überschneidungen. So schützt der in diesem Skript ebenfalls dargestellte Tatbestand des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer gem. § 316a zum einen das Vermögen des Opfers, zum anderen aber auch die Sicherheit des Straßenverkehrs (Rechtsgut der Allgemeinheit), weswegen er bei den gemeingefährlichen Straftaten geregelt wurde.
Für die Klausur ist es wichtig, das jeweils geschützte Rechtsgut eines Straftatbestandes zu kennen, so z.B. für die teleologische (am Zweck der Norm orientierte) Auslegung eines Tatbestandsmerkmals. Auch die Möglichkeit einer rechtfertigenden Einwilligung richtet sich nach dem geschützten Rechtsgut. Vermögensdelikte, deren Tatbestände ausschließlich das Vermögen als Individualrechtsgut schützen, sind mithin einwilligungsfähig.
2. TeilStraftaten gegen das Eigentum
A.Überblick
5
Lesen Sie die soeben zitierten Normen und finden Sie selbst die Unterschiede heraus, bevor wir sie Ihnen nachfolgend erklären! Dieses „aktive Lernen“ ist die effizienteste Form der Klausurvorbereitung!
Bei den Straftaten gegen das Eigentum unterscheiden wir die Zueignungsdelikte wie Diebstahl gem. den §§ 242 ff., Raub gem. den §§ 249 ff. und Unterschlagung gem. § 246 von den Sachbeschädigungsdelikten gem. §§ 303 ff. Während die Zueignungsdelikte eine Vielzahl examenstypischer Probleme aufweisen, sind die Sachbeschädigungsdelikte weitaus weniger kompliziert.
6
Die Zueignungsdelikte setzen als Tatobjekt eine fremde, bewegliche Sache voraus. Während jedoch der Täter beim Diebstahl diese Sache einem anderen (objektiv) wegnimmt und dabei (subjektiv) nur die Absicht hat, sich diese Sache zuzueignen, besteht bei der Unterschlagung die Tathandlung schon in der (objektiven) Zueignung. Der Raub wiederum unterscheidet sich vom Diebstahl dadurch, dass der Täter zur Ermöglichung der Wegnahme ein Nötigungsmittel einsetzt.
[Bild vergrößern]
7
Bei der Sachbeschädigung gem. § 303 muss die fremde Sache als Tatobjekt nicht beweglich sein. Die Tathandlung besteht hier in einer Tauglichkeitsminderung (Abs. 1) oder in der Veränderung des Erscheinungsbildes (Abs. 2). Daneben werden in den §§ 303a ff. verschiedene Tatobjekte, wie Daten bei § 303a oder Bauwerke bei § 305, geschützt.
In der Klausur muss der Diebstahl häufig von anderen Eigentumsdelikten und vom Betrug abgegrenzt werden. Grundsätzlich gilt Folgendes:
•
War die weggenommene Sache nicht fremd, so kommt Pfandkehr gem. § 289 in Betracht.
•
Gelangt eine fremde, bewegliche Sache ohne Wegnahme in die Hände des Täters, dann kann eine Unterschlagung gem. § 246 vorliegen.
•
Setzt der Täter bei der Wegnahme Gewalt oder Drohung ein, so kann ein Raub gem. § 249 vorliegen.
•
Übergibt das Opfer täuschungsbedingt die Sache an den Täter, so ist Betrug gem. § 263 möglich.
•
Nimmt der Täter die Sache ohne Zueignungsabsicht weg, so kann Gebrauchsanmaßung (strafbar nur bei § 248b) oder Sachbeschädigung gem. § 303 in Betracht kommen.
B.Diebstahl, § 242
I.Überblick
8
Beim Diebstahl ist das geschützte Rechtsgut nach h.M. das Eigentum an der Sache unabhängig von ihrem Wert. Dem Eigentümer steht das Recht zu, mit der Sache nach Belieben zu verfahren und jeden Dritten vom Umgang mit der Sache auszuschließen, § 903 BGB.[1]
§ 242 normiert den Grundtatbestand des Diebstahls. § 243 ist als Strafzumessungsnorm zum einfachen Diebstahl nach der Schuld zu prüfen und enthält Regelbeispiele für besonders schwere Fälle des Diebstahls. Die §§ 244 und 244a sind Qualifikationen zu § 242 und stellen besonders gefährliche Begehungsweisen oder Diebstähle in besonders geschützten Begehungsorten unter eine erhöhte Strafandrohung. Privilegierungen sind in den §§ 247 und 248a enthalten. Allerdings haben diese Privilegierungen keine Tatbestandsqualität. Sie normieren ausschließlich Strafantragserfordernisse und haben damit Bedeutung für die Zulässigkeit der Strafverfolgung.
[Bild vergrößern]
9
Der Diebstahl wird wie folgt geprüft:
II.Objektiver Tatbestand
10
Der objektive Tatbestand besteht in der Wegnahme einer fremden beweglichen Sache. Die Prüfung des objektiven Tatbestands erfolgt mithin in 2 Schritten:
Schritt 1a
Schritt 1b
Schritt 1c
Schritt 2
Sache
beweglich
fremd
wegnehmen
1.Tatobjekt: fremde bewegliche Sache
a)Sache
11
Der Begriff der „Sache“ kann gelegentlich in der Prüfung problematisch werden, so vor allem, wenn es um die Bestimmung der Sachqualität des menschlichen Körpers und seiner (abtrennbaren) Teile geht. Die Definition orientiert sich zunächst einmal am Zivilrecht.
Sachen sind gem. § 90 BGB alle körperlichen Gegenstände.[2]
12
Auf den wirtschaftlichen Wert einer Sache kommt es dabei ebenso wenig an wie auf den Aggregatzustand, so dass auch Flüssigkeiten als Tatobjekt in Betracht kommen. Zur Körperlichkeit gehört jedoch, dass der Gegenstand eine Begrenzung aufweisen und infolgedessen aus seiner Umgebung hervortreten muss.[3]
Freie atmosphärische Luft, Meereswasser, Schnee stellen keine Sachen dar, solange sie nicht z.B. in Flaschen abgefüllt sind. Andererseits kann das Ausstreuen von Unkrautsamen auf ein roggenbestelltes Feld eine Sachbeschädigung am Feld im Sinne des § 303 darstellen, da das Feld eine räumliche Abgrenzung aufweist und erkennbar aus seiner Umwelt hervortritt.[4]
Lebensmittel, die zur Entsorgung in Containern bereitgestellt sind, sind unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Wert als „Sachen“ anzusehen. Da der Eigentümer das Recht hat, mit der Sache nach Belieben zu verfahren, hat er auch das Recht, Sachen zu entsorgen, die anderweitig noch verwendet werden könnten.[5]
13
Tiere werden im Strafrecht als Sachen angesehen und unterfallen damit dem strafrechtlichen Eigentumsschutz. § 90a BGB („Tiere sind keine Sachen“) bezieht sich insoweit nur auf die Rechtsstellung von Tieren im Zivilrecht.[6]
14
Forderungen, Rechte und Daten sind keine körperlichen Gegenstände und damit kein taugliches Diebstahlsobjekt.
Werden also Bankdaten auf eine CD gebrannt, dann begeht der Täter keinen Diebstahl an den Daten. Es kommt aber eine Strafbarkeit gem. § 202a in Betracht. Verkauft er diese Daten dann später an das Land NRW, dann begeht der zuständige Amtsträger keine Hehlerei gem. § 259, da die Daten keine „Sachen“ sind, die ein anderer erlangt hat. Er kann sich aber wegen Datenhehlerei gem. § 202d strafbar gemacht haben, wobei allerdings Abs. 3 Nr. 1 die Strafbarkeit für solche Handlungen ausschließt, mit denen „Daten ausschließlich der Verwertung in einem Besteuerungsverfahren, einem Strafverfahren oder einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zugeführt werden sollen“.
Auch elektrische Energie ist keine Sache, wird aber über § 248c geschützt. Allerdings kann ein Diebstahl an der Urkunde, die eine Forderung oder ein Recht verkörpert, einer Batterie, die Energie beinhaltet, sowie an einem USB-Stick, auf dem Daten gespeichert sind, begangen werden.
15
Der Körper des lebenden Menschen besitzt keine Sachqualität. Auch fest eingefügten, künstlichen Teilen wie dem Herzschrittmacher (Substitutiv-Implantate) kommt keine Sachqualität zu, solange sie mit ihm verbunden sind.[7] Bei abgetrennten natürlichen oder künstlichen Körperteilen wird die Sachqualität hingegen bejaht, da das einzelne Organ oder Körperteil kein Träger der Menschenwürde mehr sei.[8]
Umstritten ist jedoch, ob dies auch dann gilt, wenn der Körperbestandteil nach dem Willen des Rechtsgutsträgers wieder dem Körper zugeführt werden soll.
A lässt sich eine Woche vor einer großen Operation 1 Liter Blut entnehmen für den Fall, dass er während der OP größere Mengen Blut verliert und eine Blutspende benötigt. Krankenschwester K verkauft das Blut.
Teilweise wird hier in Übereinstimmung mit der zivilrechtlichen Rechtsprechung[9] dieser Bestandteil als funktionale Einheit mit dem Körper und damit nicht als Sache angesehen. Ein strafrechtlicher Schutz solle über § 223 gewährleistet werden.[10] Dieser Ansicht wird jedoch entgegengehalten, dass damit § 223 unzulässig ausgeweitet werde. Die Gegenauffassung bejaht daher die Sachqualität, so dass ein strafrechtlicher Schutz über §§ 242, 303 möglich ist.[11]
16
Umstritten ist ferner, ob Leichen und ihre künstlichen Bestandteile (Substitutiv-Implantate) als Sache angesehen werden können.
A arbeitet in einem städtischen Krematorium und durchsucht die nach einer Kremierung einer Leiche verbleibende Asche gezielt nach Edelmetallen, insbesondere Zahngold, welches er alsdann einsteckt und verkauft.[12] Hier kann A sich nur dann gem. § 242 strafbar machen, wenn das Zahngold zum einen eine Sache ist, die zum anderen auch noch im Eigentum eines anderen steht.
Die h.M. sieht menschliche Leichen und die mit ihnen fest verbundenen Teile zunächst als Sachen an.[13] Nach der Gegenauffassung sind Leichen, sofern sie zur Bestattung bestimmt sind, als Rückstand der Persönlichkeit anzusehen, deren Schutz über § 168 gewährleistet werde.[14]
Fraglich ist nun aber, ob diese Sachen eigentumsfähig sind und wenn ja, in wessen Eigentum sie dann stehen.
Leichen, die zur Bestattung vorgesehen sind, stehen in niemandes Eigentum und sind damit herrenlos.[15] Etwas anderes gilt nur für Mumien,- Moor- Anatomie- oder plastinierte Leichen.[16]Substitutiv-Implantate teilen zunächst das rechtliche Schicksal der Leiche, sind also zunächst ebenfalls herrenlos. Sie werden allerdings dann eigentumsfähig, wenn ihre feste Verbindung mit dem Leichnam gelöst wird, wie das z.B. bei einer Einäscherung der Fall ist.[17] Fraglich ist nun aber, wer das Eigentum erwirbt.
Teilweise wird vertreten, dass Supportiv-Implantate, die den Körper in seiner Funktion unterstützen, genauso behandelt werden wie nur lose mit dem Körper verbundene Gegenstände (z.B. Hörgeräte). Das bedeutet, dass der Träger Eigentum an den Implantaten erwirbt, welches im Falle des Todes auf die Erben übergehen kann.[18]
Nach anderer Auffassung kann an herrenlosen künstlichen Körperteilen im Wege der Aneignung nach § 958 Abs. 1 BGB durch Ineigenbesitznahme Eigentum erworben werden.[19]
Streitig ist nun jedoch, wem ein Aneignungsrecht an den Implantaten zusteht.
Eine Auffassung spricht wegen der Bedeutung der künstlichen Körperteile als Vermögensposition das Aneignungsrecht den Erben als Vermögensnachfolger der Verstorbenen kraft Gewohnheitsrechts zu, allerdings nur, wenn die Angehörigen dies billigen.[20] Nach anderer Auffassung steht unter Berücksichtigung des Pietätsgefühls, welches sich auch auf werthaltige Leichenteile erstrecken soll, das Aneignungsrecht den nächsten Angehörigen des Verstorbenen als Totensorgeberechtigten zu.[21] Sofern die Aneignungsberechtigtem das Recht durch Inbesitznahme nicht ausüben, bleibt die Sache herrenlos, so dass ein Diebstahl nicht möglich ist.
Aufgrund des Sachzusammenhangs wurde vorstehend bei Leichen und Körperteilen sowohl die Sacheigenschaft als auch schon die Eigentumsfähigkeit dargestellt. Achten Sie in der Klausur darauf, dass Sie beide Fragen sorgfältig voneinander trennen. Wird bereits die Sacheigenschaft verneint, ist eine Auseinandersetzung mit der Fremdheit überflüssig. Da beide Fragen kontrovers diskutiert werden, ist im Ergebnis vieles vertretbar. Wichtig ist wie immer, dass Sie das Problem benennen und die Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.
b)Beweglichkeit der Sache
17
Beweglich sind Sachen, wenn sie von einem Ort zum nächsten fortbewegt werden können.
Die Beweglichkeit der Sache dürfte Ihnen in der Klausur selten Schwierigkeiten bereiten. Achten Sie allerdings darauf, dass es auch ausreicht, wenn der Täter die Sache erst beweglich machen muss.
Bestandteile von Gebäuden, die zwar fest eingebaut sind, aber losgelöst werden können, wie z.B. Heizungskörper und Fensterrahmen, werden als bewegliche Sachen angesehen. Gleiches gilt für das Gras, welches durch Mähen beweglich gemacht werden kann.
c)Fremdheit der Sache
18
Fremd sind Sachen, wenn sie weder im Alleineigentum des Täters stehen noch herrenlos oder eigentumsunfähig sind.[22]
Nehmen Sie sich Ihr Zivilrechtsskript zur Hand und wiederholen Sie die Voraussetzungen des Eigentumserwerbs bzw. -verlustes!
Die Fremdheit wird ausschließlich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über den Erwerb und Verlust von Eigentum bestimmt. Schon aus diesem Grund ist der Diebstahl in der Klausur und der mündlichen Prüfung ein beliebtes Thema, weil Sie an dieser Stelle unter Beweis stellen müssen, dass Sie „fachübergreifende“ Kenntnisse haben! Die nachfolgend dargestellten zivilrechtlichen Begrifflichkeiten sollten Ihnen von daher bekannt sein.
19
Eine Sache steht im Alleineigentum des Täters, wenn weder Mit- oder Gesamthandseigentum noch Vorbehalts- oder Sicherungseigentum eines anderen besteht. Ein mögliches Anwartschaftsrecht des Täters entlastet ihn nicht, da dieses Recht dem Vollrecht nicht gleichzusetzen ist. Hingegen geht durch Verpfändung oder Beschlagnahme das Eigentum nicht verloren.
Im Zuge einer bevorstehenden Trennung nimmt Ehemann E den kurz zuvor von ihm erworbenen Fernseher mit. Sofern E in Gütergemeinschaft mit seiner Frau F lebt, steht der Fernseher im Gesamthandseigentum und ist damit für E fremd. Lebt E hingegen in Zugewinngemeinschaft mit F, so gelten die allgemeinen sachenrechtlichen Regelungen. Hat E den Fernseher nicht zugleich auch stellvertretend für seine Frau mit erworben, so steht der Fernseher in seinem Alleineigentum und ist für ihn nicht fremd. Hat E allerdings mit dem Verkäufer eine Ratenzahlung unter Eigentumsvorbehalt vereinbart, dann steht der Fernseher so lange im Alleineigentum des Verkäufers, bis E die letzte Rate gezahlt hat.
20
Die Sache steht ferner im Eigentum des Täters, wenn sie ihm kurz vor oder während der Tathandlung übereignet wurde oder er sie – wenn auch unwissentlich – geerbt hat.
Klausurrelevant sind hier die sog. „Tankstellen-Fälle“, bei welchen der Täter Benzin in den Tank seines Fahrzeugs füllt und dann ohne zu bezahlen wegfährt.
Teilweise wird in der Lit. angenommen, dass durch das Herausnehmen des Zapfhahns ein Angebot sowohl auf Abschluss eines schuldrechtlichen als auch auf Abschluss eines dinglichen Vertrags seitens des Kunden unterbreitet werde, welches der Tankstelleninhaber durch Gestattung der Selbstbedienung angenommen werde.[23] Eine Strafbarkeit gem. §§ 242 und auch 246 Abs. 1 ist dann nicht mehr möglich, eine solche gem. § 263 Abs. 1 nur dann, wenn der Tankvorgang beobachtet wurde, da andernfalls keine Täuschung erfolgt und entsprechend kein Irrtum eintritt.
Überwiegend wird deswegen vertreten, dass das Benzin bis zur Bezahlung im Eigentum des Betreibers der Tankstelle verbleibt und somit für den Täter fremd ist[24], wobei eine Auffassung einen Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung annimmt[25] und eine andere[26] ähnlich dem Kauf im SB-Laden Einigung und Übereignung des Benzins erst bei Bezahlung an der Kasse bejaht.
Ein gesetzlicher Eigentumsübergang gem. §§ 947, 948 BGB kommt in der Regel nicht in Betracht, da der Tank zumeist leer sein wird, so dass der Täter nur Miteigentum erlangt.
A betankt sein Fahrzeug und fährt dann, wie von Anfang an geplant, ohne zu bezahlen davon.
Eine Strafbarkeit gem. § 242 Abs. 1 StGB ist nicht möglich, sollte gleichwohl in der Klausur angeprüft werden. Zwar ist nach überwiegender, in der Klausur zu diskutierender Auffassung das Benzin noch fremd, durch das Betanken hat aber ein Gewahrsamsübergang mit dem Willen des Betreibers stattgefunden, so dass eine Wegnahme ausscheidet.
Als nächstes müssen Sie an eine Strafbarkeit gem. § 263 Abs. 1 StGB denken. Hier hängt es nun davon ab, ob der Betreiber der Tankstelle den Vorgang mitbekommen hat oder nicht. Hat er keine Kenntnis vom Tankvorgang, dann wurde er vom Täter nicht über seine Zahlungswilligkeit getäuscht und hat sich dementsprechend auch nicht geirrt. Es verbleibt dann eine Strafbarkeit gem. § 246 Abs. 1. Hat er hingegen den Tankvorgang beobachtet, dann kommt § 263 Abs. 1 in Betracht, der den § 246 Abs. 1 verdrängt.
Hatte der Täter beim Einfüllen des Benzins noch nicht den Vorsatz, wegzufahren ohne zu bezahlen sondern entsteht dieser Vorsatz erst nachdem er gesehen hat, welche Summe er zu zahlen hat, dann scheidet § 263 Abs. 1 aus. Es liegt schon keine Täuschung über seine Zahlungswilligkeit vor, da diese zum Zeitpunkt des Tankens noch bestand. Es verbleibt dann bei § 246 Abs. 1.
21
Bei Geschäften, die gesetzlich verboten gem. § 134 BGB oder nichtig gem. § 138 BGB sind, muss das Abstraktionsprinzip beachtet werden, wonach die Nichtigkeit des Kausalgeschäfts grundsätzlich die Wirksamkeit des Erfüllungsgeschäftes nicht berührt. Die sachenrechtliche Einigung ist allerdings nichtig, wenn durch das Verbot oder die Sittenwidrigkeit gerade auch die Vermögensverschiebung verhindert werden soll.[27]
A verkauft dem B Heroin für 500 € und wird danach von B überfallen, der ihm unter Vorhalten eines Messers das Geld wieder abnimmt.
Hier findet weder an den Drogen noch an dem Geld ein Eigentümerwechsel statt.[28] Das Geld ist also für B keine fremde bewegliche Sache.
Im umgekehrten Fall – A nimmt dem B unter Vorhalten eines Messers das Heroin wieder ab – ist es fraglich, ob das Heroin überhaupt verkehrsfähig und damit fremd sein kann. In der Literatur wird die Verkehrsfähigkeit von Betäubungsmitteln teilweise unter Hinweis auf das BtmG und § 134 BGB abgelehnt.[29] Nach Auffassung der h.M. und auch des BGH können Betäubungsmittel allerdings eigentumsfähig sein.[30] Eigentum kann danach jedenfalls der Produzent oder aber der Verarbeiter erwerben, ggf. je nach dem Recht des Landes, in welchem die Betäubungsmittel hergestellt und zunächst weiter veräußert werden, auch die ersten Käufer/Verkäufer.
22
Zu beachten ist, dass zivilrechtliche Rückwirkungsfiktionen nicht auf das Strafrecht übertragen werden dürfen.[31] Maßgeblich bei der Beurteilung der Strafbarkeit ist ausschließlich der tatsächliche und rechtliche Zustand zum Zeitpunkt der Vornahme der Tathandlung.
A hat B ein Auto verkauft und das Eigentum hieran gem. § 929 BGB an B übertragen. Allerdings beruhten die Willenserklärungen des B auf einer arglistigen Täuschung durch A. Wenige Tage später bricht A bei B ein und nimmt das besagte Fahrzeug weg. Ficht B nunmehr die Übereignung des Autos wegen der arglistigen Täuschung an, so fingiert § 142 Abs. 1 BGB die anfängliche Nichtigkeit der Eigentumsübertragung. Danach hätte A zu keinem Zeitpunkt das Eigentum an dem Auto verloren. Diese zivilrechtliche Fiktion hilft dem A im Strafrecht jedoch nicht. Vielmehr hat er zum Tatzeitpunkt eine fremde Sache weggenommen.
23
An der Fremdheit fehlt es, wenn die Sachen herrenlos sind. Herrenlos können Sachen von Natur aus sein, so etwa wilde Tiere oder – wie bereits dargestellt – der menschliche Leichnam. Sachen können aber auch im Nachhinein durch Eigentumsaufgabe herrenlos werden (Dereliktion, § 959 BGB). Ob der Eigentumsinhaber tatsächlich das Eigentum an den betroffenen Sachen aufgegeben hat, muss stets genau geprüft werden. § 959 BGB setzt zunächst voraus, dass der Eigentümer den Besitz an den Sachen aufgibt, die nicht mehr in seinem Eigentum stehen sollen. Bei Sachen, die der Eigentümer verloren, vergessen oder verlegt hat, kommt eine Dereliktion nur dann in Betracht, wenn der Eigentümer – wenn auch nachfolgend – den Willen zur Eigentumsaufgabe fasst.
Diese Frage wird beim sog. „Containern“ relevant. Dazu folgendes
A und B hatten Lebensmitteln aus Containern einer Supermarktkette herausgenommen. Diese Container standen auf dem Grundstück der Firma im Zuliefererbereich und waren verschlossen. Die Firma hatte sie dort zur Entsorgung durch eine Fachfirma bereitgestellt.
Das BayOLG[32] und nachfolgend das BVerfG[33] haben die Fremdheit der Lebensmittel bejaht. Zunächst wurde deutlich gemacht, dass die Wertlosigkeit einer Sache Dritten nicht das Recht zur Wegnahme gewähre. Auch der Umstand, dass die Lebensmittel zur Entsorgung in einen Abfallcontainer geworfen wurden, sage, so das OLG, darüber, ob dem Eigentümer damit auch deren weiteres Schicksal gleichgültig ist, nicht zwingend etwas aus. Eine Dereliktion komme vielmehr nur dann in Betracht, wenn der Wille vorherrsche, sich der Sache ungezielt zu entledigen. Bereits dadurch, dass der, zudem auf Firmengelände und nicht etwa im öffentlichen Raum stehende, Container abgesperrt war, habe der Eigentümer für Dritte deutlich erkennbar gemacht, dass die Firma die Lebensmittel nicht dem Zugriff beliebiger Dritter anheimgeben wollte bzw. dass keine Einwilligung in eine Mitnahme bestehe. Hinzu komme, dass die Lebensmittel zur Abholung durch ein (von der Firma gesondert bezahltes) Entsorgungsunternehmen bereitgestellt waren. Ein Verzichtswille, der zur Herrenlosigkeit der Sache führt, liege aber dann nicht vor, wenn der Eigentümer das Eigentum nur zugunsten einer anderen Person (oder Organisation) aufgeben wolle.
In der Klausur wird häufig das Merkmal „fremd“ von den Studenten nicht ernst genommen und voreilig und ohne Prüfung bejaht. Nur wenn der Sachverhalt in dieser Hinsicht eindeutig ist, können Sie sich an dieser Stelle kurz fassen. Ansonsten sollten Sie sich insbesondere in Fällen der o.g. Art sorgfältig mit den zivilrechtlichen Normen auseinandersetzen.
2.Tathandlung: Wegnahme
24
Die tatbestandliche Handlung im Rahmen des § 242 ist die Wegnahme. Die Prüfung der Wegnahme stellt neben der Prüfung der Zueignungsabsicht in der Klausur meistens die größte Herausforderung dar.
25
Wegnahme bedeutet Bruch fremden und Begründung neuen, nicht notwendigerweise eigenen Gewahrsams gegen oder ohne den Willen des bisherigen Gewahrsamsinhabers.[34]
26
Entsprechend dieser Definition erfolgt die Prüfung der Wegnahme in der Klausur also in drei Schritten:
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Stand die Sache im Gewahrsam eines anderen?
Wurde dieser Gewahrsam aufgehoben und neuer Gewahrsam beim Täter oder einem Dritten begründet?
Geschah dies gegen oder ohne den Willen des bisherigen Gewahrsamsinhabers?
a)Schritt 1: Stand die Sache im Gewahrsam eines anderen?
27
Der zentrale Begriff der Wegnahme ist der Gewahrsam. Da der Gewahrsam nach „der Verkehrsauffassung“ und „den Anschauungen des täglichen Lebens“ bestimmt wird, wird von Ihnen in der Klausur verlangt werden, dass Sie mit gesundem Menschenverstand eine nachvollziehbare Argumentation zu den Gewahrsamsverhältnissen darbringen. Voraussetzung der Argumentation ist natürlich wie immer bei der Gutachtentechnik, dass Sie zunächst die Definition des Gewahrsams kennen.
28
Gewahrsam ist die von einem natürlichen Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache, deren Grenzen nach den Anschauungen des täglichen Lebens zu bestimmen sind.[35] Eine tatsächliche Sachherrschaft besteht, wenn der Gewahrsamsinhaber eine physisch-reale Einwirkungsmöglichkeit auf die Sache hat, so dass der unmittelbaren Verwirklichung des Einwirkungswillens auf die Sache keine (wesentlichen) Hindernisse entgegenstehen.[36]
29
Der Gewahrsam ist weder deckungsgleich mit dem Eigentum noch mit dem Besitz. Das Eigentum ist ein dingliches Recht und gewährt dem Eigentümer umfangreiche Einwirkungs- und Abwehrbefugnisse. Der Bestand des Eigentums ist im Gegensatz zum Gewahrsam von der tatsächlichen Einwirkungsmöglichkeit unabhängig. Beim Gewahrsam wiederum stellt sich nicht wie beim Eigentum die Frage des rechtlichen Dürfens, d.h. auch der Dieb kann bestohlen werden. Der Eigentümer und der Gewahrsamsinhaber können beim Diebstahl also auseinander fallen.
Dieb D stiehlt Eigentümer E ein wertvolles Bild und wird tags darauf von Trittbrettfahrer T in einem unbeobachteten Moment ebenfalls bestohlen.
Eigentümer E hat durch die Diebstähle sein Eigentum an dem Bild nicht verloren, hat allerdings keine tatsächliche Zugriffsmöglichkeit mehr, da er nicht weiß, wo sich das Bild befindet. D hat einen Diebstahl begangen, wobei in diesem Moment Eigentum und Gewahrsam bei derselben Person, nämlich E, vorlagen. Aber auch T hat einen Diebstahl begangen. Das Bild stand im Eigentum des E und im Gewahrsam des D, als T das Bild wegnahm.
30
Auch Besitz und Gewahrsam sind nicht identisch. So behält beispielsweise ein Autovermieter den mittelbaren Besitz an dem vermieteten Auto, hat aber, wenn er nicht weiß, wo der Kunde hingefahren ist, keine Zugriffsmöglichkeit auf das Auto, mithin auch keinen Gewahrsam mehr.
Achten Sie also in der Klausur auf die von Ihnen verwendete Terminologie! Gewahrsam ist nicht gleich Besitz oder Eigentum, kann aber aufgrund der Verkehrsanschauung aus beiden abgeleitet werden!
Bei der Wegnahme kommt es nur auf den Gewahrsamsinhaber und dessen Verdrängung aus der Gewahrsamsposition an Bei der Zueignungsabsicht hingegen kommt es nur auf den Eigentümer und dessen Verdrängung aus der Eigentümerposition an.
aa)Alleingewahrsam
31
Der Gewahrsam verlangt objektiv ein Sachherrschaftsverhältnis und subjektiv einen Sachherrschaftswillen des Gewahrsamsinhabers. Für die Beurteilung sind wie bereits ausgeführt die konkreten Umstände des Einzelfalls und die Anschauungen des täglichen Lebens maßgeblich.[37] Die Möglichkeiten, Gewahrsam zu erlangen und zu behalten, sind dabei so vielfältig wie eben jenes tägliche Leben, weswegen es unmöglich ist, sämtliche Erscheinungsformen darzustellen. Nachfolgend sollen einige „klassische“ Konstellationen besprochen werden, die mit schöner Regelmäßigkeit in Klausuren auftauchen.
32
Es gibt typische Gewahrsamssphären, in denen üblicherweise Gewahrsam an den sich dort befindenden Gegenständen besteht:
•
Das Haus, die Wohnung, das Büro, das Geschäft, das Auto oder sonstige räumlich umgrenzte Herrschaftsbereiche.
•
Der Körper, die Kleidung sowie mitgeführte Taschen, Rucksäcke u.Ä. als sog. Gewahrsamsenklave.
Dieb D verschafft sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung von Oma O. Während diese Kaffee kocht, nutzt D den unbeobachteten Moment, indem er aus dem Schreibtisch das Sparbuch der O nimmt und es in seine Jackentasche steckt.
Hier stand das Sparbuch zunächst im Gewahrsam der O, da es sich in ihrer Wohnung befand. Nach dem Einstecken des Sparbuchs in die Jackentasche befand sich das Sparbuch im Gewahrsam des D. O hingegen hat zu diesem Zeitpunkt den Gewahrsam verloren, auch wenn D – und somit auch das Sparbuch – sich noch in ihrer Gewahrsamssphäre aufhielten, da O keinen ungehinderten Zugriff mehr auf das Sparbuch hatte.
Mit der Bestimmung der jeweiligen Gewahrsamsverhältnisse wird automatisch, wie soeben gesehen, der Gewahrsamswechsel festgestellt.
33
Für die Begründung neuen Gewahrsams an einem Gegenstand bedarf es zwangsläufig der erstmaligen Herstellung einer räumlichen Nähebeziehung. Für die Aufrechterhaltung ist dies jedoch nicht erforderlich. Einmal begründeter Gewahrsam wird durch die vorübergehende Verhinderung der Ausübung der tatsächlichen Gewalt nicht aufgehoben. Man spricht in diesen Fällen von gelockertem Gewahrsam.[38]
E und B machen Urlaub auf Ischia, als Dieb D in ihre Wohnung in Köln einbricht und das Tafelsilber entwendet.
Hier haben E und B, obgleich sie sich mehrere hundert Kilometer entfernt auf einer Insel befinden, noch immer (gelockerten) Gewahrsam an sämtlichen Gegenständen, die sich in ihrer Wohnung befinden. Wenn sie wollten, so könnten sie sich jederzeit ins Flugzeug setzen und auf die Sachen zugreifen. Aus diesem Grund weist auch die Verkehrsauffassung E und B den Gewahrsam zu.
Gleiches gilt für abgestellte Autos, zur Aufbewahrung gegebene Gepäckstücke, frei herumlaufende Haustiere etc.
34
Voraussetzung für den Gewahrsam ist allerdings nicht nur das Sachherrschaftsverhältnis, sondern auch der Sachherrschaftswille (auch Gewahrsamswille genannt). Dieser Wille stellt sich als natürlicher Beherrschungswille dar und ist unabhängig von der Geschäftsfähigkeit, so dass auch Kinder und Geisteskranke ihn haben können.
35
Hohe Anforderungen sind an den Gewahrsamswillen nicht zu stellen. Es reicht auch ein sog. genereller Gewahrsamswille. So wird dem Inhaber einer Gewahrsamssphäre nach der Verkehrsauffassung grundsätzlich der Wille zugeschrieben, die tatsächliche Gewalt an allen Gegenständen auszuüben, die sich in seinem Herrschaftsbereich befinden. Ein spezialisiertes Wissen ist ebenso wenig erforderlich wie ein ständig aktualisiertes Sachherrschaftsbewusstsein.[39] Allerdings erstreckt sich der Wille nicht unbedingt auch auf mutwillig eingebrachte oder untergeschobene bzw. versteckte Gegenstände.
Der Gewahrsamswille des Kioskbesitzers K erstreckt sich auf die gesamte, in seinem Kiosk angebotene Ware, auch wenn er den aktuellen Bestand nicht überblicken kann. Der Gewahrsamswille erstreckt sich auch auf die morgens vor seiner Türe abgelegten Zeitungen. Er erstreckt sich jedoch nicht zwingend auf den Abfall, der in seinem Laden weggeworfen wird (Kaugummi auf dem Boden) und auch nicht auf Gegenstände, die in seinem Laden versteckt wurden, so z.B. eine geladene Schusswaffe, die ein Bankräuber auf der Flucht vor der Polizei hinter einigen Konservendosen im Regal versteckt hat.
36
Schlafende oder Bewusstlose haben einen „potenziellen Gewahrsamswillen“, der erst mit dem Tod des Gewahrsamsinhabers endet.
Nimmt A dem toten B eine Uhr ab, die dieser noch an seinem Arm trägt, so scheidet ein Diebstahl mangels Gewahrsamsinhaberschaft des B aus. In derartiger Fallgestaltung muss stets § 857 BGB erwähnt werden, wonach ein Erbenbesitz fingiert wird. Diese Fiktion ist allerdings nicht auf das Strafrecht übertragbar, zumal Besitz nicht deckungsgleich mit Gewahrsam ist! In Betracht kommt eine Unterschlagung gem. § 246. Mit dem Tod ist die Uhr in das Eigentum der Erben übergegangen und damit für den Täter fremd.
Hätte A dem B die Uhr im Zustand der Bewusstlosigkeit gestohlen, so läge ein Diebstahl vor, auch wenn das tatsächliche Sachherrschaftsverhältnis problematisch erscheint! Insoweit wird der Gewahrsam eher als sozial-normative Zuordnung denn als faktische Zugriffsmöglichkeit verstanden. Die Bewusstlosigkeit hebt selbst dann den Gewahrsam des Opfers nicht auf, wenn sie bis zum Tode weiter besteht.[40]