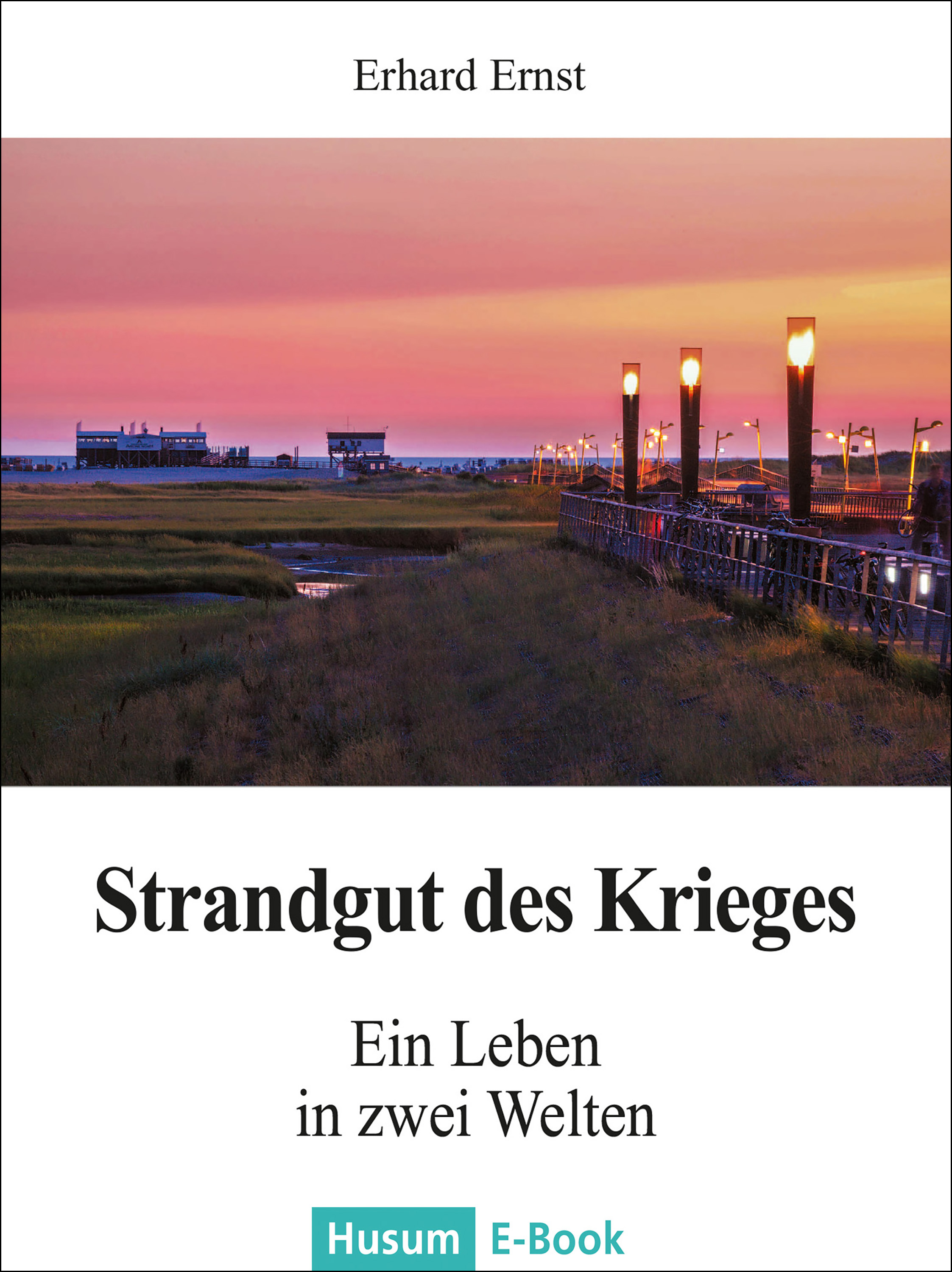
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Husum-Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Sommer 1944 in einer Kleinstadt in Ostpreußen. Der vierzehnjährige Karl Stobbe lebt in zwei Welten: mit seinen Spielkameraden in der kindlichen Welt der Hobbys und kleinen Abenteuer, und andererseits als indoktrinierter Hitlerjunge in der Verantwortung für „Führer und Volk“. Das letzte Kriegsjahr des Zweiten Weltkriegs wird seine Welten zerreißen, ihn zur Flucht zwingen und ein neues Leben eröffnen, das ihn – als „Strandgut des Krieges“ – auf die Nordseeinsel Pellworm und nach St. Peter-Ording führt. Nur mit Glück und Gottvertrauen übersteht Karl die todbringenden Bedrohungen des Kriegs und die menschenverachtenden Erfahrungen der Nachkriegsjahre. Der Roman beschwört in dramatischer Weise eine Zeit herauf, die einerseits weit entfernt von unserer Gegenwart zu sein scheint, andererseits von den ältesten unter uns lebenden Zeitgenossen wie dem Autor selbst noch erlebt und erlitten wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Motto:
„So sehr man sich auch
um die Wahrheit
bemüht“, schreibt der
französische
Schriftsteller André Gide,
„die Beschreibung des
eigenen Lebens bleibt
immer nur halb aufrichtig:
In Wirklichkeit ist alles
viel verwickelter, als es
dargestellt wird.“
ISBN 978-3-96717-011-5 (Vollständige E-Book-Version des 2020 im Husum Verlag erschienenen Originalwerkes mit der ISBN 978-3-89876-993-8) Umschlagfotos: Günter Pump © 2020 by Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG, Husum Gesamtherstellung: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft Postfach 1480, D-25804 Husum – www.verlagsgruppe.de
den Söhnen
Inhalt:
1. Teil: Mohrungen
2. Teil: Die Flucht bis Stolp
3. Teil: Die Flucht nach Gotenhafen
4. Teil: Pellworm
5. Teil: In St. Peter - die Schule
6. Teil: Sanatorium Dr. Felten
1. TeilMohrungen
Schon wieder kreischte die Schulklingel des Herder-Gymnasiums in Mohrungen an einem sonnigen Juni-Morgen des Jahres 1944. Wir hatten gerade in Erwartung des Deutschlehrers auf unseren Bänken Platz genommen. Augenblicklich sprangen wir alle auf, um in geordneter Formation das Klassenzimmer und dann das Schulgebäude schnell zu verlassen. Antreten auf dem Schulhof in einem breiten offenen Viereck zwischen den Fahnenmasten, wie wir es oft hatten üben müssen. Nur der Zeitpunkt war heute völlig ungewöhnlich, gleich nach dem eigentlichen Unterrichtsbeginn schon wieder sein Ende.
Etwas Außergewöhnliches musste passiert sein, sonst wären wir nicht hinausgeklingelt worden. Seit Wochen schon war der Schulhof unsere neue „Aula“. Die alte Aula im Anbau beherberge „Kriegsmaterial“, wie es hieß, und war für alle Schulveranstaltungen gesperrt. Ein Witzbold aus der Sekunda hatte gesagt: Kein Platz mehr für Schüler, aber viel Platz für den Krieg. Über das hier gelagerte „Material“ gingen die wildesten Gerüchte um. Die wurden auch von unserem Spielkameraden Walter Reimann verbreitet, vom Bauernhof bei der Herderstraße um die Ecke, von dem die Erwachsenen aus der Herderstraße verächtlich sagten, er habe eine sozialdemokratische Mutter. Was immer das genau bedeutete, war mir damals völlig unklar.
Walters Bemerkung zu unserer Aula ist mir unvergessen. Er flüsterte mir eines Tages ins Ohr: Die haben bestimmt einige Exemplare der V2 hier eingelagert für den baldigen Kampf um den Endsieg. Dabei hatte er das breite Reimann’sche Grinsen im Gesicht. Ob die Reimanns-Jungs solchen Quatsch zusammen mit ihrer Mutter ausheckten?
Mit seinem Stechschritt erschien augenblicklich der Direktor im großen Viereck, begrüßte uns mit dem geforderten Hitlergruß in seiner ganz eigenen Art, indem er seinen rechten Arm über Schulterhöhe durch die Luft schwenkte und dabei irgendetwas Unverständliches in seinen Vollbart brummte, was bei uns meist als „Heitler“ ankam. Damals fanden wir das komisch, heute weiß ich: Er war wohl nicht dafür. In unserer Stadt hielt sich nämlich das Gerücht, er sei strafversetzt aus der Metropole Königsberg in die Kreisstadt Mohrungen. Vielleicht war sein individuell abgewandelter Gruß Ausdruck dieser Aktion oder sein Anlass.
„Ich habe euch heute“, begann er mit seiner schnarrenden Stimme, „eine Anordnung der NSDAP-Kreisleitung mitzuteilen, die bei euch Schülern große Freude auslösen wird: Die in der nächsten Woche beginnenden Sommerferien müssen in diesem Jahr verlängert werden. Über die Länge dieser Aktion ist mir nichts mitgeteilt worden.“
Großes Freudengemurmel im Viereck, das gar nicht enden wollte.
Er fuhr nach einer der Situation angemessenen Pause fort, indem er gleichzeitig beide Hände wie zum Segnen erhob, allerdings nur, um wieder Ruhe herzustellen. Er sagte und es klang wie Anteilnahme: „Die Schule wird Lazarett!“ Das obligatorische „Weggetreten!“ löste betretenes Schweigen aus, während wir uns in die Klassenräume zerstreuten.
Unser Klassenlehrer war plötzlich an meiner Seite, klopfte mir auf die Schulter und sagte: „Karl Stobbe, du sollst dich sofort im Direktorzimmer einfinden.“ Auf mein verängstigtes Gesicht meinte er nur: „Ist nichts Schlimmes.“
Die schwere Tür zum Zimmer von Direktor Dobbeck stand einen Spalt breit offen, was ganz ungewöhnlich war, noch nie hatte ich diese Tür offen stehen gesehen. Ich hatte kaum zu klopfen begonnen, da rief er mich schon herein. Nach meinem „deutschen Gruß“, den er zu überhören schien, sagte er: „Nimm Platz, wir haben etwas Wichtiges zu besprechen.“ Die harte vordere Kante des Stuhls drückte mir in den Hintern. Ich traute mich nicht, den ganzen Stuhl zu besitzen. Kein klarer Gedanke im Kopf, nur ein undefinierbares Gefühl meiner Lage, in der in Umrissen verschwommen deutlich wurde, dass ich bisher in all den Jahren nicht einmal einen Blick in dieses Heiligtum hatte werfen können, und nun saß ich plötzlich und unerwartet mitten drin und vor ihm.
„Wir haben als Schule seit Kurzem“, begann er, „eine Seidenraupenzucht, wie du weißt, da du ja schon aktiv mitgetan hast bei der Einrichtung der Anlage. Für die Sommerferien und die schulfreie Zeit danach brauchen wir ein paar zuverlässige Schüler. Du bist mir von deinem Biologielehrer und dem Klassenlehrer dafür empfohlen worden. Deine Familie wohnt in unmittelbarer Nähe zur Schule, nur durch den kleinen Park getrennt, und lange Maulbeerhecken begrenzen die Rasenflächen zwischen eurer Wohnung und dem Park. Habe mir selbst gestern ein Bild vor Ort davon gemacht. Ich muss dazu ja nicht weit laufen, die Schulleiter-Wohnung liegt, wie jeder weiß, auf der anderen Seite des Parks.“
Der Park, die Hecken und die weiten Rasenflächen bekamen jetzt plötzlich eine andere Bedeutung. Alle Jahre bisher waren das unsere Spiellandschaften gewesen. Jetzt sollten sie mit einem Mal den Seidenraupen und damit dem Krieg dienen. Von unseren Wiesen vor dem Haus mit den hohen Maulbeerhecken gab es zwei Zuwege in den kleinen Park. Der eine war durch eine ziemlich hohe Holzpforte versperrt, die wohl nur zum Rasenmähen von der Stadtgärtnerei geöffnet werden konnte. Ich hatte dieses Tor nie offen erlebt, was auch für uns Jungens keine Rolle spielte, denn wir kletterten regelmäßig darüber weg.
Das war auch immer die Rettung für mich, wenn ich morgens spät dran war. Mit drei Griffen war das Tor überwunden, dann im Laufschritt durch das Gebüsch im Park und mit dem Klingelton in der Klasse sein, das war ein aufregender Morgensport.
Den zweiten Zugang kannten nur wir Pimpfe aus der Herderstraße. Es war eigentlich gar keiner. Den hatten wir uns durch das hier besonders dichte Buschwerk geschnitten, und weil der etwas abseits von den schmalen Kieswegen des Parks in der äußersten Südwestecke lag, konnte er vom Park aus überhaupt nicht entdeckt werden. Dieses Schlupfloch war und blieb daher unser Geheimnis.
Dieser Fluchtweg hatte uns so manches Mal vor einer gehörigen Tracht Prügel bewahrt, wenn wir wieder mal ein Soldatenpärchen mit unseren Katapulten beschossen hatten und dem jungen Soldaten unsere Eichelgeschosse auf dem nackten Hintern tanzten. Nie hatte uns auch nur einer von den so Ertappten und Aufgescheuchten ergreifen können. Immer rettete uns unser geheimes Schlupfloch.
An der Nordostseite der maulbeerbegrenzten Rasenflächen, gleich hinter dem alten Stall, gab es einen inzwischen recht verwilderten großen Garten. Er bildete die Gartenseite des alten ehemaligen Großgrundbesitzes, von dem nur noch das auch schon etwas verfallene Herrenhaus existierte, das den Garten zur Straße hin begrenzte.
Auch Park, Rasen und unser Wohnhaus hatten zu dem alten Gut gehört, wie uns alteingesessene Mohrunger mitgeteilt hatten.
Dieser Garten hinter dem Gutshaus enthielt einen weiteren Schlupfwinkel für die Reimann-Salewski-Stobbe-„Bande“. Hier diente uns nämlich eine große Holzterrasse, die weit in den Garten hineinreichte, als sicheres Versteck. Denn diese Terrasse ruhte auf Pfählen etwa einen halben Meter hoch über der Gartenfläche. An den Rändern der Terrasse waren im Laufe der Jahre allerlei Kräuter hochgewachsen, neben einigem Buschwerk, sodass es einem Fremden gar nicht in den Sinn kommen konnte, jemand könne durch die Büsche hindurch in dem schwarzen Spalt zwischen dem Erdboden und den Terrassenbrettern untertauchen. Aber genau dafür hatten wir diesen Hohlraum voller Rattenlöcher und Hundekot ausgesucht. Er war für uns das denkbar sicherste Versteck, auch ortskundigen Erwachsenen gegenüber. Keiner von ihnen wäre auf die Idee gekommen, in diesen relativ flachen schwarzen Hohlraum hineinzukriechen.
Für uns Jungens von der „Bande“ hatte gerade dieses Versteck „Lebensretter-Funktionen“, vor allem bei unseren Blechdosen-Streichen. An der gesamten Ostseite des Gutsgartens führte die Herderstraße entlang, an der auf dieser Seite weiter zur Stadt hin auch der offizielle Zugang zum Park lag, gegenüber der Herderschule auf der anderen Straßenseite.
Den Garten trennte von der Herderstraße in seiner gesamten Länge eine über zwei Meter hohe alte, vollkommen undurchsichtige Hecke, die wir Stachelhecke nannten. Wir hatten riesigen Respekt vor ihr und hielten lieber Abstand.
Dieser Abstand war aber leider nicht möglich bei der Vorbereitung unseres Streichs. Dazu war es nötig, einen dünnen Faden durch die Hecke zu legen, dessen eines Ende bis auf die Steinplatten des Bürgersteigs reichte, das andere lag in unseren Händen im Garten. Das Fadenende auf den Platten des Bürgersteigs klemmten wir dann in eine leere Blechschachtel, in der damals teure Zigaretten oder Zigarillos verkauft wurden.
Immer wenn die Abenddämmerung hereinbrach und die abgedunkelten Straßenlaternen ihr spärliches Licht ausschickten, kam unsere große Stunde. Im Frühjahr und im Herbst war unser Spaß immer am größten, weil in der frühen Dämmerung des Abends in der Regel mehr Menschen unterwegs waren als in der gleichen, viel später einsetzenden Dämmerung etwa des Sommers, und so gerieten sie im Frühjahr und im Herbst öfter in Kontakt zu unserer Blechschachtel.
Einer von uns lief dann auf der Straße umher und stieß Warnlaute aus, wenn etwa unser gefürchteter Schulleiter Dobbeck des Weges kam. Der wohnte ja nicht weit entfernt und machte häufige Spaziergänge.
Kamen zwei Fußgänger auf die Schachtel zu und der eine sagte: „Oh, schau mal, was für eine schöne Schachtel“, bückte sich, und in dem Moment, in dem er sie aufheben wollte, zogen wir sie mit einem Ruck in die Hecke.
Die Reaktionen auf diesen Vorfall waren vielfältig. Sie reichten von dem naiven: „Na nu, was war denn das? Eben lag doch hier noch diese schöne Dose“, bis zu: „Da machen wohl irgendwelche Lorbasse hinter der Hecke einen Spaß.“
Kamen allerdings Soldaten vorbei, was hier oft geschah, weil die Kasernen in unserer Gegend vor der Stadt lagen, dann mussten wir unser Heil in der Flucht unter die Holzterrasse suchen. Wenn die Blechschachtel vor ihnen wegschepperte, riefen sie schon mal: „Na, wartet, ihr Bengels, gleich haben wir euch“, sprangen seitwärts über den Zaun und mussten ohne Erfolg wieder zurück auf die Straße, denn der Letzte von uns war eben zwischen den Büschen und unter der Terrasse verschwunden. Der Garten lag still und menschenleer vor ihnen.
„Huch, was war denn das, Mensch, hab ich mich erschrocken“, und „was schepperte denn hier so schaurig?“, fragte einmal eine ältere Dame ihre Begleiterin. „Ich hab nichts gehört“, sagte die andere alte Frau.
Uns jedenfalls hatte der Blechschachtel-Streich immer riesigen Spaß gemacht, und weil wir nie erwischt wurden, ist er unser Geheimnis geblieben.
Dr. Dobbeck wartete meine Zustimmung zu meinem Seidenraupen-Einsatz gar nicht erst ab, sie war ihm von vornherein klar. Er sagte nur noch, so als Zusammenfassung: „So tritt die Herderschule jetzt unserem Führer in dieser schweren Zeit gleich zweifach helfend zur Seite, mit Seidenraupen und Lazarett. Dein Klassenlehrer wird dich im Einzelnen weiter informieren. Jetzt gehst du erst mal wieder in den Unterricht.“
Ohne sein schnarrendes „Weggetreten“ also wurde ich entlassen, und das alles dazu noch mit einem ganz freundlichen Gesicht. So hatte ich den alten Dobbeck noch nie erlebt.
„Du weißt, Karl“, sagte der Biolehrer nach der nächsten Unterrichtstunde zu mir, und schon seinem Tonfall merkte ich an, dass es ihm ganz wichtig war, was er mir zu sagen hatte: „Du weißt, die Luftwaffe braucht unsere Seide für ihre Fallschirme, und so sind wir jetzt ganz aktiv auch am Endsieg beteiligt. Du erhältst einen Hauptschlüssel für die Schule. Das ist eine große Auszeichnung. Von deinem Fähnleinführer wissen wir, dass du ein zuverlässiger Junge bist. Als Jungenschaftsführer hättest du das schon mehrfach bewiesen. Deine Aufgabe wird sein, täglich Maulbeerblätter zu pflücken und die Raupen damit zu erfreuen.“
„Für einen Biolehrer haben die Raupen offenbar sogar menschliche Eigenschaften oder so etwas Ähnliches“, dachte ich.
„Mich wirst du da auch immer mal wieder antreffen, ich bin ja offiziell für das gesamte Projekt zuständig. Aber mit meinen anderthalb Beinen kann ich die vielen Treppen nach oben in den Zeichensaal nicht jeden Tag schaffen. Ich habe euch ja im Unterricht schon kurz darüber informiert, dass der linke Unterschenkel den harten Aufprall nicht ausgehalten hat, damals vor Warschau in den ersten Kriegstagen. Der Fallschirm hatte sich wohl etwas zu spät geöffnet.
Die Seidenraupen sind daher für unsere Luftwaffe lebensnotwendig, und für mich waren sie als Fallschirm meine Lebensretter. Für den nicht geretteten Unterschenkel können die fleißigen Raupen ja nichts, war halt ein technischer Fehler.“
„Man wird nur mit solcher Kaltschnäuzigkeit mit so einem Schicksal fertig“, meinte meine Mutter, als wir meinen Seidenraupen-Dienst zu Hause besprachen.
Das eiserne Gitter des großen Schultores war geschlossen, als ich am folgenden Tag mit einem Korb voller Maulbeerblätter meine neue Arbeit verrichten wollte. Während ich mit aller Kraft versuchte, den schweren Türdrücker herunterzuziehen, was mir nicht gelingen wollte, öffnete sich die Tür der Hausmeisterwohnung. Aber es erschien nicht unser neuer Hausmeister mit seinem immer forsch vorangeschwenkten Holzbein, sondern ein Soldat in Feldgrau mit einem umgehängten Gewehr.
„Na, Kleiner, was willst du denn? Schule ist nicht. Das hast du wohl vergessen. Geh man wieder nach Hause.“
Ehe ich noch etwas sagen konnte, schwang das Holzbein durch die Tür der Hausmeisterwohnung und mit seinem freundlichen Gesicht und einem angedeuteten Lied auf den Lippen erschien der Hausmeister. Er hatte wohl die Aufforderung des Wachmanns mit dem Gewehr an mich mitbekommen, doch lieber nach Hause zu gehen. Er stellte richtig: „Der Schüler Karl Stobbe ist für die nächste Zeit einer der wichtigsten Schüler unserer geschlossenen Penne. Er versorgt die Seidenraupen oben im Zeichensaal. Anordnung vom Chef.“
Mit festen Schritten und einem Gefühl von Größe durchschritt ich das nun für mich geöffnete Tor, vorbei an der Theaterszene eines in strammer Haltung salutierenden Wachsoldaten.
Dabei fiel mir sogleich ein, dass ich in solch gelöster und sicherer Haltung in den letzten dreieinhalb Jahren wohl nur ganz selten durch dieses Tor gegangen war. Denn von Unsicherheit und Angst war der Schulalltag jener Jahre immer begleitet, von der Angst vor der nächsten Klassenarbeit in Mathe oder dem Abfragen der Vokabeln in Englisch oder in den letzten Monaten auch in Latein. Es herrschte dazu im Unterricht fast immer eine geduckte Stimmung. Die Lehrer waren sehr streng und unnachsichtig, bestraften uns oft und schmerzhaft. Die meisten von ihnen waren alte Männer, die der Führer nicht mehr gebrauchen konnte. Sie wirkten verbittert, weil ihnen das Unterrichten wohl keinen Spaß mehr machte. Der Erdkundelehrer half mit dem Schlüsselbund nach, wenn einem der Name des Flusses oder der gefragten Stadt nicht augenblicklich einfiel, indem er mit dem Schlüsselbart seines größten Schlüssels den Hinterkopf des betreffenden Schülers mehrfach druckvoll hochstrich.
Ganz anders war der Hausmeister, hatte immer ein nettes Wort für uns, war immer ansprechbar, wusste über alles in der Schule Bescheid und stakste oft mit einem wohl selbst ausgedachten Text zwischen uns in den Pausen über den Schulhof. Wenn man genau aufpasste, dann klang sein Text so:
„Ich geb dir einen guten Rat
Geh nicht nach Stalingrad:
Auf zwei Beinen gehst du rein,
zurück kommst du auf einem Bein.“
„Das ist sein Galgenhumor“, hatte unsere Mutter festgestellt, als ich versuchte, ihr den Text, so gut ich konnte, vorzubuchstabieren. „Vielleicht ist es auch gleichzeitig eine verdeckte Dankbarkeit dafür, dass er aus der Hölle von Stalingrad noch herausgeflogen wurde. Man muss sich mal bewusst machen“, meinte Mutter weiter, „was es für einen noch relativ jungen Mann bedeutet, sein ganzes vor ihm liegendes langes Leben mit dieser Verwundung, dieser Verstümmelung tagtäglich fertig zu werden. Er kann doch kaum einen handwerklichen Beruf mehr ausüben, und auch als Hausmeister ist er ja nur bedingt geeignet. Nimm mal an, er müsste aufs Dach des Anbaus, auf dieses Teerdach, um da ein Leck abzudichten.“
„Dann helfen wir ihm selbstverständlich“, war ich mir sicher.
Als ich nach der Raupenfütterung mit meinem leeren Korb den Wachsoldaten am Tor passieren wollte, trat er einige Schritte auf mich zu und sagte: „Na, hast deine Raubtiere gefüttert?“ Er hatte wohl echt Langweile und stellte mir noch ein paar ernst gemeinte Fragen zu den Raupen. Er wollte wissen, warum gerade unsere Schule eine solche Raupenzucht betreibe. Seine vier Kinder hätten nie etwas von Seidenraupen an ihren Schulen berichtet. Er stammte aus dem benachbarten Allenstein.
„Hinterm Park auf der anderen Straßenseite, wo ich wohne, gibt es lange Maulbeer-Hecken. Mein Vater hat mir erzählt, dass dieses Land hier altes Gutsgelände gewesen ist. Im vorigen Jahrhundert hat der Gutsherr hier diese Hecken anpflanzen lassen. Wahrscheinlich hat er auch Seidenraupen gezüchtet. Früher soll das ein recht gutes Geschäft gewesen sein. Jetzt dienen wir damit dem Führer.“
Ein Lächeln trat in das Gesicht des Soldaten, aber er sagte nichts. Irgendetwas Unerklärliches war für mich dabei in diesem Gesicht. Es war, als lache nur die eine Hälfte. Ich hatte wohl einen Moment zu lange in dieses Gesicht gesehen und den starren Blick des rechten Auges bemerkt.
„So guckt einer in die Welt, der nur noch ein Auge hat und wenn das zweite aus Glas ist“, sagte er, immer noch lächelnd. „Irgendwo im Schützengraben vor Kiew bin ich es losgeworden. Brauchst nicht so traurig zu gucken, Kleiner, so ist der Kampf für Führer und Vaterland auch.“
Das schmiedeeiserne Tor hatte er inzwischen geöffnet. Nachdenklich ging ich mit meinem leeren Maulbeerkorb durch den kleinen Park nach Hause.
Wenn ich mich in den nächsten Wochen dem Tor näherte, war er schnell zur Stelle, öffnete und hatte offenbar Spaß daran, zu salutieren, während ich mit meinem neuen Grünzeug an ihm vorbeimarschierte. Ich nahm automatisch ebenfalls Haltung an.
Das Hauptgebäude der Schule lag ganz am anderen Ende des staubigen Schulhofes, den ich täglich überqueren musste. Das große Feuerwehrtor direkt neben dem Gebäude stand jetzt über Tag fast immer offen. Ein Laster nach dem anderen fuhr von dort aus vor das Hauptportal und wurde hier entladen.
„Heil Hitler, Peter und Lothar“, „Heil, Karl.“ Zwei Klassenkameraden. „Wir haben uns zum Helfen gemeldet, zum Tragen der Betten, Stühle und Tische und dem anderen Krankenhaus-Kleinkram. Das machen wir schon viele Tage. Das ist zwar teilweise ganz schön anstrengend, aber alles ist besser als Schule. Und wie geht’s deinen Raupen?“
Schon waren sie vollbepackt in unserer Schule verschwunden. Ich stieg wieder die Treppen hoch. Schon vor der Tür des Zeichensaales kam mir die Raupen-Wärme entgegen. Bisher war mir die erhöhte Temperatur des Raumes noch nicht aufgefallen, die die beiden Heizsonnen produzierten. Hochsommergrade im Zeichensaal. Die ersten Raupen begannen schon, an ihren Kokons zu spinnen.
Tage vergingen. Längst waren die Lastwagen abgelöst von den Krankenwagen mit den großen roten Kreuzen. Aus den Lazarettzügen, die häufig, wenn auch in unregelmäßigen Abständen, den Bahnhof passierten, mussten immer einige Verwundete in die Autos umgeladen werden. Dringende ärztliche Hilfe war der Anlass, sie in unsere Schule zu transportieren.
Vorbei an mir mit meinem grünen Maulbeerkorb trugen die Sanitäter die Verwundeten in unsere ehemaligen Klassenräume. Auch wenn ich nur einen flüchtigen Blick erhaschte, erschrak ich über das Aussehen eines Beinamputierten oder darüber, wenn auf der einen Seite des Verwundeten die Trage leer aussah, weil der Arm fehlte.
Auch das ist das Ergebnis des Kampfes für Führer und Vaterland, kroch es in mir hoch.
Furchtbare Szenen haben sich an den Bahnsteigen des Mohrunger Bahnhofs abgespielt, wie mir Klassenkameraden berichteten, die dort Dienst taten. Immer wenn die Tür eines Eisenbahnwagens aufgemacht wurde, um einen Verwundeten in das Krankenauto zu tragen, stürmten die vielen wartenden Flüchtlinge auf die offene Tür zu, in der Hoffnung auf einen Platz im Zug. Die Sanitäter aus dem Zug mussten sie – mit verständnisvollen Blicken – dennoch immer wieder zurückdrängen. Am Bahnhof blieben die bittenden Rufe der Mütter und das weinende Geschrei ihrer Kinder zurück.
Ich hätte mir damals im Herbst jenes Jahres niemals vorstellen können, dass wir selbst in wenigen Monaten als Flüchtlinge am Mohrunger Bahnhof auf den Eisenbahnwaggon in den Westen warten würden. Ich glaubte in kindlichem Vertrauen daran, dass die angekündigten Wunderwaffen demnächst zum Einsatz kämen und die russischen Horden in ihrem Vormarsch stoppen und wieder zurückdrängen würden.
Waren nicht vielleicht Teile dieses Wunders sogar in unserer Schule schon zwischengelagert worden …
Nur wenige Wochen noch dauerte mein Gang mit dem Maulbeerkorb hinauf in den Zeichensaal, vorbei an immer einem der zwei Wachsoldaten. Sie grüßten nicht mehr militärisch stramm. Wir winkten uns wie alte Freunde zu: Sie taktierten dabei mit ihren Karabinern, ich ließ meinen Korb ein paarmal in der Luft hüpfen.
Die gefräßigen Raupen, denen ich oft bei ihren immerwährenden Fressgelagen zugesehen hatte, waren alle verschwunden in ihren selbst gesponnenen Kokons. Auf der Sammelstelle der Kreisleitung hieß es nur kurz und knapp: Jetzt helfen sie mit, den Endsieg auch aus der Luft zu erringen.
„Karl, wir brauchen dich“, riefen Peter und Lothar mir zu, gerade als mein Raupeneinsatz sich dem Ende näherte, weil die Kokons fast alle gesponnen waren. „Du sollst dich morgen in der Parteizentrale melden, aber wir können dir ja deinen neuen Einsatz mit uns zusammen schon mal verraten. Nächsten Sonnabend sollen wir nämlich den schuftenden Kameraden bei den Panzergräben wieder die Post bringen. Wir haben das schon in der letzten Woche gemacht. War ein riesiges Abenteuer. Weil Horst krank geworden ist, der immer leicht so ein bisschen schlapp macht, brauchen wir wieder einen dritten Begleiter. Das wird dir unser Fähnleinführer alles noch genauer erklären. Er hat gemeint, du wärst ein zäher kleiner Pimpf, der auch gut zupacken kann und auf den Verlass ist. Deine Raupenzucht genießt in der Zentrale nämlich großes Ansehen.“
So schloss sich mein nächster Einsatz beinahe nahtlos an die Raupen an. Sichtbar wurde darin – abgesehen von der mir offenbar zugesprochenen Eignung für Führer und Vaterland –, dass wir von unserem Untertertia-Jahrgang, also Peter, Lothar, Horst und ich, die ältesten noch in der Stadt verbliebenen Schüler waren. Alle höheren Jahrgänge von der Obertertia aufwärts waren zum Schippen der Panzergräben abkommandiert oder schon als Flakhelfer eingezogen.
Ich hatte große Lust auf das angekündigte Abenteuer. Die Erlebnisse mit den Seidenraupen waren doch eher von eintöniger Natur.
„Wieso kommen die nun ausgerechnet auf meinen kleinen Sohn für diese große Aktion durch Nacht und Wald in Richtung Nariensee!“, klagte meine Mutter. Sie nannte mich immer nur ihren Kleinen, was ich nur ihr nicht übelnahm, weil ihr Tonfall Liebe transportierte. Außerdem war es eine liebevolle Verkleinerung der Wirklichkeit, denn ich war ja das älteste und längste ihrer drei Kinder.
Als ich ihr über die Einschätzung meiner Raupenzucht bis „oben hin“ berichtete, gingen ihre Klagen in einen stolzen Ton über.
Meine Mutter teilte ja das Los aller Mütter jener Jahre: Sie musste ohne ihren Mann, unseren Vater, auskommen. Dabei waren wir noch in der glücklichen Lage, unseren Vater bis zum Anfang des Jahres 1943 zu Hause gehabt zu haben. Er war von seiner Behörde „uk-gestellt“, was mit „unabkömmlich“ zu übersetzen war. Sein Posten als Bauamtsleiter war als „kriegswichtig“ eingestuft. So musste er zunächst nicht Soldat werden. In der Folge des „totalen Krieges“ galten dann solche Bestimmungen plötzlich nicht mehr.
Unser Vater war nicht nur Leiter des Bauamtes von Mohrungen, sondern auch ein vollkommener Baumeister. Als ich nämlich mein gewünschtes Angora-Kaninchen schließlich geschenkt bekam, sagte er nur: „Jetzt muss dieses Edel-Kaninchen auch einen zu ihm passenden Stall erhalten. Den bauen wir am Wochenende.“
Unser Vater hatte in unserer kleinen Wohnung immer ein mobiles Reißbrett zur Hand. Ganz oft holte er es aus der Ecke, baute es auf und zeichnete den gesamten Abend weiter an irgendwelchen privaten oder öffentlichen Bauten, deren Baupläne als große Pergamentrollen sowieso in allen Ecken der Wohnung standen.
„Was zeichnest du denn nun schon wieder?“, wollte ich am Abend nach dem Kaninchenkauf wissen, als Vater mal auf einem leeren Blatt begann. Seine Gegenfrage lautete: „Willst du nicht für dein schneeweißes Kaninchen einen Stall haben? Sieh mal, der entsteht jetzt hier auf dem Papier.“ Und dann folgte ein Satz, den ich von ihm schon oft gehört hatte: „Merk dir, Karlchen, man muss immer vorher eine Zeichnung machen!“
Er fügte etwas hinzu, was ich damals nicht verstanden habe: Man müsse immer vorher eine Zeichnung machen, auch wenn es sich nicht um einen Kaninchenstall handele.
Schon drei Tage später war das Holz für den Stall auf dem Hof, ein Stapel heller Bretter und Latten. Alles schien mir irgendwie schon zugeschnitten. Die Frage stellte sich, ob das auch eine Folge der vorher gemachten Zeichnung sei.
Vater bestätigte meine Vermutung, als wir nach Feierabend darüber sprachen. Ich wusste, dass er gut befreundet war mit Herbert Makowski, dem Sägewerk-Besitzer. Dieses Sägewerk war offensichtlich Mohrungens größtes Industrie-Unternehmen. Herbert habe, sagte mein Vater, wohl seinen Vorarbeiter sofort angewiesen, alles Holz nach der Zeichnung zuzuschneiden, und versprochen, zwei seiner polnischen Fremdarbeiter mit dem Holz vorbeizuschicken, wie es denn ja auch geschehen sei.
Das Wochenende stand dann ganz im Zeichen des Holzbaus. Das schöne Aussehen des Stalls kannte ich schon durch die Zeichnung auf dem Reißbrett. Dennoch bestaunte ich als Hilfsarbeiter das Voranschreiten des Objekts in der Realität.
Wunderte mich auch über seine Größe. Vater hatte an eine Behausung nicht nur allein für den einen „Wollmann“ geplant, sondern für drei Bewohner, wie ich erst jetzt erfuhr.
Die Attraktion für mich war der große herausnehmbare Holzrost, der die Kaninchen-Ködel durchfallen ließ auf eine schräg darunter gebaute Holztafel, die ebenfalls zum Säubern herausnehmbar war.
Das Dach hatte vorne über den beiden Türen einen deutlichen Überstand, um die Tiere besser vor Wind und Regen zu schützen. Auch ein ausreichendes Stück Dachpappe war vorhanden. „Hat Makowski gleich mitgeliefert“, sagte Vater.
Am Ende des zweiten Stallbau-Wochenendes war die allseits bestaunte Kaninchen-Villa fertig. Nur der Maschendraht für die Türen und die restliche Vorderseite fehlte noch, was aber das perfekte Aussehen des Ganzen nicht beeinträchtigte. Nur Wollmann musste sich noch ein paar Tage gedulden.
Oft hat mein Vater mir, schon vor meiner Pimpfenzeit, wenn ich ihn, am Reißbrett sitzend, antraf, die beiden Typen von Architekten erklärt. Es gebe solche, die sich vorwiegend mit Bauberechnungen beschäftigten, und solche, die wie er lieber zeichneten. Er versuchte mir also mit einfachen Worten seinen geliebten Beruf darzustellen, weil er wohl wünschte, dass sein ältester Sohn ihm beruflich nachfolgen möge. Er hat mich in Mohrungen auf dieses Thema nie direkt angesprochen. Erst sehr viel später – nach meinem Abitur – hat er gemeint, ich solle doch noch mal genau überlegen, ob ich wirklich Lehrer werden wolle, wo doch sein Beruf gerade jetzt so sehr zu empfehlen sei. Er hatte mich zwar machen lassen. Überzeugt hatte ihn meine Berufswahl aber erst von dem Augenblick an, als ich nach soeben bestandenem Rigorosum am Telefon zu ihm sagte, er spreche gerade mit Doktor Karl Stobbe.
Aus seiner Freude am Zeichnen erwuchs wohl auch seine Aquarell-Malerei und auch seine grafische Leidenschaft. Realistische Landschaftsdarstellung war sein bevorzugtes Thema. Auf allen Ausflügen war er immer mit Tuschkasten oder wenigstens mit einem Skizzenblock unterwegs. Noch heute hängt in unserem jetzigen Haus seine letzte Ausstellung kolorierter Grafiken, aus den Sechziger- und Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts.
Die als so wichtig erachtete Funktion unseres Vaters als Baumeister hatte noch eine befreiende Wirkung für unsere Mutter. Seit ihrer Königsberger Kindheit war sie eine regelmäßige Kirchgängerin und später auch immer ein Kirchenchor-Mitglied. In der gesamten NS-Zeit hat sie sich diese christliche Freiheit nicht nehmen lassen. Die Partei hatte dafür nicht das geringste Verständnis, ließ unsere Mutter aber gewähren. Wie mir unser Vater sehr viel später, nach dem Krieg, erzählte, hatten sich die Partei-Oberen von Mohrungen schließlich darüber lustig gemacht, dass der geachtete Bauamtsleiter eine so verbiesterte Ehefrau habe, die immer in die Kirche laufen müsse. Da er ein so angesehener Parteigenosse war, wollte man aber über diese Schwäche hinwegsehen.
Ich konnte meine Mutter in die Kirche nie begleiten, selbst wenn ich es noch so sehr gewünscht hätte. Der Sonntagvormittag galt ausschließlich der Partei. Mindestens einmal im Monat fand die sogenannte Jugendfilmstunde statt. An solch einem Tag wurde das gesamte Mohrunger Fähnlein ins Kino abkommandiert, zu dem für uns Pimpfe aufbereiteten großen deutschen nationalen Heroismus, dessen lustige Seiten auch gezeigt wurden. Wir sahen Filme wie „Quax, der Bruchpilot“, die „Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann, oder „Reitet für Deutschland“ mit Willy Birgel in den Hauptrollen. Davor die Wochenschauen von inzwischen nicht mehr nur siegreichen, aber doch standhaften deutschen Armeen, die im Osten immer mal wieder eine „Frontbegradigung“ vornehmen mussten. Wenn man diese Begradigungen auf der Karte nachvollzog, was wir spätestens in Stolp, dem ersten Stopp auf unserer Flucht in den Westen, regelmäßig taten, dann wurde selbst dem größten Optimisten klar: Frontbegradigung war der NS-Euphemismus für Rückzug. Ablesbar an den kleinen Fähnchen, die den Frontverlauf markierten.
Stets war der Sonntagvormittag auch allen möglichen Feierstunden der Partei vorbehalten mit Aufmärschen und nicht enden wollenden Reden irgendwelcher Parteigrößen. Stets gehörte zu solchen Veranstaltungen auch der Fanfarenzug unseres Fähnleins, dem ich damals angehörte, was eine ziemliche Auszeichnung bedeutete. Wenn wir unsere Stücke geschmettert hatten, mussten wir während der gesamten meist viel zu langen Feierstunden vorne neben dem Rednerpult Stellung beziehen und dort stehend regungslos verharren, die Fanfare mit dem Runen-Fanfarentuch vor den Knien haltend.
Wer von uns zum zweiten Mal umfiel und hinausgetragen werden musste, war für den Fanfarenzug nicht geeignet, musste das Instrument wieder abgeben und in seinen „Jungzug“ zurückkehren.
Als wir das vorletzte Mal, es muss irgendwann im Frühjahr gewesen sein, wieder paratstehen mussten, hatte ich Peter kurz vorher gefragt, wie er das lange Stehen aushalte. Er gehörte als Einziger neben mir aus unserer Klasse zum Fanfarenzug und sah immer nach diesem Monsterstehen völlig normal aus. Ich litt dagegen tausend Qualen. Die Füße waren alsbald eingeschlafen, die Finger kribbelten und im Kopf summten die Bienen. „Karl“, sagte er, „ich bin ständig in Bewegung, allerdings nur mit den Muskeln, hat mir mal einer aus der HJ geraten. Du musst vor allem die Bein- und Armmuskeln immer anziehen und wieder lockern, dann stehst du das wirklich leichter durch.“ Er hatte recht und meine Angst vorm Schlappmachen verflog schnell.
Jetzt also hing die Fanfare schon lange Monate im Flur an der Garderobe und war gegen den Maulbeerkorb eingetauscht und gegen die bevorstehende Versorgungsfahrt zu den Panzergräben schippenden Kameraden bei Allenstein.
Völlig unsinnig erschienen jetzt bei der immer näher heranrückenden Ostfront irgendwelche Parteiveranstaltungen zu Propagandazwecken. Der gesamte NS-Apparat schien sich auf die drängenden aktuellen Probleme eingelassen zu haben: Bewältigung der Flüchtlingsströme aus den Ostbezirken Ostpreußens – vor allem aus dem Memel-Gebiet – und die Versorgung von Verwundeten.
Als wir schließlich die vielen Päckchen und Pakete – aufgeladen am Mohrunger Bahnhof – nach wenigen Stationen südlich des Nariensees auf den kleinen Leiterwagen verladen hatten und die beiden etwas betagt aussehenden Pferde sich in Gang setzten, war die Sonne schon lange untergegangen und einer plötzlichen Dunkelheit gewichen. Geplant gewesen war eine Tagesfahrt. Der Zug, der uns am Nachmittag befördern sollte, war restlos überfüllt. Der dann angekündigte erschien überhaupt nicht. Auf Fahrpläne hatte die Bahn schon länger verzichten müssen. So begann unsere Reise nach stundenlangem Warten erst am frühen Abend. Peter und Lothar witzelten: „Statt hier auf dem Bahnhof ewig zu warten, hätten wir ja in der Zeit zu Fuß zum Nariensee gehen können.“ Ein paar Mal musste der Zug – meist auf offener Strecke – auch noch anhalten aus Gründen, die nicht genannt wurden.
An der Haltestelle am Nariensee standen schon große Haufen älterer Männer, mit Schaufeln und Spaten bewaffnet. „Wir sind nach Willnau zum Schippen abkommandiert. Der ganze Volkssturm ist auf den Beinen“, erklärte uns einer von ihnen. Weil wir etwas ungläubig guckten, meinte er noch: „Ihr habt wohl noch nicht gemerkt, dass ganz Ostpreußen schippt oder das, was noch von Ostpreußen übrig ist. Vom Pimpf und BDM-Mädel bis zu uns Alten vom Volkssturm. Alles ist Befehl von Gauleiter Koch, der aus Ostpreußen eine Panzergräben-Landschaft macht. Damit will er den russischen Vormarsch stoppen.“ So waren auch wir wieder politisch auf dem Laufenden.
„Wie lange brauchen wir denn?“, fragte ich. „Na, so gut anderthalb Stunden“, antwortete „Kutscher“ Hans aus der Klasse über uns, inzwischen zum Jungzugführer ernannt. Manches Mal hatte er früher schon mit den Reimännern und uns gespielt. Der große Hof seiner Eltern grenzte an Reimanns Besitz. Er konnte schon von klein auf mit Pferd und Wagen umgehen, was unserer Fuhre jetzt zugutekam auf den Sand- und Schotterwegen, die wir gerade erreichten.
Auf dem Kutschbrett vorne war nur noch für zwei von uns Platz, der dritte musste sich hinten zwischen die Pakete quetschen. Also wurde nach altem Brauch geknobelt mit „Stein, Papier, Schere“. Ich verlor und wurde zwischen die Pakete geknobelt.
Die Abenddämmerung war inzwischen vollständig hereingebrochen, als wir das riesige Waldgebiet vor Güldenboden erreichten. Wir bogen an einer Wegkreuzung, wo alte halb verblichene Holzschilder versuchten, immer noch eine bestimmte Richtung anzuzeigen, in den Waldweg nach Güldenboden ab. Den Wegweisern war das nicht mehr zu entnehmen, aber Hans kannte ja den Weg. Erst jetzt bemerkte ich unter dem Sitz von Hans das Gewehr, einen richtigen Karabiner, wie ich ihn bei den Wachsoldaten am schmiedeeisernen Tor unserer Schule gesehen hatte.
„Hier soll es überall Partisanen geben“, sagte Hans, so ruhig, als spräche er über die morgendliche Zuteilung der Vierfruchtmarmelade beim Frühstück. Trotzdem stieg eine kalte Angst in mir hoch.
„Aber gesehen hat sie noch keiner“, fuhr Hans fort. „Nur manchmal sind in der Nacht Schüsse zu hören, die sich bisher immer als Angstschüsse erwiesen haben, abgegeben von den rund ums Lager eingeteilten Posten. Die Jungs haben sofort Schiss in der Hose, wenn irgendwo in ihrer dunklen Nähe ein Uhu startet oder ein Reh im Unterholz raschelt.“
„Da war eben ein schwarzer Schatten vorne rechts vom Weg unter den beiden dicken Tannenbäumen“, stieß Peter mit völlig veränderter Stimme hervor. „Nun scheiß dir man nicht gleich in die Hosen, Kleiner“, beruhigte ihn Hans, während er gleichzeitig „Baldur“ in die Nacht rief, das heutige Losungswort. Tatsächlich löste sich aus den Tannen eine Gestalt und wünschte so etwas wie gute Weiterreise, jedenfalls klang es mir so. In seiner schwarzen HJ-Uniform war er besonders gut getarnt. Das Gewehr in beiden Händen haltend, rief er noch hinter uns her: „Hans, sag mal, sie sollen mich bald ablösen!“
Mensch, dachte ich im Stillen bei mir, wie der das hier im Stockdunkeln aushält! Ohne Schiss in der Hose, das könnte ich nicht. Laut sagte ich nichts.
An eine flächendeckende Dunkelheit waren wir alle in jenen Kriegsjahren gewöhnt. Das Wort und die Realität „Verdunklung“ hatten einen hohen militärisch-politischen Wert, der unser Leben nach Sonnenuntergang tagtäglich bestimmte, dem sich alle Tätigkeiten unterzuordnen hatten. Alle Motorfahrzeuge trugen Kappen vor ihren Scheinwerfern, die jeweils nur einen Lichtstreifen zuließen, was auch für Fahrräder galt.
So fuhren auch wir in unserer Postkutsche ohne jegliche Beleuchtung durch den schwarzen Wald bei Güldenboden. Hier zwischen den Bäumen war die Dunkelheit noch bedrückender als zu Hause in Mohrungen, wo es noch ein wenig Licht von den ebenfalls stark abgedunkelten Straßenlaternen gab.
Selbst wenn die Sterne hinter den Wolken mal kurz zum Vorschein kamen, erzeugten sie ein gruseliges fahles Licht, das überall um uns herum Gespenster tanzen ließ.
Zwischen Staunen und Angst schwebend, saß ich immer noch hinten auf den Paketen.
Gesprochen wurde ganz wenig. Nur die knarrenden Fahrgeräusche des Leiterwagens und das gelegentliche Schnaufen der gleichförmig vorwärts wackelnden Pferde waren unsere akustischen Begleiter.
„Jetzt sind wir gleich da.“ Und tatsächlich konnte ich erleichtert hinter der nächsten Kurve die Umrisse eines Gebäudes schemenhaft zwischen den etwas zurücktretenden Bäumen erahnen.
„Gut, dass ihr nun endlich da seid. Dann kann der UvD gleich noch die Post austeilen. Die sind gerade fertig mit dem Abendbrot. Ihr bringt den lang erwarteten Nachtisch.“ Der Leiter des Schipp-Einsatzes hatte uns also gleich am Eingangstor in Empfang genommen. Es war ein schon etwas in die Jahre gekommener, am linken Arm verwundeter Feldwebel, der daher keinen Frontdienst mehr leisten konnte und seinen restlichen Arm in einem Schultertuch umhertragen musste. Auf seinen irgendwie melodischen kurzen Pfiff, der laut zwischen den im Mund steckenden Fingern hervortrat, erschien eine ganz junge SS-Charge, nahm Haltung an und bekam den Auftrag, die Pakete und Päckchen zu verteilen.
Wir wurden entlassen mit den Worten: „Seht mal zu, dass ihr noch was zu essen kriegt.“ Und wir bewegten uns ganz schnell in Richtung des klappernden Geschirrs aus der Küche.
Die erst wenige Jahre alte, etwas zu groß geratene Schule in Güldenboden, zusammen mit der Schulleiterwohnung und einer nahe gelegenen Scheune, waren die ausreichenden Räumlichkeiten für unsere Schippaktion. Fast hundert Schüler unseres Gymnasiums, ergänzt durch die beiden obersten Klassen der Mohrunger Mittelschule, mussten ja untergebracht werden.
Für die Kuriere, also für uns, gab es ein hartes Matratzenlager gleich neben der Wachstube, in der die ganze Nacht eine funzelige Lampe brannte. An Schlaf war nicht zu denken. Ständig knallten die Türen und die Wachablösungen fanden mit großem Krach statt. Vielleicht war es auch in Wirklichkeit gar nicht so laut, es kam mir aber so vor nach der fast lautlosen Fahrt durch den Wald. Ich muss dann schließlich doch eingeschlafen sein, denn als ich wieder zu mir kam, fing es schon an zu dämmern. Als ich vom Pinkeln wieder zurückkehrte, wurde ich ungewollt Zeuge einer typischen HJ-Lager-Szene: Zwei aus der Wachstube, es waren zwei Obertertianer unserer Schule und hier als Jungzugführer tätig, hatten sich mit Zahnpastatuben versorgt. Sie schlichen gerade wie Max und Moritz zu meinen beiden noch selig schlafenden Kameraden Peter und Lothar. Mit kräftigem Druck auf die Tuben pressten sie möglichst viel Pasta in eins der Nasenlöcher der Schlafenden. Die schossen mit großem Geschrei von ihren Matratzen hoch, unter dem höllischen Gelächter der Wachhabenden. Peter und Lothar stürzten gleich weiter in den Waschraum, um das Zeugs möglichst schnell aus ihren Nasen zu kriegen.
„Das ist hier bei uns immer die Taufe der Kuriere, sei froh, Karl, dass du gerade nicht da warst. Du bleibst uns aber.“ Ich war froh. „Das brannte in der Nase wie Feuer, es konnte einem speiübel werden“, war der Kommentar der beiden mit Rache in ihren Mienen.
Auf der Rückfahrt zur Eisenbahnstation am Nariensee beförderten wir nur eine geringe Menge an Paketen und Jutebeuteln. Diese „Post Zurück“ bestand wohl nur aus dreckiger Kleidung aus den Panzergräben für Mutters Waschtag.
Was für ein einsamer märchenhafter Weg durch den Wald war doch die Fahrt bei Tageslicht. Oft standen die Bäume so dicht an dem schmalen Weg, dass wir durch einen rauschenden Blättertunnel fuhren, der auch das Tageslicht ganz stark dämpfte und nur hin und wieder einen Strahl Sonne zu uns durchließ. Dann ließ die Sonne die Blätter im hellen Licht tanzen. Spontan fiel mir das Ostpreußenlied ein, das wir bei unserer Mutter gelernt hatten und das auch hin und wieder beim Jungvolk angestimmt wurde:
„Land der dunklen Wälder
und kristall’nen Seen,
Über weite Felder
lichte Wunder geh’n …“
Schon der erste Vers dieser ersten Strophe des Liedes gab genau unsere Situation auf dem Leiterwagen wieder. Manchmal schimmerte das Wasser des Sees kurz durch die Bäume. Dass mir dieser Text gestern Nacht nicht eingefallen war, kann ich nur auf meine alle Sinne beherrschende Angst zurückführen. Da war der Wald nun wirklich dunkel und schwarz. Auch die „lichten Wunder“ hatten auf der Nachtfahrt gegen die Enge in der Brust keine Chance.
Auffallend war, dass wir weder auf der Hinfahrt noch jetzt zurück Hasen, Rehe oder Hirsche entdeckten. Sie hatten sich offensichtlich aus den Schippgebieten zurückgezogen. Ganz zu schweigen von den „Elchen“, die nur im Gedicht „steh’n und lauschen in die Ewigkeit“.





























