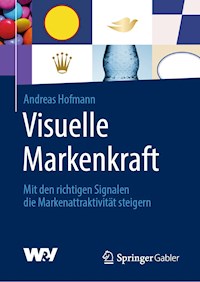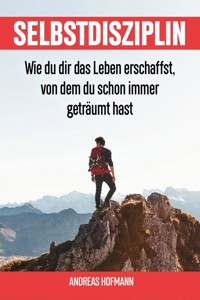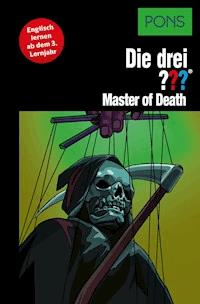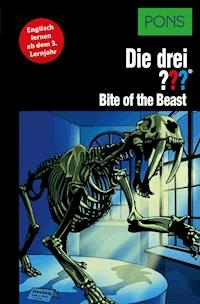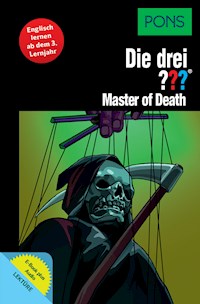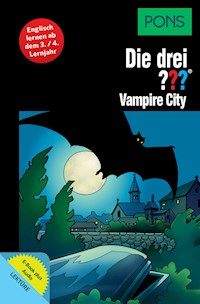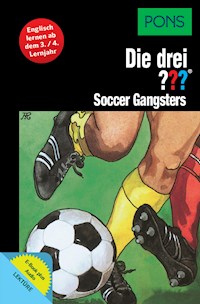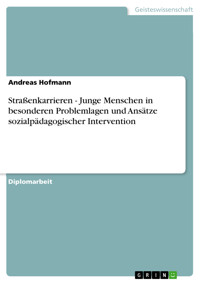
Straßenkarrieren - Junge Menschen in besonderen Problemlagen und Ansätze sozialpädagogischer Intervention E-Book
Andreas Hofmann
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Note: 1,0, Hochschule Zittau/Görlitz; Standort Görlitz, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Untersuchung von Negativkarrieren junger Menschen in Deutschland, deren Lebensmittelpunkt die Straße geworden ist. Zu Beginn der Arbeit wird zunächst eine definitorische Eingrenzung der Zielgruppe der so genannten "Straßenkinder" vorgenommen werden. Anschließend folgt ein Überblick über rechtliche Grundlagen, die im Zusammenhang mit dem Thema der Arbeit von Bedeutung sind. Im weiteren Verlauf stehen die Straßenkarrieren der Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt der Untersuchungen. Wichtige Stationen hierbei sind Ursachen, die zur Flucht auf die Straße führten, die Lebensweise auf der Straße und mögliche Interventionen, die den Ausstieg aus dem Straßenleben ermöglichen. Diese Stationen werden auf der Grundlage verschiedener Forschungsprojekte näher beschrieben und unter Zuhilfenahme geisteswissenschaftlicher Theorien analysiert. Am Ende der Darlegungen werden, in Auswertung der durch die voran-gegangenen Betrachtungen gewonnenen Erkenntnisse, grundsätzliche Richtlinien für die sozialpädagogische Arbeit mit Straßenkindern in Form von Thesen beschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Page 2
Danksagung
Es ist mir ein großes Bedürfnis, meinem verehrten Lehrer Herrn Prof. Eissing an dieser Stelle dafür zu danken, dass er mit seiner Wissensvermittlung und seiner Vorbildwirkung meine Befähigung und Liebe zum Beruf eines Sozialarbeiters/-pädagogen so entscheidend gefördert hat. Ich bin Herrn Prof. Eissing für seine fachliche Betreuung beim Abfassen dieser Diplomarbeit zu großem Dank verpflichtet. In gleicher Weise bedanke ich mich auch bei dem Zweitbetreuer Herrn Prof. Wirsing sehr herzlich.
Page 4
5 "Alltag Straße" 57
5.1 Das Leben auf der Straße 57 5.1.1 Drogenkonsum 58 5.1.2 Prostitution 60
5.1.3 Delinquentes Verhalten 62 5.2 Aufenthaltsort Straße 63 5.3 Umfang des Phänomens 65
6 Sozialpädagogische Interventionsmöglichkeiten 67
6.1 Die Arbeit der Jugendhilfe 67
6.1.1 Niederschwellige Angebote 67
6.1.2 Der Allgemeine Soziale Dienst 69
6.2 Wichtige Kooperationspartner der Jugendhilfe 70
6.2.1 Die Kooperation der Jugendhilfe mit der Polizei 71
6.2.2 Die Kooperation der Jugendhilfe mit der Schule 73
6.2.3 Die Kooperation der Jugendhilfe mit der Psychiatrie 76
7 Grundlegende Thesen für die Arbeit mit Straßenkindern 80
8 Resümee und Ausblick 85
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Page 5
Einleitung Seite 3 von 85
1 Einleitung
Ein Hauptgebiet der Sozialarbeit/-pädagogik ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Aus diesem Grund sind die nähere Betrachtung einzelner Zielgruppen innerhalb dieses Arbeitsfeldes und die daraus resultierenden Erkenntnisse für die soziale Arbeit von großem Wert.
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Untersuchung von Negativkarrieren junger Menschen in Deutschland, deren Lebensmittelpunkt die Straße geworden ist.
Zu Beginn der Arbeit soll zunächst eine definitorische Eingrenzung der Zielgruppe der so genannten "Straßenkinder" vorgenommen werden. Anschließend folgt ein Überblick über rechtliche Grundlagen, die im Zusammenhang mit dem Thema der Arbeit von Bedeutung sind.
Im weiteren Verlauf stehen die Straßenkarrieren der Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt der Untersuchungen. Wichtige Stationen hierbei sind Ursachen, die zur Flucht auf die Straße führten, die Lebensweise auf der Straße und mögliche Interventionen, die den Ausstieg aus dem Straßenleben ermöglichen. Diese Stationen werden auf der Grundlage verschiedener Forschungsprojekte näher beschrieben und unter Zuhilfenahme geisteswissenschaftlicher Theorien analysiert.
Am Ende der Darlegungen werden, in Auswertung der durch die vorangegangenen Betrachtungen gewonnenen Erkenntnisse, grundsätzliche Richtlinien für die sozialpädagogische Arbeit mit Straßenkindern in Form von Thesen be- schrieben.
Page 6
Straßenkinder - eine Begriffsdiskussion Seite 4 von 85
2 Straßenkinder - eine Begriffsdiskussion
Der Begriff "Straßenkind" wird, in der Alltagssprache gebraucht, sofort mit dem Bild eines armen, verwahrlosten, auf der Straße lebenden Kindes aus Lateinamerika oder Russland assoziiert, das ohne jegliche Hilfe täglich neu um die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse kämpfen muss. Kann man nun diesen durch die Medien gefüllten Begriff zur Beschreibung von Kindern und Jugendlichen in multikomplexen Problemlagen hier in Deutschland unreflektiert übernehmen oder beschreibt sein Inhalt das Phänomen in Deutschland nur ungenügend? Diese Fragestellung wird in der Fachliteratur der 90er Jahre heftig diskutiert.
Anfang der 90er Jahre hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ( BMfFSFJ ) zwei Forschungsprojekte finanziert, die den bis dato bestehenden Mangel an wissenschaftlich fundierten bundesdeutschen Untersuchungen beheben sollten. Das erste Projekt "Straßenkarrieren" wurde vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) durchgeführt.1Das "Aktionsprogramm Le-bensort Straße", wie das zweite Projekt genannt wurde, führte das Institut für soziale Arbeit (ISA) durch.2Mit den in diesen beiden Projekten entstandenen definitorischen Begriffsbetrachtungen versuchen die Autoren den Begriff "Straßenkinder" genauer zu beschreiben.
In der Literatur findet man bereits Anfang der 80er Jahre Untersuchungen, die sich mit den auf der Straße lebenden Kindern und Jugendlichen befassen. Ein Meilenstein der Betrachtungen in dieser Zeit ist der Bericht von Jordan & Trauernicht über Ausreißer und Trebegänger in der ehemaligen BRD.3Auch in weiteren Veröffentlichungen verschiedenster AutorInnen zu dem Begriff "Straßenkinder" finden sich immer wieder Grundsatzdiskussionen. Im Folgenden werden diese neben den definitorischen Betrachtungen der oben genannten Projektgruppen beschrieben.
1siehe 2.2
2siehe 2.3
3siehe 2.1
Page 7
Straßenkinder - eine Begriffsdiskussion Seite 5 von 85
2.1 Definitorische Betrachtungen von Jordan und Trauernicht
Jordan und Trauernicht veröffentlichten 1981 eine wissenschaftliche Abhandlung, die sich mit den Erscheinungsformen und Ursachen der Familien- und Heimflucht von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Grundlage für ihre Veröffentlichung ist ein zweisemestriges Seminar der Abteilung Sozialpädagogik des Institutes für Erziehungswissenschaften der Universität Münster in Zusammenarbeit mit dem ISA in Münster. Ziel dieses Seminars und der daraus entstandenen Texte und Berichte war es "einerseits Praktikern der sozialen Arbeit Anregungen und Impulse zur Reflexion und Verbesserung der eigenen Arbeit zu geben und andererseits Studenten und Schülern einen Zugang"1zu diesem sozialpädagogischen Problemfeld zu eröffnen. In ihrer Hinführung zum Thema beschrieben die Autoren, dass "erst die Spitze eines Eisberges gescheiterter Erziehung durch Familie, Schule, Ausbildung und Jugendhilfe, gekoppelt mit wenig förderlichen Umwelteinflüssen und Chancenstrukturen"2sichtbar geworden ist. Die Analysen über die Problemzusammenhänge und darauf bezogene sozialpädagogische Lösungsversuche standen zu dieser Zeit am Anfang und beziehen sich nur auf die ehemalige BRD.
Wie bereits erwähnt, sind die Betrachtungen von Jordan und Trauernicht ein Meilenstein der 80er Jahre, denn die Autoren waren die ersten, die eine systematische Begriffsbestimmung der Problemgruppe der auf der Straße lebenden Kinder und Jugendlichen vornahmen. Sie unterscheiden drei Typen von Betroffenen:3
DieAusreißersind Kinder und Jugendliche, die kurzfristig aus ihrer Herkunftsfamilie weglaufen und damit ein Signal für ihre Überforderung oder Verunsicherung in der aktuellen Situation geben wollen. Dieses Signal kann gleichzeitig als ein Kommunikationsversuch gedeutet werden. Mit dem Ausbruch aus der Familie, so die Autoren, kann eine
1Jordan & Trauernicht, 1981, S. 11f
2ebenda
3vgl. ebenda, S. 18 f
Page 8
Straßenkinder - eine Begriffsdiskussion Seite 6 von 85
Ablösung von der Elternfigur und die Herausbildung einer Ich-Identität einhergehen, die durchaus positive Seiten hat. Als Motivation für die kurze Flucht sind neben belastenden familiären Problemsituationen auch frustrierende Schulerfahrungen zu nennen. Diejugendlichen Treber1sind Kinder und Jugendliche, die aus massiven Konfliktlagen heraus sich von ihren bisherigen Sozialisationsinstanzen abwenden. Sie sind in der Regel ohne festen Wohnsitz und ohne reguläres Einkommen. Neben den entwicklungstypischen Konfliktlagen der Jugendphase und der damit verbundenen Identitätssuche treten hier vor allem psychosoziale Krisensituationen auf, die "Stigmatisierung, Kriminalisierung, soziale Isolation und Randgruppenexistenz einleiten oder begünstigen."2
DieAussteigersind Jugendliche, die den "Anforderungen und herrschenden Normen (der Gesellschaft, d. Verf.) durch Leistungsverweigerung, Rückzug, Desinteresse und Indifferenz zu entgehen suchen, zumeist mit der Herkunftsfamilie brechen und auch die Anforderungen und Erwartungen anderer Sozialisationsträger nicht erfüllen."3Diese Erscheinungsform ist aber strikt von den beiden erst genannten zu trennen, da die Motivation hier in einem Trend des Infragestellens der elterlichen Lebensweisen (Generationskonflikt) sowie des politischen Systems zu finden ist.
2.2 Definition des Deutschen Jugendinstitutes
Das DJI begann im Frühjahr 1994 ein Forschungsprojekt, das den Titel "Straßenkarriere von Kindern und Jugendlichen" trägt. Die qualitative Forschung umfasst 40 Interviews mit ExpertInnen von Jugendhilfe, Justiz, Polizei und
1Der Begriff "Treber" kam nach dem 1. Weltkrieg in Berlin auf. Er wurde von Fürsorgezöglingen gebraucht um diejenigen zu beschreiben, die aus den Erziehungsheimen geflohen und auf der Flucht vor Polizei und Behörden waren.
2Jordan & Trauernicht, 1981, S. 19
3ebenda
Page 9
Straßenkinder - eine Begriffsdiskussion Seite 7 von 85
anderen Institutionen, die mit so genannten Straßenkindern durch ihren Beruf Kontakt hatten, sowie zahlreiche Interviews mit betroffenen Kindern und Jugendlichen. Ziel dieses Projektes war es, fundiertes Wissen über das Phänomen "Straßenkinder" zusammenzutragen. Permien & Zink, die Leiterinnen, veröffentlichten 1995 einen Zwischenbericht und 1998 den Endbericht des Projektes.
Die Autorinnen schreiben die Einführung des Begriffes "Straßenkinder" in den 90er Jahren "findigen Medien" zu und bezeichnen ihn als einen "skandalisierenden, aus der Dritten Welt importierten Begriff"1. Für sie umfasst der Begriff "Straßenkinder" "Jugendliche, die vom gesellschaftlich vorgesehenen und akzeptierten Sozialisationsweg abweichen und auf die Straße geraten"2sind. Demzufolge wird die Straße, d.h. öffentliche Plätze, zur "wesentlichen oder auch einzigen Sozialisationsinstanz und damit zum Lebensmittelpunkt"3der Jugendlichen.
Nach den von ihnen befragten ExpertInnen handelt es sich bei dem Phänomen "Straßenkinder" um einen Begriff mit "unscharfen" Rändern.4Denn durch das "schrittweise und nicht abrupte" Entziehen der Kinder und Jugendlichen von "gesellschaftlich vorgesehenen Sozialisationsinstanzen (Familie/ Heim, Schule/ Ausbildung)"5bzw. deren Ausgrenzung und der damit verbundenen faktischen Obdachlosigkeit, wird die Festschreibung eines definitorischen Rahmens erschwert. Aufgrund dieser Tatsache führten die AutorInnen den Begriff "Straßenkarrieren" ein. Er soll verdeutlichen, dass dem endgültigen Leben auf der Straße oft verschiedene einschneidende Ereignisse mit Eltern oder anderen Familienmitgliedern, Jugendhilfe und Schule vorangegangen sind. Diese Ereignisse hatten einerseits multikomplexe Problemsituationen, denen die Kinder und Jugendlichen nicht gewachsen waren, herbeigeführt und sie beinhalteten
1Permien & Zink, 1998, S. 14
2ebenda
3DJI, 1995, S. 138
4vgl. Permien & Zink, 1998, S. 24
5ebenda
Page 10
Straßenkinder - eine Begriffsdiskussion Seite 8 von 85
andererseits Ausstiegschancen, die je nach persönlichen Ressourcen von den Kindern und Jugendlichen genutzt werden konnten.
Die befragten ExpertInnen waren sich darüber einig, "dass es keine typischen Straßenkarrieren gibt. Einstiege, Verläufe und mögliche Ausstiege sind vielmehr abhängig von einem Bündel von Faktoren, die im Einzelfall sehr unterschiedlich aussehen und kombiniert"1auftreten können. Des Weiteren ist aus den Interviews ersichtlich, dass es sich bei den KlientInnen weniger um Straßenkinder sondern überwiegend um Straßenjugendliche und junge Erwachsene handelt.
Grundsätzlich beschreibt das DJI vier Merkmale, die die Einordnung Kinder und Jugendlicher unter den Begriff "Straßenkinder" zulassen:2
- weitgehende Abkehr von gesellschaftlich vorgesehenen Sozialisationsinstanzen (Familie oder ersatzweise Jugendhilfeeinrichtungen sowie Schule)
- Hinwendung zur Straße, die zur wesentlichen oder einzigen Sozialisationsinstanz wird
- Hinwendung zum Gelderwerb auf der Straße durch die Vorwegnahme abweichenden, teilweise delinquenten Erwachsenenverhaltens"(z. B. Betteln, Raub, Prostitution, Drogenhandel)
- faktische Obdachlosigkeit
2.3 Definition des Institutes für soziale Arbeit
Das ISA startete 1995 als Reaktion auf den vom DJI vorgelegten Zwischenbericht ein Projekt "Lebensort Straße: Kinder und Jugendliche in besonderen Problemlagen". Ebenso wie das Projekt "Straßenkarrieren" vom DJI wurde auch dieses Projekt vom BMFSFJ finanziert. Allerdings beinhaltete die Zielsetzung hier weniger die reine Erforschung des Phänomens, als vielmehr die Unterstützung der Praxis bei der Entwicklung und Umsetzung verbesserter
1DJI, 1995, S. 139
2vgl. ebenda, S. 138