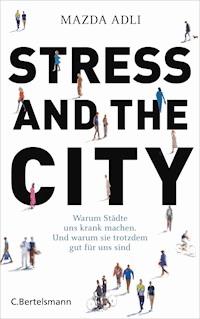
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie das Großstadtleben unsere Psyche verändert
Machen Städte krank? Schadet Stadtleben unserer Psyche? Macht nur Landleben glücklich? Provokante Fragen mit brisantem Hintergrund. Denn 2050 werden rund siebzig Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Immer mehr Millionenstädte verändern das Gesicht der Erde. Sie sind die Zentren unserer Gesellschaften. Die Menschen profitieren von der Vielfalt, den kulturellen Ressourcen und den Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung. Gleichzeitig prägen Dichte, Lärm, Hektik, Gewalt und Anonymität den urbanen Alltag. Der Arzt und Psychiater Mazda Adli fragt, wie unser Gehirn auf die permanenten Reize in der Stadt reagiert und ob uns sozialer Stadtstress krank machen kann. Urbanisierung, so sein Fazit, wird sich für unsere Gesundheit als mindestens so relevant erweisen wie der Klimawandel. Gesunde Städte zu formen wird deshalb eine immer dringendere sozial- und gesundheitspolitische Notwendigkeit. Adli plädiert für eine Neurourbanistik, einen interdisziplinären Ansatz für Wissenschaft, Kultur und Politik, um neue Visionen für unsere Städte zu entwerfen. Er sagt: Städte sind gut für uns – wir müssen nur lernen, sie zu lebenswerten Orten zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Machen Städte krank? Schadet Stadtleben unserer Psyche? Macht nur Landleben glücklich? Provokante Fragen mit brisantem Hintergrund. Denn 2050 werden rund siebzig Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Immer mehr Millionenstädte verändern das Gesicht der Erde. Sie sind die Zentren unserer Gesellschaften. Die Menschen profitieren von der Vielfalt, den kulturellen Ressourcen und den Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung. Gleichzeitig prägen Dichte, Lärm, Hektik, Gewalt und Anonymität den urbanen Alltag. Der Arzt und Psychiater Mazda Adli fragt, wie unser Gehirn auf die permanenten Reize in der Stadt reagiert und ob uns sozialer Stadtstress krank machen kann. Urbanisierung, so sein Fazit, wird sich für unsere Gesundheit als mindestens so relevant erweisen wie der Klimawandel. Gesunde Städte zu formen wird deshalb eine immer dringendere sozial- und gesundheitspolitische Notwendigkeit. Adli plädiert für eine Neurourbanistik, einen interdisziplinären Ansatz für Wissenschaft, Kultur und Politik, um neue Visionen für unsere Städte zu entwerfen. Er sagt: Städte sind gut für uns – wir müssen nur lernen, sie zu lebenswerten Orten zu machen.
Autor
Mazda Adli ist Psychiater und Psychotherapeut. Er ist Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen an der Charité. Im Zentrum seiner wissenschaftlichen Arbeit stehen die Stress- und Depressionsforschung. Nach dem Medizinstudium war er Assistenzarzt an der Klinik für Psychiatrie der Freien Universität Berlin und anschließend Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité am Campus Mitte. 2009 war Adli als Executive Director einer der Initiatoren des World Health Summit. 2010 habilitierte er sich an der Charité. Sein neuestes Projekt ist das Interdisziplinäre Forum Neurourbanistik, das er gemeinsam mit der Alfred Herrhausen Gesellschaft sowie Neurowissenschaftlern, Architekten und Stadtforschern gegründet hat.
MAZDA ADLI
Warum Städte uns krank machen.Und warum sie trotzdem gut für uns sind
Mit Illustrationen von Florian Dengler
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage© 2017 by C. Bertelsmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-16933-6V001www.cbertelsmann.de
»Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohl geht, so geht’s auch euch wohl.«
(Jeremia 29:7)
»Denn das ist das Erstaunliche, daß die große Stadt trotz aller häßlichen Gebäude, trotz des Lärmes, trotz allem, was man an ihr tadeln kann, dem, der sehen will, ein Wunder ist an Schönheit und Poesie, ein Märchen, bunter, farbiger, vielgestaltiger als irgendeines, das je ein Dichter erzählte, eine Heimat, eine Mutter, die täglich überreich verschwenderisch ihre Kinder mit immer neuem Glück überschüttet.«
August Endell: Die Schönheit der großen Stadt (1908)
Inhalt
1. Stress und Stadt. Und warum die Stadt trotzdem gut für uns ist
Wäre unser Gehirn eine Stadt
Gesundheitsrisiko Stress
Und dennoch: Stadt!
Die ideale Stadt?
2. Keiner will ihn, alle haben ihn. Was ist eigentlich Stress?
Guter Stress, schlechter Stress
Stress als Lebensretter
Wenn der Stress nicht aufhört
Interview Florian Holsboer: »Die pauschale Verteufelung von Stress ist Unsinn.«
3. Die Herausforderungen des Zusammenlebens. Sozialer Stress
Kampf um Hierarchie und Territorium
Wenn sozialer Stress krank macht
Wie der Stress in den Kopf kommt
Stadtstress im Gehirn
4. Wenn die Stadt nervt. Die Plagen des gestressten Großstädters
Das Tempo der Stadt
Lärm in der Stadt
Die Qual der Wahl
Interview Martina Löw: »Klischees sind gutes empirisches Material.«
5. Platz da! Stress im Straßenverkehr
Die Grenzen der autogerechten Stadt
Überlebensstrategien im Verkehrsgewühl
Interview Enrique Peñalosa: »… dann sollten auch alle das gleiche Recht auf den Straßenraum haben.«
6. Die dunklen Ecken der Stadt. Wenn die Stadt Angst macht
Angsträume in der Stadt
Erlernte Hilflosigkeit
Sehen und gesehen werden
Wenn die Kameras aufpassen
Wenn der Schrecken bleibt
7. Wir Stadtkinder. Vom Aufwachsen in der Stadt
Stadtleben und die Gehirnentwicklung bei Kindern
Warum die Stadt dennoch gut ist für Kinder
Zwischen Bonn und Teheran
Interview Richard Sennett: »Städte ermöglichen Menschen, mit ihrer Unvollkommenheit zu leben.«
8. Eine Geschichte ohne Ende. Warum es uns in die Städte zieht
Ich war noch niemals in New York …
Urbanisierung – eine globale Erfolgsgeschichte
Megacitys – Verstädterung ohne Grenzen
Berlin ist nicht Mumbai
Warum muss es Stadt sein?
Interview Niklas Maak: »Die Stadt wird zombifiziert.«
9. Macht Stadtluft krank? Stadt und Gesundheit
Gesundheitliche Herausforderungen in der Stadt
Gesünder auf dem Land?
Psychische Erkrankungen
Healthy Cities Movement
Mehr Grün!
Interview Joan Clos: »Die Urbanisierung hat viel Gutes bewirkt.«
10. Zu viel, zu dicht, zu allein. Sozialer Stress in der Stadt
Die Stadt als Ort der Verrohung?
Soziale Dichte
Einsam fühlt man sich nur unter Menschen
Die offene Stadt
Interview Jana Krüger: »Diese Dorfetikette ist nach wie vor da.«
11. Der Stress der anderen. Fremdsein in der Stadt
Integrationsmaschine Stadt
Integrationssackgasse Stadt
Vielfalt als Ressource
12. Mit Smartphone und Geruchskarte.Wie sich unsere Wahrnehmung in der Stadt messen lässt
Mental Map
Ein Stadtplan der Emotionen
Mit Sensoren durch die Stadt
Gerüche der Stadt
Interview Jürgen Mayer H.: »Nicht umsonst gibt es viele Architekten, die gern Ärzte geworden wären.«
13. Was wirklich zählt. Das soziale Kapital der Stadt
Und wo wohnst du?
Der Wert des Sozialen
Schattenseiten des Sozialkapitals
Mehr Zivilität!
Zivilität im Stadtbild
Interview Rainer Hehl: »Wenn man sich selbst als Akteur begreift, wird die Stadt lebendig.«
14. Großstadtskills. Von der Kunst, in der Stadt zu leben
Aneignungs- und Partizipationsbereitschaft
Alleinseinkönnen ohne Einsamkeit
Umgang mit Anonymität
Mobilitätskompetenz
Komplexitätstoleranz
Psychische Flexibilität
Online-Virtuosität
Interview Barrie Kosky: »Als hätten sie eine Operntablette genommen.«
15. Die ideale Stadt – oder lieber doch nicht?
Städte für Menschen
Verhandlung des öffentlichen Raums
Nebeneinander, Miteinander
Vertrauen und Kontrolle
Freiräume – Freiheit im Raum
Nichts ist beständiger als der Wandel
Dank
Anmerkungen
Bibliografie
Personenregister
Orts- und Sachregister
Abbildungsnachweis
1. Stress und Stadt. Und warum die Stadt trotzdem gut für uns ist
Wäre unser Gehirn eine Stadt
Wäre unser Gehirn eine Stadt, wäre es ein unerträglicher, total unübersichtlicher Großstadtmoloch, eine Megacity ungeheuren Ausmaßes, in der niemand leben wollte: breite Straßen, schmale Gässchen, völlig chaotische Kreuzungen mit häufig wechselnden Vorfahrtsregeln und einem Verkehr, der einen buchstäblich in den Wahnsinn treiben kann. Wäre unser Gehirn eine Stadt, wäre das Tempo in diesem hyperaktiven urbanen Gewebe nicht auszuhalten. So scheint es auf den ersten Blick. Wenn man aber einmal nachmisst, Elektroden am Kopf anbringt und die Hirnströme in einer Elektroenzephalographie (EEG) erfasst, dann werden doch so etwas wie eine Ordnung und eine Struktur erkennbar. Was man auf diese Weise durch die dicke knöcherne Schädeldecke erkennt, lässt sich vergleichen mit dem Blick von der Spitze eines hohen Turms auf die Stadt darunter. Das schon von Weitem vernehmbare ungeordnete Gewummer, also das EEG-Signal, folgt – wenn man genau hinhört – einer Regelmäßigkeit und einem bestimmten Rhythmus.
Je mehr wir uns mit dem Gehirn beschäftigen, desto komplizierter und undurchschaubarer wird dieses Wunderwerk – trotz moderner Hirnforschung, trotz der Riesenfortschritte der Neurowissenschaften in den letzten Jahrzehnten. Unser Gehirn ist ein hochkomplexes Organ, es besteht aus knapp 100 Milliarden Neuronen, die vielfach miteinander verschaltet sind. Es ist tatsächlich wie in einer Stadt: Manchmal wirkt das Geschehen völlig unorganisiert, und dann folgt es doch wieder einer unfassbaren Ordnung.
Eine zentrale Aufgabe des Gehirns ist es, dafür zu sorgen, dass sich sein Besitzer an Gegebenheiten seiner Umwelt anpassen kann. Dazu muss es diese Umwelt genau registrieren und auswerten. Es bekommt mit, wo sein Träger lebt. In seiner stabilen Schädelbehausung bestens geschützt, reagiert das Gehirn äußerst empfindlich darauf, in welcher Umgebung es sich befindet, ob Gefahr besteht oder nicht, ob Tag ist oder Nacht, ob sein Besitzer allein ist oder unter vielen Menschen, unter Freunden oder Familie oder unter Fremden. Es ist ihm keineswegs egal, ob er sich durch Hongkong, Berlin oder São Paulo kämpft oder morgens von Gänsen auf einem holsteinischen Bauernhof angeschnattert wird. Das Gehirn reagiert auf den Augenblick, aber auch auf größere Zeiteinheiten und wertet aus, ob wir dauerhaft Bewohner einer großen Stadt sind, ob wir auf dem Land leben, in einer armen oder einer reichen Gegend zu Hause sind und ob wir uns dort überwiegend wohlfühlen. Und das Gehirn als Ort des Gedächtnisses merkt sich dauerhaft, unter welchen Bedingungen wir aufgewachsen sind – und zwar nicht nur als Gedächtnisinhalt, über den man später einmal erzählen kann. Auch seine Funktion und vermutlich auch seine Struktur verändern sich dadurch.
Gesundheitsrisiko Stress
Der Ort, an dem wir wohnen, geht uns buchstäblich auf die Nerven. Und so fragen wir uns ständig, ob wir eigentlich dort, wo wir leben, an der richtigen Stelle sind, ob unsere Gehirne tatsächlich ideal konfiguriert sind für ein Dasein in München oder Düsseldorf, in Nauen oder Schwäbisch Hall, in Böddenstedt oder Geldersheim. Viele treibt die Frage um, ob sie eher Stadt- oder eher Landmenschen sind. Die Großstädterin mit kleinen Kindern durchsucht vielleicht gerade die Wochenendzeitungen und Immobilienportale im Internet nach einer neuen Bleibe im ruhigen Vorort oder am grünen Stadtrand. Ein anderer kann sich als interessierter Kulturmensch ein Leben außerhalb der Stadt gar nicht vorstellen. Und wieder ein anderer weiß als Landbewohner ganz genau, warum er Lärm, Gestank und Gedränge der Stadt meidet und für keinen Preis der Welt ein Leben näher an der Natur gegen ein Leben in den dichten Straßen der Städte eintauschen würde.
Tatsächlich erleben wir die Stadt immer wieder als einen Ort, wo wir uns besonders angespannt fühlen und dem wir lieber schnell entfliehen würden. Die Dichte, die vielen unachtsamen Menschen, der laute Verkehr, die Hektik – die Stadt macht uns zu schaffen, und es gibt wohl kaum einen Stadtmenschen, der nicht jeden Tag von einem kleinen Stresserlebnis erzählen könnte. Jeder verbindet mit dem Stress in der Stadt eigene Erfahrungen. Übrigens ganz gleich, ob er in der Stadt oder auf dem Land lebt. Dabei ist »Stadtstress« ein Begriff, der ambivalente Empfindungen erzeugt. Nicht ausschließlich negativ, nicht eindeutig positiv, nein: Der Begriff scheint bei den meisten einen interessanten Mix aus Meinungen, Emotionen und Erinnerungen an früher Erlebtes zu evozieren.
»Stress« und »Stressfolgen« beschäftigen uns, seitdem sich die Arbeitswelt so stark verändert hat. Nicht umsonst hat der Begriff »Burn-out« seit Mitte der 2000er-Jahre eine beispiellose Karriere durchlaufen. Gemeint ist damit der Dauerstress im Beruf. Wir stehen vor neuen Herausforderungen, die durch die Beschleunigung und Verdichtung einzelner Arbeitsprozesse bedingt sind, aber auch durch die elektronische Reizüberflutung und die damit verkürzten Aufmerksamkeitsspannen, durch eine rasante Zunahme der Berufe im Dienstleistungssektor, durch zunehmende Konkurrenzorientierung und durch die Abhängigkeit von immer schwieriger zu überschauenden und kontrollierenden globalisierten Unternehmen. All das bringt Unsicherheit, Sorgen und eben Stress mit sich, all das, was wir als »Jobstress« bezeichnen. Das Thema ist von höchster Relevanz, da Stress unserer seelischen und körperlichen Gesundheit unter bestimmten Umständen schadet. Stressfolgekrankheiten wie die Depression werden zu Volkskrankheiten, und das weltweit. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation ist Stress eines der größten Gesundheitsrisiken des 21. Jahrhunderts.
Es gibt einige Indizien dafür, dass die Stadt daran nicht ganz unschuldig ist. Wir wissen mittlerweile, dass die Gehirne von Stadtbewohnern anders auf Stress reagieren als die der Landbewohner. Das Gehirn des Städters scheint eine höhere Stressempfindlichkeit zu haben – und die wächst sogar mit der Größe der Stadt, in der man lebt oder aufgewachsen ist. Menschen, die in Großstädten ihre Kindheit verbracht haben, tragen ein höheres Risiko für bestimmte psychische Erkrankungen, zum Beispiel Schizophrenie.1 Heute haben wir neurowissenschaftliche Hinweise darauf, dass der Stress, der in der Stadt entsteht, dabei eine entscheidende Rolle spielt.
Und dennoch: Stadt!
Um es gleich vorweg zu sagen: Ich wohne für mein Leben gern in der Großstadt. Das habe ich schon immer getan und werde es voraussichtlich auch immer tun. Städte faszinieren mich, und ich werde in diesem Buch von meinen Erlebnissen in ihnen erzählen, von meinen Erfahrungen in Berlin, der Stadt, in der ich heute wohne und wo ich in an einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie arbeite, aber auch von meinen Beobachtungen in anderen Städten, die ich besucht und in denen ich gelebt habe.
Was macht den Reiz des Stadtlebens für mich aus? Ich mag die Nähe von Menschen, die ich nicht kenne, von Nachbarn, die in den Wohnungen meines Hauses und den Häusern rings um mich leben und mit denen ich Blickkontakt habe. Mir gefällt das Gefühl, dass meine Straße von Passanten gern genutzt wird, und auch die vielen durchfahrenden Autos stören mich nicht. Ich finde es angenehm, nicht nach dem sozialen Leben suchen zu müssen, wenn ich aus der Haustür trete, sondern es gleich dort vorzufinden. Ich mag die Kultur der Stadt, die Theaterbühnen, die drei staatlichen Opernhäuser, die vielen Museen, Cafés, Geschäfte, Märkte, Plätze und Parks. Für jeden seelischen Aggregatszustand finde ich die richtige Form von Stimulation, wenn ich sie benötige. Aber natürlich bin auch ich immer wieder gestresst von der Stadt. Wenn ich mich in ihr nicht einigermaßen bequem fortbewegen kann, wenn es im Verkehr nicht schnell genug vorangeht, strengt mich das an. Es stresst mich. Dann wird mir klar – und wahrscheinlich auch meinem sozialen Umfeld –, dass man als Stressforscher und Psychiater vor solchen mentalen Verkrampfungen nicht immun ist. Jedenfalls bin ich es nicht.
Und deswegen mag ich es gelegentlich auch ganz anders. Ich mag es, wenn ich das großstädtische Getriebe hinter mir lassen und ins Umland von Berlin fahren kann. Diese kleinen Fluchten tun mir gut. Regelmäßig zum Beispiel fahre ich ins Ruppiner Land. Dort besuche ich einen Freund, der in einem alten Herrenhaus in Garz wohnt, achtzig Kilometer von der Stadt entfernt. Ein Sommertag in Garz: Ich stehe auf der Veranda des Hauses, die Vögel zwitschern in tausend Tonhöhen und schaffen ein klangvolles Gewölbe über meinem Kopf. Wenn man genau und lange genug hinhört, erkennt man, wie sich der Vogelgesang mit der Tageszeit langsam ändert. Dazwischen ist gelegentlich ein lang gezogenes Fauchen zu vernehmen, wenn sich der Wind seinen Weg durch die Baumreihen bricht, die links und rechts von mir den Park säumen und in der Ferne auf einen Teich zulaufen. Links von mir steht ein großer Walnussbaum. Eine weiß gestrichene Sitzgruppe darunter wartet auf Menschen, die Schutz vor der Sommersonne suchen. Daneben hängt eine Schaukel, die der Landschaft so etwas wie Patina verleiht. Überhaupt scheint alles hier aus der Zeit gefallen zu sein. Hinter dem Walnussbaum öffnet sich eine Hainbuchenhecke zu einem prachtvollen barocken Heckengarten. Hinter mir streckt das Gutshaus seine weißen Flügel aus. Es zeigt ein freundliches Gesicht. Die Eindrücke dieser entrückten Idylle inmitten der märkischen Kulturlandschaft haben sich mir tief eingeprägt. Aber dann frage ich mich auch: Würde ich diese Landschaft auch dann so schön finden, wenn ich hier immer wohnen würde? Oder mutet es mich so an erst im Kontrast zum oft lauten und grauen Berlin?
Mir geht es da wie anderen auch: Es gibt immer wieder sehnsüchtige Momente nach dem Leben im Grünen, aber richtig vorstellen kann ich es mir dann doch nicht. So ähnlich funktioniert es wohl auch mit dem medialen Revival des Landlebens. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen in die Städte ziehen und die ländlichen Regionen unter Bevölkerungsschwund leiden, hat das »Landleben« zumindest in den Medien Konjunktur. Die Fernsehkanäle sind voll von Filmen und Serien, die das Dasein auf dem Dorf porträtieren, ringsum Tiere und grüne Natur.2 Daneben schießen unzählige Zeitschriften aus dem Boden, die die Lust am Landleben besingen. Sie heißen Landleben (»Lebensstil mit Liebe zur Natur«), Landlust (»Die schönen Seiten des Landlebens«), Liebes Land (»Die beste Art zu leben«), Landidee (»Land erleben und genießen«) oder Mein Schönes Land (»Gutes bewahren, Schönes entdecken«). Aber diese ländliche Hochglanzwelt ist kein Spiegel gesellschaftlicher Lebensrealität, sondern Ausdruck einer Sehnsucht, ein Traum, den sich die wenigsten erfüllen können und vielleicht auch gar nicht wollen.
Der allgemeine Trend sieht jedenfalls anders aus: Junge und zunehmend auch ältere Menschen in Deutschland zieht es in die Städte, wo sie sich bessere Chancen erhoffen, Chancen auf ein interessanteres kulturelles oder Bildungsangebot oder eine bessere Gesundheitsversorgung. Und viele derjenigen, die sich vielleicht sogar ein Leben auf dem Land vorstellen könnten, sind oft gar nicht in der Lage, dies mit ihrer beruflichen Situation in Einklang zu bringen: Die Städte der westlichen Länder sind die Tore zur globalisierten Welt, dort, vor allem im Dienstleistungssektor, finden sich auch die Jobs, auf die wir angewiesen sind. Rund drei Viertel der Arbeitsplätze in Deutschland zählen mittlerweile zu diesem Sektor. Und da hängt die Entscheidung für einen Wohnort auch sehr schnell von der Nähe zu einem Flughafen oder einem ICE-Bahnhof ab.
Keine Frage, es zieht uns in die Städte. Und das ist ein globales Phänomen. Überall auf der Welt lassen die Menschen das »platte Land« hinter sich. Natürlich sind die Motive der Bewohner der westlichen Länder und derjenigen der Entwicklungs- und Schwellenländer sehr unterschiedlich. Der reiche Rentner aus Schleswig-Holstein, der nach Hamburg zieht, um die kulturelle Vielfalt der Stadt zu genießen, ist nicht zu vergleichen mit dem Wanderarbeiter in China, für den die Stadt die einzige Überlebensperspektive darstellt und der, wie viele andere, bereit ist, einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Menschen ziehen in die Städte, weil sie ihnen Bildung versprechen, Wohlstand, eine sichere Zukunft für die Kinder. Die Stadtbewohner nehmen dafür in Kauf, in gesichtslosen Hochhäusern zu leben, in modernen Trabantenstädten oder in den endlosen Peripherien riesiger Metropolen.
Tatsächlich hat die Stadt mit dem rasanten Anstieg der Weltbevölkerung in den letzten Jahrzehnten eine völlig neue Dimension erreicht. Mittlerweile ist jeder zweite Mensch weltweit ein Stadtbewohner. Immer mehr Städte werden zu Megacitys. Das sind Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Forscher sprechen inzwischen von den Endless Cities – den Städten, die keine Begrenzung mehr haben, sondern ungesteuert, informell und ohne Infrastruktur in die Fläche wachsen. Im Jahr 2050 werden nach Einschätzung der Vereinten Nationen rund 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Viele Staaten werden sich in Zukunft hauptsächlich durch ihre Millionenstädte definieren. Sie sind die Triebwerke unserer modernen Gesellschaften.
Die Urbanisierung ist die markanteste Veränderung der Menschheit auf der Erde. Was bedeutet es, wenn sich das Zusammenleben der Menschen auf immer kleinerem Raum verdichtet? Was bedeutet diese Veränderung für das Leben auf unserem Planeten? Das sind Fragen, die in Zukunft immer drängender werden. Wir können davon ausgehen, dass sich die Urbanisierung für unsere Gesundheit als mindestens so relevant erweisen wird wie der Klimawandel. Deshalb werde ich in diesem Buch immer wieder den Blick über unseren europäischen Tellerrand werfen, werde beispielsweise von den Wohnbedingungen der zahllosen Arbeitsmigranten in Hongkong berichten, die dort unter unvorstellbaren Bedingungen leben. Auch werden wir vom Leben in einer brasilianischen Favela hören. In erster Linie jedoch richtet sich der Fokus auf unsere westlichen Großstädte, auf das, was uns in unseren Städten beschäftigt. Ich werde von mir erzählen und von persönlichen Erfahrungen berichten, die mein Verhältnis zur Stadt und mein Interesse an ihr geprägt haben. Es sind Erfahrungen, die mich zu dem Stadtmenschen gemacht haben, der ich heute bin, Erinnerungen an Kuriositäten, an Schönheit gleichermaßen wie an Gewalt. Damit ist es auch ein sehr persönliches Buch.
Und dabei werde ich vor allem immer wieder von Berlin erzählen – von der Stadt, in der ich lebe, die spannend und vielfältig ist, eine Stadt mit Brüchen und Kanten, eine ständige Herausforderung. Tatsächlich erfahren nicht wenige Bewohner und Besucher die deutsche Hauptstadt als eine aufregende, aber auch anstrengende Metropole – was sie für einen Stressforscher zum perfekten Betätigungsfeld macht. Viele Berliner klagen darüber, dass der Stress immer größer wird, dass man zur Rushhour selten einen Sitzplatz in der U- oder S-Bahn findet, dass immer mehr Touristen die gewohnten Wege versperren, dass die Staus länger werden und die Berliner Autofahrer immer häufiger auf die Hupe drücken. Gleichzeitig befindet sich Berlin aufgrund seiner Vielfalt und seiner Unfertigkeit in einer Art Dauerpubertät, die uns fasziniert. Fast hat man den Eindruck, als würde uns diese Stadt, die sich ständig entwickelt und entfaltet, anstecken, sodass wir es ihr in dieser Hinsicht gleichtun.
In Berlin und in anderen europäischen Metropolen wie Wien, London oder Paris, die als Kultur- und Wissenschaftsstädte zu den attraktivsten Lebensräumen weltweit gehören, lässt sich erfahren, warum wir von Städten angezogen werden und was wir in ihnen suchen, aber auch, was uns abschreckt und manchmal Angst einjagt. Die dort anzutreffende kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt steigert unsere Lebensqualität, und vor allem junge Menschen können sich in einer Großstadt frei entfalten. Zugleich aber stoßen wir auf engem Raum auf große Kontraste und Spannungen. Wohlstand bis hin zu unermesslichem Reichtum liegt nicht weit entfernt von Armut und Elend. Das führt zu großen Diskrepanzen, nicht nur hinsichtlich Lebensqualität, Bildung und Einkommen, sondern auch zu einem teils beträchtlichen Gefälle im Hinblick auf Gesundheitszustand und Lebenserwartung.
Die Gleichzeitigkeit von sozialer Dichte und Einsamkeitserfahrung in Städten kann sich zu krank machendem sozialen Stress summieren. Das ist der Stress, der uns am stärksten beeinträchtigen und unserer Gesundheit erheblich schaden kann. Ja, Lärm oder Dreck in der Stadt belastet uns, was uns aber besonders zu schaffen macht, ist der Stress, den wir im sozialen Miteinander erleben. Das Problem wird vor allem dort virulent, wo es Menschen betrifft, die bereits durch andere Risikofaktoren gefährdet sind. Das können neben einem vorbestehenden genetischen Risiko auch soziale oder demografische Faktoren sein, etwa ein fortgeschrittenes Alter oder ein Migrationshintergrund. Solche Faktoren können dazu führen, dass man von vielen Aspekten des urbanen Lebens und seinen Vorteilen ausgeschlossen ist.
Die ideale Stadt?
Die Wissenschaft hat erst in den letzten Jahren das Themenfeld »Stress und Stadt« für sich entdeckt. Es gibt deshalb noch viel zu wenig gesichertes Wissen darüber, was der seelischen Gesundheit und dem psychischen Wohlbefinden von Menschen in der Stadt dient und was nicht und wie die Risikopopulationen in der Stadt beschaffen sind, um die es sich in erster Linie zu kümmern gilt. Es gibt erste Forschungsansätze, die Überlegungen der Neurourbanistik etwa, die auf der Grundlage von Erkenntnissen von Neurowissenschaften, Medizin, Stadtplanung, Sozialwissenschaften und Architektur versucht, das Thema aus einer übergreifenden Forschungsperspektive in den Blick zu nehmen.3 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus diesen Disziplinen haben in Berlin eine Gruppe gegründet, die sich für eine solche Forschung stark macht. In der Neurourbanistik geht es darum, ein besseres Verständnis davon zu gewinnen, welche Faktoren Stadtstress bewirken und wo die gesundheitsfördernden Aspekte des Stadtlebens zu finden sind. Gesunde Städte sind aus neurourbanistischer Perspektive eine sozial- und gesundheitspolitische Notwendigkeit.4
Aber wir stehen noch am Anfang. Deswegen ist dieses Buch ein erster Versuch, einige Fakten und Gedanken zum Thema »Stadt und Stress« zu sortieren. Es soll dazu anregen, sich intensiver mit den emotionalen Herausforderungen des Stadtlebens auseinanderzusetzen. Regelmäßig treffe ich auf Menschen, die sich von diesem Thema angesprochen fühlen. Viele können dazu etwas beitragen, können von eigenen Erfahrungen erzählen und haben Fragen zu stellen. Und da die Perspektiven so unterschiedlich sind, habe ich für dieses Buch mit Menschen gesprochen, die in der Stadt leben, sie beobachten, erforschen und gestalten. Ich habe Interviews geführt mit Architekten, Stadtplanern und Stadtsoziologen, einem Bürgermeister, einem Psychiater, einem Opernintendanten und mit einer Frau, die, wie so viele Menschen, beides kennt, das Land- und das Stadtleben.
Was ist es, was uns an dem Thema so beschäftigt? Gewiss, so mancher sucht ganz praktisch nach Tipps und Tricks, wie er mit den Herausforderungen des Stadtlebens besser klarkommen kann. Doch ich vermute, dass hinter dem Interesse noch mehr steckt, nämlich die Suche nach der besseren, vielleicht sogar der idealen Stadt. Und wenn dem so ist, wie könnte diese ideale Stadt aussehen? Die Antworten auf diese Frage gehen weit auseinander. Der eine hätte gerne mehr Grün, der andere mehr Theater, ein Dritter vielleicht flexiblere Geschäftsöffnungszeiten, der Nächste mehr Polizei und Videoüberwachung, wieder ein anderer mehr Fahrradwege. Aber in den Grundkriterien wären wir uns alle einig: Wir wollen in einer Stadt leben, die uns ernährt, beschützt, stimuliert und uns nicht allein lässt, wenn wir Unterstützung brauchen. Vielleicht sähe unsere Idealstadt dann so aus: schöne Gebäude, lebendige Straßen, ruhige, helle Wohnungen, effizienter öffentlicher Nahverkehr, genug Platz für alle, Blick ins Grüne aus möglichst vielen Perspektiven, sauber und sicher, wirtschaftlich prosperierend, kulturell blühend und historisch relevant.
Doch einmal abgesehen davon, dass es dieses Utopia nicht geben kann, eine Stadt, wo alles zu jeder Tages- und Nachtzeit und an jedem Ort stimmt – mit dieser Antwort können wir uns nicht zufriedengeben. Es spricht zu viel dafür, dass es mit Eigenschaften wie Sauberkeit, Sicherheit und Schönheit nicht getan ist, dass solche Vorstellungen über Städte zu kurz greifen, weil sie eben vielleicht doch nicht ganz so ideal sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Aber was ist es dann? Dieser Frage will ich in diesem Buch nachgehen.
Wir wollen verstehen, welchen Einfluss die Stadt auf unser Leben hat, wie sie zur seelischen Belastung werden, aber auch, wie sie uns guttun kann. Und überhaupt: Wäre eine solche Idealstadt wirklich das Richtige für uns? Würde uns diese makellose Welt auf Dauer genügen? Was braucht unser Gehirn, was braucht unser Geist, um in einer Stadt Anregung und Regeneration gleichermaßen zu finden?
Um es noch einmal zu betonen: Ich sage all das als überzeugter Großstädter. Keinesfalls will ich das Stadtleben dämonisieren. Mir tut die Stadt gut. Die großen Städte, in denen ich gelebt habe, haben mich zu dem gemacht, der ich bin: Köln hat mich offen und kommunikativ werden lassen. Bonn hat mich gelehrt, dass auch kleine Städte ein Miniaturabbild der großen Welt sein können. Teheran hat mir gezeigt, dass Städte die größten denkbaren Gegensätze aufnehmen können. San Francisco hat mir erstmals die amerikanische Großstadtvision aus bizarren Wolkenkratzern vor dem glitzernden pazifischen Wasser und einem meist stahlblauen Himmel vor Augen geführt. In Wien habe ich gelernt, dass man in der Großstadt den kulturellen Herzschlag eines Landes hören kann. Paris hat mich als jungen Medizinstudenten erfahren lassen, dass sich eine Metropole bezwingen lässt, wenn man sich seine Nachbarschaft, sein Quartier, erobert. Und in Berlin habe ich gelernt, wie mediterran Deutschland sein kann, ein echtes »Draußenland«, in dem sich ein beträchtlicher Teil des urbanen Lebens auf öffentlichen Plätzen, in Parks und auf den breiten Bürgersteigen abspielt.
Städte sind gut für uns. Aber eben nicht unter allen Umständen. Wir sollten daher verstehen, welche Konstellationen und Lebensbedingungen es sind, welche die Stadt zu dem gelobten Land machen, das wir uns erhoffen. Die Stadt sollte uns wohlgesonnen sein. Sie muss unsere fremde Herkunft und unsere unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen respektieren, gleichzeitig die Gemeinschaft fördern und uns in dieser Gemeinschaft einen Platz bieten. Das ist wahrlich keine leichte Aufgabe. Wir sehen das an den täglich neuen urbanen Katastrophen, die sich vor allem an den Rändern der Weltmetropolen abspielen, oder an den Fehlentwicklungen, etwa der Errichtung von gigantischen Stadtanlagen im Niemandsland, wie man es gegenwärtig in China beobachten kann.
Die Welt wird zu einer urbanen Welt. Und das hat Folgen, nicht nur für das Antlitz unserer Städte, sondern auch für unsere Gesundheit. Deswegen sollten wir herausfinden, wie wir unsere Städte zu einem guten Ort machen können.
INTERVIEW FLORIAN HOLSBOER
Stress und seine unterschiedlichen Facetten
Professor Florian Holsboer ist Psychiater, Chemiker und ein international bekannter Depressionsforscher. Von 1989 bis 2014 hat er das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München geleitet. Schwerpunkte seiner Forschungen sind die Entstehung und Prävention von Depressionen, Angsterkrankungen und Schlafstörungen.
Herr Professor Holsboer, Ihre Arbeiten haben unser Verständnis von der Stressantwort des Organismus in entscheidender Weise geprägt. Wann macht Stress krank?
Zuallererst möchte ich klarstellen: Stress an sich ist gut. Die fein abgestimmten Reaktionsabläufe in unserem Körper, die wir brauchen, um gefährliche und belastende Situationen zu bewältigen, sind eine grandiose Leistung unseres Gehirns. In Sekundenschnelle müssen wir hellwach und in ängstlicher Vorsicht die Lage einschätzen und alle Verhaltensweisen anpassen. Zugleich müssen die Stresshormone aktiviert werden, um den Stoffwechsel auf die Krisenbewältigung vorzubereiten. Ohne die Fähigkeit, auf Stresssituationen angemessen zu reagieren, könnte sich ein Lebewesen in einer sich ändernden Welt nicht entwickeln. Das haben wir schon von Darwin gelernt. Der Mensch hat seine Sonderstellung ja auch gerade deshalb, weil er sich immer und immer wieder an neue Belastungen anpassen konnte.
Die pauschale Verteufelung von Stress ist Unsinn, denken Sie nur an die absurde Forderung nach einer gesetzlichen »Anti-Stress-Verordnung«. Einer kürzlich durchgeführten Studie zufolge wünschten sich 61 Prozent der Deutschen ein stressfreieres Leben. Etwa jeder fünfte Befragte fühlte sich durch Stress und Arbeitsbelastung überfordert. Abgesehen davon, dass Stress nicht objektiv messbar ist wie Lärm oder Feinstaub, müssen wir auch die Konsequenzen bedenken: Würden wir Stress abschaffen, würden unsere körperliche Leistungsfähigkeit und unser Denkvermögen nachlassen. Die wichtigste Voraussetzung dafür, trotz Stress gesund zu bleiben, ist, dass die Stressbelastung nicht lange anhält. Ein Leben in ständiger Hetze und Anspannung ist für die Gesundheit schlecht.
Dabei ist ein Aspekt besonders wichtig: Wie bewertet das gestresste Individuum die Situation, und wie geht es mit dem Stress um? Das Stichwort ist hier: Kontrolle. Stellen Sie sich vor, Sie fahren Achterbahn und sausen auf dem Gleis steil hinab, dann ist dies für viele von uns ein angenehmer Nervenkitzel. Obwohl unser Körper den Sturz in die Tiefe fast wie freien Fall wahrnimmt, hält sich der Stress in Grenzen, weil das Ganze doch kontrolliert erscheint. Ganz anders ist die Situation, wenn wir mit gleich hohem Tempo von der Straße abkommen und die Böschung hinunterstürzen. Auch die Begegnung mit einem Bären im zoologischen Garten ist kein Stress, bei einem Waldspaziergang dagegen schon. Entscheidend sind also der Kontext, der Zusammenhang, und die Kontrolle darüber. Wenn wir uns nicht anpassen können, ist das Krankheitsrisiko erhöht.
Warum macht der gleiche Stress einen Menschen krank, während er vom nächsten locker weggesteckt wird?
Stress kann viele, recht unterschiedliche Auslöser haben und verschiedene Konsequenzen. Die wohl schwerste Stressbelastung des Organismus ist der Blutverlust. Darauf reagieren alle Säugetiere gleich: Puls und Stresshormone steigen an und versuchen die tödliche Gefahr abzuwenden. Bei psychischem Stress sind wir angespannt, hellwach und in Alarmbereitschaft. Eine Infektion ist ein ganz anderer Stress, bei dem wir trotz der Erhöhung der Stresshormone eher apathisch und schläfrig werden. Stress ist also nicht gleich Stress. Bei weniger gravierenden Stresssituationen dagegen gibt es erhebliche Unterschiede: Einige Menschen sind robust, haben »Nerven wie Drahtseile«, andere reagieren hochsensibel und erleiden die typischen, dem Stress zugeschriebenen Erkrankungen.
Es hängt also davon ab, wie wir uns an die Situation anpassen können, und auch davon, ob wir eine Veranlagung für stressbedingte Erkrankungen haben. Typisches Beispiel ist die Depression. Die Veranlagung dazu kann von den Eltern ererbt oder beispielsweise durch eine Traumaerfahrung in früher Kindheit erworben sein. Lebt der mit einer solchen Risikokonstellation belastete Mensch ein glückliches, stressfreies Leben, dann ist sein Erkrankungsrisiko gering. Wer aber ein Leben im Dauerstress führt, wer ständig existenzielle Sorgen hat, mit den beruflichen und familiären Anforderungen am Limit agiert und obendrein eine Veranlagung zur Depression besitzt, wird wahrscheinlich eines Tages an dieser Erkrankung leiden.
Warum ist unsere Stressempfindlichkeit so unterschiedlich ausgeprägt?
Menschen sind, so hoffen wir, vor Gott alle gleich. Aber auf Erden sind sie nun einmal sehr verschieden. Unsere genetische Grundausstattung eingeschlossen, ist kein Mensch wie der andere. Das äußert sich eben auch darin, was er gern mag oder was ihn »nervt« oder stresst. Ein persönliches Beispiel: Ich habe mich viele Jahre angestrengt, coolen Jazz zu mögen, weil das damals chic war. Ich kaufte mir Schallplatten, ging in Jazzkonzerte und so weiter – es gelang mir nicht, daran Gefallen zu finden. Ich fand das alles sehr unstrukturiert und wirr, es war mir auch zu laut, ging mir auf die Nerven. Jazz passt nicht zu mir. Bis heute beschäftige ich mich damit nicht mehr.
Ähnlich ging es mir mit Kindergeschrei: Ich fand das grässlich, mied »kinderfreundliche Hotels« und hielt mich von Kinderspielplätzen fern. Jetzt habe ich selbst ein kleines Kind, und auf einmal nervt mich Kindergeschrei nicht mehr so. Obwohl mich Lärm an sich immer noch stört. In letzterem Fall hat also eine Anpassung stattgefunden, beim Jazz war das nicht nötig. Mich stresst auch die Unterschreitung eines ästhetischen Minimums in allen Bereichen des täglichen Lebens. Ästheten haben es heute schwer. Hier fehlt mir auch bewusst das Talent zum Kompromiss. Oder, um in der Sprache der Biologie zu bleiben, das Talent zur Stressanpassung. Das Potenzial, zum Risiko zu werden und deswegen eines Tages eine Stresserkrankung zu erleiden, haben solche Schwächen allerdings nicht.
Sind Sie gern in der Stadt? Wann geht Ihnen das Stadtleben auf die Nerven?
Ich lebe sehr gern in der Stadt. Mir ginge eher das Landleben auf Dauer auf die Nerven. Natürlich finde ich nicht alle Entwicklungen in unseren Städten sehr glücklich: Beispielsweise sind die finanziellen Rahmenbedingungen für den Einzelhandel unattraktiv geworden, kleine Betriebe verschwinden, sodass sich die sozialen Kontaktmöglichkeiten minimiert haben. Früher war der Marktplatz ein zentrales soziales Forum, das gibt es nun nicht mehr. Auf der anderen Seite ist das kulturelle Angebot der meisten Städte ein großes Glück und inspiriert immer aufs Neue. Aber die Vielfalt der Angebote kann uns auch unter Druck setzen: Was soll ich wählen, verpasse ich etwas? Das kulturelle Angebot, Ausstellungen, Oper, Theater und Sportveranstaltungen, all das kann zum Freizeitstress beitragen.
Welche Großstadt tut Ihnen persönlich gut?
Es mag widersprüchlich klingen: Wenngleich meine ästhetischen Bedürfnisse in den Städten Paris, Rom und Wien in besonderer Weise zufriedengestellt werden und der Wirbel in New York und Buenos Aires mich immer wieder beeindruckt, gibt es doch eine Metropole, die mir besonders guttut: Tokio. Diese Stadt, in deren Großraum etwa 35 Millionen Menschen leben, stresst mich nicht. Die Menschen sind freundlich, hilfsbereit und sehr höflich. Man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher spazieren gehen. Es gibt unzählige kleine Kneipen, Läden, Bars, aber auch erstklassige und dennoch erschwingliche Restaurants und mehr Michelin-besternte Restaurants als irgendwo sonst auf der Welt. Das Besondere an Tokio sind die Ordnung und die Sauberkeit und vor allem auch die Disziplin. Und die zahllosen kleinen und großen Parks und Gärten, die ganz gezielt der Erholung, der Besinnung und Entschleunigung in dieser ungeheuer großen Stadt dienen.
Von ein paar Ausnahmen abgesehen, fehlt allerdings großartige Architektur in Tokio, von deren Architekturgeschichte wegen Feuersbrünsten und Kriegseinwirkung nicht viel übrig geblieben ist. Tokio, das sind die Menschen, die nach besonderen Regeln und unter geeigneten Rahmenbedingungen dort leben und ein Zukunftsmodell für künftige Megacitys darstellen.
Sie leben in München. Verraten Sie mir einen Ihrer Lieblingsorte dort?
München, meine Geburtsstadt, ist für mich ideal: Hier heißt die Devise »Leben und leben lassen«. Münchner sind tolerant, arbeiten viel und genießen, wann immer sich die Gelegenheit bietet. München ist ein städtisches Erfolgsmodell. Ob die Stadt auch zukunftsfähig ist, weiß ich nicht, hoffe es aber stark. Mein Lieblingsort? Wir wohnen in Schwabing, direkt am Englischen Garten, und wenn ich mit meiner Familie an einem Sommerabend auf der Terrasse unseres Hauses sitze, dann ist mir wohl.
3. Die Herausforderungen des Zusammenlebens. Sozialer Stress
1997 zog ich von Wien nach Berlin, wo ich zunächst in einer Wohngemeinschaft lebte. Einige Zeit später verließ ich diese wieder und nahm mir allein eine Wohnung – ganz ohne Mitbewohner, kein WG-Leben mehr. Für mich war das ein enormer Schritt. Jetzt konnte ich es genießen, mein völlig eigenes Territorium zu haben, das direkt hinter der Wohnungstür begann. Die Wohnung lag wunderschön am Fasanenplatz. Das Haus selbst war eine architektonische Zumutung aus den 60er-Jahren: schmutzig-senfgelbe Fassade, kleine Zimmerchen, dünne Wände, aber mit einer fantastischen Aussicht. Nach einigen Tagen hörte ich einen lauten Schrei aus der Nachbarwohnung. Ich erschrak fürchterlich. War etwas passiert? Ich hörte in die Stille hinein: alles ruhig. Ich lief zur Wohnungstür und linste durch den Türspion: nichts, dunkel. Dann öffnete ich vorsichtig die Tür. Es blieb ruhig. Dann plötzlich wieder ein lauter Schrei. Ich erschrak fast zu Tode, warf die Wohnungstür zu und regte mich nicht. Die Schreie wiederholten sich an diesem Abend noch einige Male. An den nächsten Abenden war es wieder da: einmal alle halbe Stunde ein kurzer Schrei.
Eine Woche später begegnete ich dem Nachbarn auf dem Flur. Ich sprach ihn an und stellte mich vor. Er war schüchtern und sprach nicht viel. Mit der Zeit gewöhnte ich mich an die Schreie und kam auf die Lösung: Er litt am Tourette-Syndrom, einer Zwangserkrankung, bei der es zu unkontrollierbaren Lautäußerungen kommt. Die Betroffenen verspüren den Zwang, Geräusche, Rufe oder Schreie von sich zu geben, und stoßen Fäkalausdrücke aus. Solche hörte ich von ihm allerdings nicht, vielleicht waren sie auch zu leise. Als ich auf diese mir einleuchtende Erklärung kam, war ich sehr erleichtert. Und: Die Schreie ängstigten mich nicht mehr. Sie störten mich auch nicht, als ich mir erklären konnte, dass der Nachbar nichts für sein Verhalten konnte und dass es das belastende Symptom einer Erkrankung war.
Umweltbedingungen kann man als Einzelner nicht so leicht beeinflussen. Die Menschen, mit denen wir arbeiten, das Haus, in dem wir wohnen, das Land, in dem wir leben, und manchmal auch unser persönliches Schicksal ganz allgemein, das uns ereilt – all das sind Dinge, die wir nicht einfach so ändern können. Für mich war es damals gut, dass ich eine Erklärung für das beunruhigende Verhalten des Nachbarn fand. Deswegen ist daraus keine weitere Belastung geworden, ich konnte mich darauf einstellen. Aber das gelingt nicht immer. Wo Menschen zusammenkommen und sich organisieren müssen, wird es nun einmal sozial anstrengend. Je mehr Menschen das betrifft, desto größer ist das Risiko, dass Einzelne dabei unter hohen Druck geraten. Dieser Druck entsteht zum Beispiel bei Menschen, die in der beruflichen Hierarchie über wenig Entscheidungs- oder Gestaltungsspielraum verfügen, die keine Unterstützung bekommen und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen sind oder sich ungerecht behandelt fühlen. Bei ihnen kommt es zu sozialem Stress.
Gerade die Stadt bietet viele Gründe, warum wir uns tagein, tagaus sozial gestresst fühlen können. Sie ist eine soziale Organisationsform, eine Lebensumwelt, die uns viel gibt. Aber sie ist eben auch eine ständige Anforderung an unsere sozialen Fähigkeiten. Die meisten Menschen in der Stadt kennen wir nicht, aber wir begegnen ihnen jeden Tag und müssen uns im Alltag mit ihnen einigen: wenn wir beim Bäcker anstehen, die Rolltreppe eines Kaufhauses benutzen, einen Sitzplatz im Bus suchen, als Fußgänger eine Straße überqueren oder als Autofahrer vor einem Zebrastreifen abbremsen. Wir verwenden dabei ständig unsere sozialen Antennen. Würden wir das nicht tun, gerieten wir nicht nur akut in Schwierigkeiten, sondern diese Antennen würden auf die Dauer auch verkümmern. Wir sind soziale Wesen und brauchen die Stimulation, die sich aus dem Zusammenleben mit anderen ergibt. Deswegen zieht es uns auch in Städte, ihre soziale Anregung tut uns in erster Linie gut, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Eine reizarme Umgebung in einer menschenleeren Region wäre für die allermeisten Menschen nicht gut.
Wir wissen mittlerweile, dass die soziale Entwicklung, die der Mensch im Lauf der Evolution durchgemacht hat, eng mit der Verbesserung der Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns zusammenhängt. Das Zusammenleben in der Gemeinschaft verlangt dem Einzelnen viel mehr kognitive, also geistige Fähigkeiten ab. Deshalb hat die zunehmende Komplexität des Zusammenlebens auch die Evolution unseres Denkapparats vorangetrieben.1 Wer mit seinen Mitmenschen eine Gemeinschaft bildet, muss nicht nur seine eigenen Bedürfnisse im Blick haben, sondern auch die der anderen, von deren Wohlergehen er abhängig ist. Man muss fähig sein, flexibel auf unterschiedlichste Situationen zu reagieren, und man muss lernen, mit Konflikten umzugehen und sie zu lösen. Je größer die Gesellschaft oder das Rudel, desto größer ist bei Primaten das Gehirn.
Das Hirnvolumen steigt auch mit anderen Faktoren, die die soziale Komplexität erhöhen, zum Beispiel mit der Fähigkeit zur Cliquenbindung oder mit den Herausforderungen bei der Paarbindung. Arten, die in monogamen Paarbindungen leben, haben deshalb auch größere Gehirne als polygame Arten. Nur mit einem Partner verbandelt zu sein, erfordert in komplexen Gesellschaften nämlich höhere soziale Fähigkeiten: Man muss sich auf die Vorzüge seines Gefährten konzentrieren, obwohl es innerhalb der Gruppe eigentlich eine Auswahl gäbe. Man muss Vor- und Nachteile abwägen, wenn jemand anderes um einen wirbt, und man muss sich mehr anstrengen, um den Partner bei sich zu halten. Polygam lebende Lebewesen haben es da leichter. Bei Menschen ist das übrigens nicht anders.





























