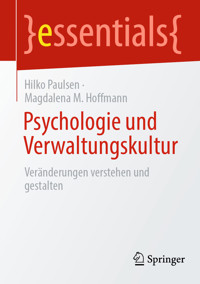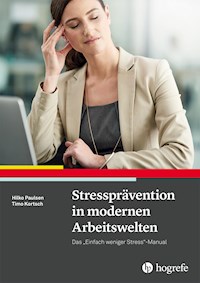
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Stress ist für viele Beschäftigte und Führungskräfte zu einem ständigen Begleiter geworden. Zeit- und Termindruck, eigene und fremde Erwartungen sowie das Gefühl, in einer digitalisierten Arbeitswelt ständig erreichbar zu sein, lösen Stress aus. Umso bedeutsamer ist es, Stress vorzubeugen und bei akutem Stress handlungsfähig zu bleiben. Kompetenzen im Stressmanagement helfen, Stressoren zu erkennen und Ressourcen zu aktivieren, um Anforderungen besser zu bewältigen. In diesem Manual wird ein psychologisch fundiertes Stressmanagement-Programm bestehend aus fünf Phasen beschrieben: (1) Stress verstehen, (2) Stressoren erkennen, (3) Ressourcen wecken, (4) Umsetzung planen und (5) Gelassen handeln. Das "Einfach weniger Stress"-Kurskonzept kann als Gruppentraining an zwei Tagen durchgeführt oder für die Anwendung bei Führungskräften auf eine Dauer von einem Tag komprimiert werden. Darüber hinaus wird dargestellt, wie die fünf Phasen des "Einfach weniger Stress"-Konzeptes im Einzelsetting zur Strukturierung individueller Coaching- und Beratungsprozesse genutzt werden können. Im Fokus steht die Vermittlung von praxisrelevanten Theorien, die Reflexion von Stresssituationen und die Erprobung von Techniken zur Ressourcenaktivierung, die in Bezug zur Lebenswelt der Teilnehmenden bzw. Klienten gebracht werden. Das modular aufgebaute Trainingsprogramm wurde auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Arbeitspsychologie, Stress- und Motivationsforschung sowie metaanalytischer Ergebnisse entwickelt und in der Praxis evaluiert. Neben der Anwendung in Trainings, Coachings und Beratungen werden im Manual weitere Anwendungskontexte wie die Führungskräfteentwicklung und der Einsatz des Konzeptes im betrieblichen Gesundheitsmanagement sowie digitale Unterstützungsmöglichkeiten dargestellt. Die beiliegende CD-ROM beinhaltet alle notwendigen Trainingsmaterialien, bestehend aus Stundenverlaufsplänen für das eintägige und 1,5-tägige Trainingsprogramm, Arbeitsblättern und Präsentationsfolien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hilko Paulsen
Timo Kortsch
Stressprävention in modernen Arbeitswelten
Das „Einfach weniger Stress“-Manual
Dr. Hilko Paulsen, geb. 1985. 2005–2011 Studium der Psychologie in Köln. 2011–2019 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Braunschweig. 2017 Promotion. Seit 2016 selbstständig als Berater in der Organisationsentwicklung und Trainer. Seit 2019 in der Führungskräfteentwicklung der Generalzolldirektion in Münster tätig. Schwerpunkte: Stressmanagement, Kompetenz- und Veränderungsmanagement. Zusatzausbildung im sportpsychologischen Training.
Dr. Timo Kortsch, geb. 1985. 2006–2013 Studium der Psychologie in Halle und Magdeburg. 2013–2019 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Braunschweig. 2019 Promotion. Seit 2016 selbstständig als Trainer im Bereich Organisations- und Führungskräfteentwicklung. Schwerpunkte: Stressmanagement, digitale Lösungen zur Kompetenzentwicklung, Lernkultur. Zusatzausbildungen als Systemischer Berater und Therapeut (SG) und Hypnotherapeut (M.E.G.).
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com by Getty Images / Peopleimages
Satz: Mediengestaltung Meike Cichos, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2020
© 2020 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2924-3; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2924-4)
ISBN 978-3-8017-2924-0
http://doi.org/10.1026/02924-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1 Ausgangslage – Stress in modernen Arbeits- und Lebenswelten
Kapitel 2 Theoretische Grundlagen – Stressentstehung, Stressbewältigung und -prävention
2.1 Stress als unspezifische Anpassungsreaktion
2.2 Das transaktionale Stressmodell: Wie Stress entsteht
2.3 Das Job-Demands-Resources-Modell: Anforderungen und Ressourcen im Wechselspiel
2.4 Empirische Befunde zu den theoretischen Grundlagen
Kapitel 3 Stressmanagementtrainings im Vergleich
3.1 Stressbewältigung (Gelassen und sicher im Stress)
3.2 Optimistisch den Stress meistern
3.3 Gesund führen – sich und andere
3.4 Stressbewältigungstraining für Erwachsene mit ADHS
3.5 Stressmanagement für Teams in Service, Gewerbe und Produktion
3.6 Merkmale des „Einfach weniger Stress“-Konzeptes im Vergleich zu bestehenden Trainingsprogrammen
Kapitel 4 Wirksamkeit der „Einfach weniger Stress“-Kurse
4.1 Prä-Post-Vergleiche: Wirksamkeit des Kurses
4.2 Follow-up: Stabilität der Effekte
4.3 Vergleich der Wirksamkeit mit anderen Interventionen
4.4 Fazit
Kapitel 5 Präventionsgesetz und -strategie als Handlungsrahmen
Kapitel 6 Das „Einfach weniger Stress“-Kurskonzept – Traineranweisungen für den Einsatz als Gruppentraining
6.1 Übergeordnete Zielsetzung und Grundannahmen
6.1.1 Kompetenzverständnis im „Einfach weniger Stress“-Konzept
6.1.2 Stressoren- und Ressourcenperspektive
6.1.3 Motivationspsychologische Grundlagen
6.2 Allgemeine Durchführungshinweise
6.2.1 Ankommen der Teilnehmenden
6.2.2 Kursverlauf
6.3 Aufbau und Ablauf des Kurses
6.3.1 Phasen des „Einfach weniger Stress“-Prozesses
6.3.2 Übersicht über Kursmaterialien
6.4 Einführung in den Kurs
6.4.1 Ziele
6.4.2 Inhalte und Vorgehen
6.5 Schritt 1: Stress verstehen
6.5.1 Ziele
6.5.2 Inhalte
6.5.3 Vorgehen
6.6 Schritt 2: Stressoren erkennen
6.6.1 Ziele
6.6.2 Inhalte
6.6.3 Vorgehen
6.7 Schritt 3: Ressourcen wecken
6.7.1 Ziele
6.7.2 Inhalte
6.7.3 Vorgehen
6.8 Schritt 4: Umsetzung planen
6.8.1 Ziele
6.8.2 Inhalte
6.8.3 Vorgehen
6.9 Schritt 5: Gelassen handeln
6.9.1 Ziele
6.9.2 Inhalte
6.9.3 Vorgehen
6.10 Abschluss und Verabschiedung
6.10.1 Ziele
6.10.2 Inhalte und Vorgehen
6.11 Maßnahmen zur Transfersicherung
Kapitel 7 Das „Einfach weniger Stress“-Konzept in individuellen Coaching- und Beratungsprozessen
7.1 Rahmenbedingungen
7.2 Schritt 1: Stress verstehen
7.3 Schritt 2: Stressoren erkennen
7.4 Schritt 3: Ressourcen wecken
7.5 Schritt 4: Umsetzung planen
7.6 Schritt 5: Gelassen handeln
Kapitel 8 Ausblick – Weitere Anwendungsmöglichkeiten
8.1 „Einfach weniger Stress“-Kurse für Führungskräfte
8.1.1 Komprimierung des Kurskonzeptes auf einen Tag
8.1.2 Ergänzung von Inhalten und Schwerpunktsetzung
8.1.3 Haltung der Kursleitung und Anpassungen beim Wording
8.2 Von eHealth bis mHealth: Stressprävention mit digitaler Unterstützung
8.3 Das „Einfach weniger Stress“-Konzept im betrieblichen Gesundheitsmanagement
Literatur
Anhang
Übersicht über die Materialien auf der CD-ROM
Materialien auf CD-ROM
|1|Einleitung
Als in den 1990er Jahren das Internet seinen Siegeszug begann, konnte man die tiefgreifenden Auswirkungen auf die Arbeits- und Lebensbedingungen noch nicht absehen. Die zunehmende Vernetzung und Beschleunigung von Prozessen stellen Menschen vor neue Herausforderungen, die sich immer mehr auch im psychischen Erleben – insbesondere im Erleben von Stress – niederschlagen (siehe Kapitel 1).
Als Psychologen, die in der Wissenschaft tätig waren, haben wir uns immer gefragt, wie das vielfältige theoretische Wissen in die Anwendung gebracht werden kann. Deshalb besuchten wir eine Ausbildung zum Kursleiter Stressmanagement, um Menschen praktische Kompetenzen zur Stressprävention vermitteln zu können. Beim Besuch der Ausbildung wurde uns aber schnell klar, dass bestehende Kurskonzepte den aktuellen Anforderungen gar nicht ausreichend Rechnung tragen. Zum einen gibt es seit der Entwicklung verbreiteter Kursprogramme viele aktuelle Forschungsbefunde aus der Motivations- und Emotionsforschung zum komplexen Zusammenwirken von Stressoren und Ressourcen, die Stresspräventionskonzepte bereichern und den veränderten Anforderungen angemessener erscheinen (siehe Kapitel 2). Zum anderen waren die Programme oft als mehrwöchige Kurse angelegt, obwohl Menschen in der heutigen Zeit nach einer schnellen Lösung suchen (siehe Kapitel 3). Eine Konzeption, die einen flexiblen Einsatz ermöglicht (z. B. als Kompaktkurs oder in dyadischen Settings), erschien daher angemessen.
Deshalb wird mit dem „Einfach weniger Stress“-Manual ein Konzept für Stresspräventionstrainings in Gruppen von 5 bis 12 Teilnehmenden (Kapitel 6) genauso wie für individuelle Coachings und Beratungen (Kapitel 7) vorgestellt. Das Trainingsprogramm ist in fünf Phasen bzw. Schritte aufgeteilt, die je nach Ziel und Anliegen unterschiedlich intensiv behandelt werden können. Hierfür werden verschiedene Methoden vorgestellt, die als Vorschläge zu verstehen sind und durch die Expertise der Anwenderinnen und Anwender unbedingt erweitert werden sollten.
Das „Einfach weniger Stress“-Kurskonzept wurde von der Zentralen Prüfstelle Prävention der Kooperationsgemeinschaft gesetzlicher Krankenversicherungen zertifiziert und mit dem Qualitätssiegel „Deutscher Standard Prävention“ versehen (siehe Kapitel 5). Die Wirksamkeit des Trainingsprogramms wurde im Vorher-Nachher-Vergleich mit einer Wartekontrollgruppe und Follow-up-Messung nach fünf Wochen überprüft (siehe Kapitel 4).
Zuletzt wird in Kapitel 8 noch ein Ausblick gegeben, welche weiteren Anwendungsfelder das „Einfach weniger Stress“-Konzept bietet. Dafür wird die Stresscue-App als konkrete digitale Lösung für die individuelle Stressprävention vorgestellt, die einzeln oder als Ergänzung zu Trainings und Coachings eingesetzt werden kann. Menschen mit neuen Kompetenzen auszustatten, ist ein wichtiger Weg zur Stressbewältigung. Doch ebenso wichtig ist es, Arbeitsprozesse und -strukturen zu verändern. Deshalb wird auch auf Möglichkeiten der Verhältnisprävention nach dem „Einfach weniger Stress“-Konzept vor allem in Unternehmen eingegangen.
Das bisherige Feedback unserer Klientinnen und Klienten sowie Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner macht uns stolz, mit dem „Einfach weniger Stress“-Programm tatsächlich das geschaffen zu haben, was wir beabsichtigt haben: ein einfaches und intuitives Stresspräventionskonzept, das sich durch theoretische Fundierung und Anwendbarkeit gleichermaßen auszeichnet und vielfältig einsetzen lässt. Einige Inhalte und Methoden werden Ihnen vertraut erscheinen. Gleichzeitig werden Sie Neues erfahren und Bekann|2|tes aus einer neuen Perspektive betrachten können. Das Konzept ist dabei keineswegs statisch zu sehen. Es lebt. Es lebt von Ihrer Expertise, mit der Sie das Konzept beim Lesen und bei der Anwendung zum Leben erwecken. Wir sind gespannt, wie Sie das „Einfach weniger Stress“-Manual anwenden, was Sie als nützlich erleben und freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
Wir möchten uns besonders bei Anne Fabian bedanken, die uns bei der Evaluationsstudie zum „Einfach weniger Stress“-Kurs besonders unterstützt hat. Außerdem gilt unser Dank Ramon Rimpler und Pevi Schröder, die an verschiedenen Stellen bei der Entstehung dieses Buches mitgewirkt haben. Zuletzt möchten wir unserer Lektorin Tanja Ulbricht danken, die mit ihren Ideen und Anregungen das Manuskript noch maßgeblich verbessert hat.
Braunschweig, im Oktober 2019
Hilko Paulsen und Timo Kortsch
|3|Kapitel 1Ausgangslage – Stress in modernen Arbeits- und Lebenswelten
Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Dies ist nichts Neues. Kaum etwas ist so kontinuierlich wie Veränderungen (Kraiger, 2014). Beschäftigte sind in der Folge immer wieder mit neuen Anforderungen konfrontiert, die sie bewältigen müssen.
Gegenwärtig wird vor allem in der Digitalisierung eine zentrale Rolle als Treiber für Veränderungen gesehen. Begonnen hat die Digitalisierung bereits vor einigen Jahrzehnten. Seit der Jahrtausendwende übersteigen digitale Datenmengen wie Texte und Fotos auf Computern, Sticks und anderen Medien die analogen Datenmengen in Aktenschränken (Hilbert & López, 2011). Die Verbreitung von Smartphones ist im letzten Jahrzehnt gestiegen. Schätzungen gehen von 57 Millionen Smartphone-Nutzenden in Deutschland aus (Bitkom, 2018). In Kombination mit sozialen Medien wie Facebook oder Instagram und Instant Messengern wie WhatsApp oder Snapchat vernetzt das Smartphone Menschen weltweit zu jeder Zeit – vorausgesetzt es besteht eine Internetverbindung. Daten liegen dabei nicht mehr auf Festplatten, sondern in Clouds. So können verschiedene Personen von verschiedenen Endgeräten auf Daten zugreifen. Dies ermöglicht beispielsweise mobiles Arbeiten.
Vernetzt werden aber nicht nur Menschen. Mit dem Begriff Industrie 4.0 wird die Vernetzung von Dingen, insbesondere Maschinen, durch Algorithmen angesprochen (siehe Kasten).
Industrie 4.0: Das Internet der Dinge
Der Begriff „Industrie 4.0“ ist ein von deutschen Wissenschaftlern geschaffener Kunstbegriff. Er beschreibt in Anlehnung an die vorangegangenen industriellen Revolutionen eine vierte industrielle Revolution. Die erste industrielle Revolution war durch die Erfindung der Dampfmaschine eingeleitet worden, durch die Entdeckung der Elektrizität und Serienproduktion erfuhr die industrielle Fertigung einen zweiten Aufschwung. Informations- und Kommunikationstechnologien haben dann nach dem zweiten Weltkrieg zunehmend für eine Automatisierung gesorgt. Auf dieser dritten industriellen Revolution baut Industrie 4.0 auf. Durch immer bessere und günstigere Speichermedien werden Maschinen mit Sensoren ausgestattet und können so miteinander kommunizieren. Dabei betrifft dies nicht nur die industrielle Produktion. Nahezu alle Wirtschaftsbereiche von der Landwirtschaft bis zum Dienstleistungssektor sind von den Entwicklungen, allen voran der Digitalisierung, betroffen (vgl. Kagermann, Wahlster & Helbig, 2013).
Weil die für die Industrie 4.0 typischen Merkmale nicht nur die industrielle Produktion, sondern auch andere Sektoren vom Handwerk, über Handel bis hin zur Landwirtschaft betreffen, ist häufiger die Sprache von Arbeit 4.0. Im Arbeitsalltag kommt die moderne Arbeitswelt oft durch die Nutzung von Smartphones und sozialen Medien zum Ausdruck, wie eingangs geschildert.
Doch wie verändert sich die Arbeit 4.0? In arbeitswissenschaftlichen Ansätzen wird oft das Zusammenspiel von Mensch, Technik und Organisation betrachtet. Es ist auch die Rede von soziotechnischen Systemen (Trist & Bamforth, 1951; Ulich, 2011). Nicht nur die Technik ist zu berücksichtigen, sondern auch organisationale Strukturen und Prozesse sowie der Faktor Mensch. Technik sowie Organisationsstrukturen und -prozesse stellen Anforderungen an die arbeitenden Menschen. Gleichzeitig bringen die Menschen Ressourcen mit, die erst den Einsatz von Technik sowie effiziente Prozesse ermöglichen. Die Digitalisierung wirkt sich auf den Menschen, die Technik und Organisation sowie insbesondere das |4|Zusammenspiel dieser Komponenten in Arbeitssystemen aus. Dadurch ergeben sich neue Qualitäten.
Zunächst ermöglicht die Digitalisierung eine technologische Veränderung. Dokumentationen werden etwa nicht mehr Paper-Pencil getätigt, sondern mit einer App. Diese technologische Veränderung wirkt sich auf Strukturen und Prozesse innerhalb der Organisation aus. Eine digitale Dokumentation führt beispielsweise dazu, dass Daten schnell nach einem Kundentermin eingegeben werden, statt erst am Abend im Büro. Die Daten sind dadurch in Echtzeit zugänglich und können zur Steuerung von Prozessen genutzt werden. Es ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, die zu neuen Aufgaben und Tätigkeiten führen. Menschen benötigen für diese neuen Aufgaben zum Teil auch neue Kompetenzen: Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ihnen helfen, diese Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Gleichzeitig werden Beschäftigte mit neuen Phänomenen konfrontiert. Dies ist beispielsweise die Mail, die noch am späten Abend im Postfach landet und dazu führen kann, dass der Einzelne sich fremdbestimmt fühlt.
Doch der Mensch ist keineswegs ausschließlich als passiver Akteur zu verstehen. Vielmehr gestalten Menschen die Nutzung von digitalen Technologien aktiv mit. Oft ergibt sich so ein Spannungsfeld aus Fremd- und Selbstbestimmung. Gerade bei dem Phänomen der ständigen Erreichbarkeit (siehe Kasten) ist dies zu beobachten.
Ständige Erreichbarkeit: Eine Frage des Typs?
Die Digitalisierung ermöglicht ein mobiles Arbeiten. Das Smartphone ist oft rund um die Uhr angeschaltet. Dienstmails können jederzeit gelesen werden – auch außerhalb des Büros, z. B. abends in der Freizeit. Die Folge: Es kommt zu einer zunehmenden Entgrenzung zwischen Arbeits- und Privatleben. Eine erweiterte Erreichbarkeit, d. h. das Arbeiten auch nach Dienstschluss, steht in einem Zusammenhang mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, wie Studien zur arbeitsbezogenen Smartphone-Nutzung in der Freizeit zeigen (Derks & Bakker, 2014; Ohly & Latour, 2014). Doch wie kommt es dazu? In einer qualitativen Interviewstudie von Menz, Pauls und Pangert (2016) mit 43 Beschäftigten aus der IT-Branche zeigen sich vier Auslöser für erweiterte Erreichbarkeit:
Sachlich-funktionale Erreichbarkeitsnotwendigkeiten: Die Erreichbarkeit wird auf einen Sachgrund zurückgeführt. Dies sind beispielsweise Störungen, die schnell behoben werden müssen oder ein Abstimmungsbedarf im Team, der als notwendig betrachtet wird. Wird die Erreichbarkeit als „sachlich-funktional“ bewertet, besteht seitens der Beschäftigten meistens eine hohe Akzeptanz, da die Identifikation mit der Arbeit hoch ist.
Soziale Erreichbarkeitskulturen: Hierbei handelt es sich um zumeist nicht ausgesprochene Erwartungen. So gehen Beschäftigte davon aus, dass Führungskräfte Erreichbarkeit erwarten und erleben dies als Loyalitäts- oder Leistungstest. Interessant dabei ist: Innerhalb einer Organisation unterscheiden sich die wahrgenommenen Erreichbarkeitskulturen stark. Selten werden Erwartungen klar kommuniziert. Beschäftigte könnten dies proaktiv ansprechen und so einen Klärungsprozess einleiten.
Entlastungsstrategie für Beschäftigte: Um z. B. in der Woche die Zeit eher mit konzeptionellen oder anderen aufwendigen Arbeiten zu verbringen, werden organisatorische und kommunikative Aufgaben wie das Bearbeiten von Mails bereits am Sonntagabend erledigt.
Proaktive Erreichbarkeitsroutinen: Hierbei handelt es sich um Gewohnheiten und Automatismen, die ohne einen sachlichen Anlass oder dem Ziel der Entlastung zum Abrufen und ggf. Bearbeiten von Mails führen. Dies kann sogar unbeabsichtigt geschehen, beispielsweise wenn dienstliche Mails mit dem privaten Handy abgerufen werden. Schnell wird dann die Mail der Führungskraft noch bearbeitet.
Die Interviewten unterscheiden sich allerdings in der Beanspruchung sowie dem Idealbild, in dem sie sich Entgrenzung oder Integration von Arbeit und Leben wünschen. Daraus wurde eine Typologie gebildet: Erfolgreichen Grenzziehenden gelingt es entsprechend ihres Ideals, Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben zu ziehen. Belasteten Grenzziehenden gelingt es, weniger Grenzen zu ziehen, als sie sich wünschen. Sie erleben ihren Handlungsspielraum als gering, nehmen soziale Erreichbarkeitskulturen wahr und zeigen proaktive Erreichbarkeitsroutinen. Getriebene Entgrenzte sehen kein Ideal in einer starken Trennung, erleben die Entgrenzung jedoch stark fremdbestimmt und fühlen sich daher „getrieben“. Glückliche Entgrenzte sehen in der Verschmelzung von Arbeit und Privatleben ein Ideal. Sowohl sachlich-funktionale Erreichbarkeit als auch proaktive Erreichbarkeitsroutinen lösen erweiterte Erreichbarkeit auch außerhalb der regulären Dienstzeit aus. Dabei sind die glücklich Entgrenzten gleichermaßen Sender und Empfänger: Sie agieren einerseits selbst nach Feierabend und senden Mails, andererseits erhalten sie selbst welche.
|5|Medial wird oft das Rationalisierungspotenzial digitaler Technologien diskutiert. Genährt werden solche Diskurse durch Studien wie die von Frey und Osborne (2013), welche zu dem Ergebnis kommt, dass 42 % aller Jobs in den USA durch die Digitalisierung gefährdet sind. Diesen Ergebnissen gegenüber steht eine Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung von Helmrich et al. (2016). Die Autoren dieser Studie kommen zu dem Schluss, dass lediglich 12 % der Berufe gefährdet seien. Vielmehr komme es zu einer Verlagerung von Tätigkeiten. Statt ausführender Tätigkeiten werden künftig stärker planerische, steuernde und kommunikative Tätigkeiten gefordert sein. Das bedeutet dennoch eine gravierende Veränderung: Beschäftigte brauchen neue Kompetenzen. Ein lebenslanges Lernen wird mehr und mehr erforderlich.
Dabei bleibt oft nur wenig Zeit für die Lernprozesse. Denn schließlich wartet Arbeit auf die Beschäftigten. Gerade mit der Digitalisierung ist die Annahme verbunden, dass die Arbeitsdichte zugenommen hat. Wo früher noch ein Brief abgeschickt wurde, sodass der Postweg Prozesse in die Länge gezogen hat, können Informationen nun per Mail und Instant Messenger zu jeder Zeit abgerufen und gesendet werden. Dadurch kommt es zu einer höheren Schnelllebigkeit – eines von vielen Merkmalen moderner Arbeitswelten, die gerne auch als VUKA-Welten (siehe Kasten) beschrieben werden.
VUKA-Welten
VUKA ist ein Akronym und steht für die Begriffe Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambivalenz, die auch moderne Arbeitswelten kennzeichnen (vgl. von Ameln & Wimmer, 2016; Bennett & Lemoine, 2014). Volatilität bezeichnet die Schnelllebigkeit von Prozessen und Veränderungen. Den Begriff kennen wir ansonsten eher von Aktienkursen, die stark schwanken. Übertragen auf Arbeitswelten wird mit hohem Tempo in eine Richtung gesteuert, um am nächsten Tag das Ruder umzureißen und Kurs auf ein anderes Ziel zu nehmen. Ein Treiber dafür ist eine verstärkte Unsicherheit. Entwicklungen sind nur schwer vorhersagbar. Neue Informationen tauchen erst im Prozess der Arbeit auf. Zurückzuführen ist dies teilweise auf eine Komplexität, die sich durch das Zusammenspiel vieler Akteure und Prozesse ergibt. Arbeitsaufgaben sind oft vielschichtig. Sie müssen technologischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen genügen. Dies äußert sich in einer starken Ambivalenz, die durch widersprüchliche Anforderungen gekennzeichnet ist. Beispielsweise ist man bei der Arbeit mit mehreren Verordnungen konfrontiert, die einander widersprechen.
Doch geht eine höhere Arbeitsintensität auch stets mit einer höheren Beanspruchung einher? In einer Metaanalyse werteten Stab und Schulz-Dadaczynski (2017) insgesamt 294 Studien zum Thema Arbeitsintensität systematisch aus. Arbeitsintensität führt demnach zu Beanspruchungen. Allerdings weisen einzelne Studien zum Teil große Unterschiede auf. Die Überblicksarbeit gibt damit Hinweise auf Gestaltungsempfehlungen, welche sowohl bei der Arbeitsorganisation als auch bei den Beschäftigten ansetzen. Diese zielen dabei nicht unmittelbar auf die Arbeitsintensität als solches ab, sondern auf den Aufbau von Ressourcen, welche die negativen Folgen der Arbeitsintensität abschwächen. Hierzu zählen beispielsweise die Ausweitung der Handlungsspielräume und eine Optimierung des Verhaltens im Umgang mit Arbeitsintensität. Diese Gestaltungsempfehlungen basieren zudem auf stresstheoretischen Überlegungen und betonen ferner die Bedeutung von individueller Verhaltensprävention.
Zusammenfassend lässt sich annehmen, dass in modernen Arbeits- und Lebenswelten die Themen Stressprävention und -bewältigung an Bedeutung gewinnen. Bekannte stresstheoretische Ansätze sowie neuere Ansätze und Befunde aus der Psychologie liefern hier einen Beitrag.
|6|Kapitel 2Theoretische Grundlagen – Stressentstehung, Stressbewältigung und -prävention
Um Stress präventiv zu begegnen, bedarf es einer Vorstellung von den Prozessen der Stressentstehung und Stressbewältigung. Dies setzt wiederum eine begriffliche Verständlichkeit von Stress voraus.
2.1 Stress als unspezifische Anpassungsreaktion
Stress wird als eine Reaktion auf die Umwelt aufgefasst. Nach dem Pionier der Stressforschung, Hans Selye, ist Stress eine unspezifische Reaktion auf jede Art von Anforderung. Er hatte zunächst in Experimenten mit Ratten festgestellt, dass sich unabhängig von den stressauslösenden Ereignissen (z. B. plötzliche Kälte, große Anstrengung, Verletzungen) immer wieder eine ähnliche Anpassungsreaktion bei den Tieren zeigte. Dies nannte er das allgemeine Anpassungssyndrom (Selye, 1936). Anfangs ging Selye noch davon aus, dass die Reaktion vor allem im neuroendrokrinen System stattfindet, später stellte er aber fest, dass sehr viele organische Systeme (insbesondere das Herz-Kreislauf-System, die Lunge und die Nieren) an dieser Reaktion beteiligt sind (Szabo, Tache & Somogyi, 2012).
Definition: Stress
Stress ist die unspezifische Reaktion des Organismus auf jede Art von Anforderung (Selye, 1956).
Das „Einfach weniger Stress“-Konzept versteht Stressentstehung als ein Wechselspiel zwischen Person und Umwelt. Der Mensch wird als ein biopsychosoziales Wesen verstanden (vgl. Uexküll & Wesiack, 1996). Stress äußert sich folglich in Veränderungen physiologischer und psychischer Merkmale und hat Einfluss auf das Sozialverhalten. Zudem sind physiologische, psychische und soziale Faktoren bei der Stressentstehung und -aufrechterhaltung von Bedeutung. Stressbewältigung und -prävention umfasst ebenfalls körperliche, psychologische und soziale Komponenten. Das bedeutet, dass es keine bei allen Menschen gleiche Stressreaktion gibt. Vielmehr unterscheiden sich die Stressreaktionen zwischen Menschen und auch zwischen Situationen. Stress kann sich auf verschiedenen Ebenen äußern (körperliche, mental-emotionale und Verhaltensebene; siehe Kasten).
Ebenen der Stressreaktion (vgl. Kaluza, 2018)
Körperliche Ebene: Aktivierung des Körpers, z. B. schnellerer Herzschlag, erhöhte Muskelanspannung und schnellere Atmung
Mental-emotionale Ebene: Gefühle der inneren Unruhe, Angst, Grübeln, Tunnelblick
Verhaltensebene: hastiges und ungeduldiges Verhalten, unkoordiniertes Arbeitsverhalten, gereiztes Verhalten gegenüber Mitmenschen
Die beschriebenen Stressreaktionen haben eine Funktion für den Körper. Nach Selye (1956) führt die Stressreaktion zunächst dazu, dass der Körper Alarm schlägt (Alarmphase) und dadurch zusätzliche Kräfte mobilisiert, die den Anforderungen entgegengesetzt werden (Widerstandsphase). Am Ende führt dies allerdings zu einer Erschöpfung, die eine Erholung notwendig macht (Erholungsphase). Probleme ergeben sich vor allem dann, wenn die Stressreaktion lange andauert und Personen immer wieder in der Alarm- und Widerstandsphase sind, jedoch keine Erholungsphasen durchleben. Stresserleben geht dann mit unangenehmen Gefühlen wie Angst oder Ärger einher. Dies wird auch als Distress bezeichnet. Stress ist jedoch nicht grundsätzlich negativ: Stress kann auch |7|mit positivem Erleben einhergehen. Wir reagieren beispielsweise euphorisch auf neue Herausforderungen und sind zusätzlich aktiviert, diese Herausforderung anzugehen. Dann ist von Eustress die Rede.
Stressformen
Distress: negativ erlebter Stress, verbunden mit negativen Gefühlen (z. B. Angst oder Ärger)
Eustress: positiv erlebter Stress, verbunden mit positiven Gefühlen (z. B. Begeisterung, Freude)
Wichtig ist, dass Stress erst im Wechselspiel mit unserer Umwelt und den Anforderungen der Umwelt entsteht. Man kann die Stressreaktion (was gemeinhin als Stress bezeichnet wird) von den Auslösern für Stress (Stressoren) unterscheiden. Stressoren sind Reize, beispielsweise Situationen oder Ereignisse, die häufig eine Stressreaktion auslösen. Es sind also Reize, die bei einer Person in der Vergangenheit typischerweise zu Stresserleben geführt haben oder bei anderen Menschen oft Stressreaktionen nach sich ziehen.
Definition: Stressoren
Stressoren sind Reize (z. B. Situationen, Ereignisse), die typischerweise eine Stressreaktion auslösen.
Es gibt Situationen, in denen der Körper bewusst Stress ausgesetzt wird. Sportler und Sportlerinnen setzen sich im Training bewusst Belastungen aus, die sie beanspruchen, um dadurch Anpassungsreaktionen zu erzielen. Früh haben sich hier in den Trainingswissenschaften systematische Ansätze entwickelt, um Trainingseffekte zu optimieren. Das Prinzip der Superkompensation nutzt etwa die sukzessive Steigerung von Belastungsanreizen in Kombination mit entsprechender Erholung (Jakowlew, 1975). Durch das Wechselspiel von Belastung und Erholung wird kontinuierlich die Leistungsfähigkeit gesteigert. Der Körper wird dabei zunächst bewusst beansprucht. Wichtig ist, dass nach dieser Phase eine ausreichend lange, jedoch nicht zu lange Erholung erfolgt, um eine Leistungssteigerung zu erzielen. Nur dann kommt es zu der sogenannten „Superkompensation“, welche zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit führt. Ist die Erholung zu kurz, erfolgt unter Umständen eine unvollständige Kompensation. Ist die Erholungsphase zu lange, bleibt die Leistungsfähigkeit auf dem bisherigen Level und die Potenziale der Trainingseffekte können nicht ausgeschöpft werden.