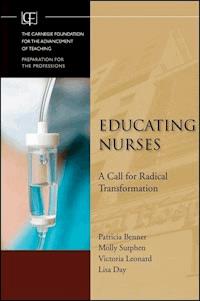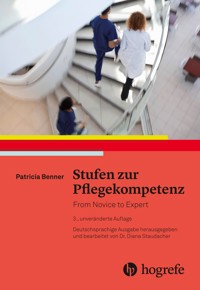
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"From Novice to Expert" - der Klassiker zum Thema Pflegekompetenz und -expertise sowie die Rolle der Intuition in der Pflege von Patricia Benner. Wie sich erfahrene Pflegende mit großer Expertise in komplexen Pflegesituationen verhalten und in welcher Weise sich ihr professionelles Verhalten von dem lernender und weniger erfahrener Kolleginnen und Kollegen unterscheidet, zeigt Patricia Benner in ihrem zum Klassiker und Standardwerk avancierten Werk. Sie beschreibt eine professionelle Pflege, die ein tieferes Verständnis des Patienten voraussetzt und von Pflegenden fordert, die Perspektive des Patienten einzunehmen, um eine individuelle und respektvolle Pflege anbieten und gestalten zu können. Benner beschreibt eine Pflege, die das krankheitsbedingt verletzte oder bedrohte Selbst des Patienten aufrechterhält, schützt und durch Caring, Coping und Selbstmanagement ermöglicht. Die von Benner beschriebene professionelle Pflege • fasst alle klinischen Entscheidungen zugleich als ethische Entscheidungen auf • gründet auf einem Menschenbild der Verletzlichkeit • beruht auf intensivem inneren Beteiligtsein am Erleben der Patienten • fasst Menschenwürde als zwischenmenschliches Geschehen auf. Die zweite und dritte deutsche Auflage wurde um einen Beitrag zur exzellenten Pflege im 21. Jahrhundert ergänzt, der Patricia Benners Impulse für eine patientensensible Pflegepraxis verdeutlicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Stufen zur Pflegekompetenz
Patricia Benner
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:
Jürgen Osterbrink, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld;
Christine Sowinski, Köln; Franz Wagner, Berlin; Angelika Zegelin, Dortmund
Patricia Benner
Stufen zur Pflegekompetenz
From Novice to Expert
Aus dem Amerikanischen von Martin Wengenroth
Deutschsprachige Ausgabe herausgegeben und bearbeitet von Dr. Diana Staudacher
3., unveränderte Auflage
Patricia Benner. RN, Ph.D., FAAN, FRCN, San Francisco, USA
DianaStaudacher(dt. Hrsg.). Dr. phil., freie Publizistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Universitätsspitals Zürich und der Fachhochschule St. Gallen, mit Schwerpunkt Pflege, Medizin und Gesundheit.
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Kopien und Vervielfältigungen zu Lehr- und Unterrichtszwecken, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Pflege
z.Hd.: Jürgen Georg
Länggass-Strasse 76
3000 Bern 9
Schweiz
Tel: +41 31 300 45 00
Fax: +41 31 300 45 93
E-Mail: [email protected]
Internet: www.hogrefe.ch
Lektorat: Jürgen Georg
Bearbeitung: Dr. Diana Staudacher
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung: Sam Edwards Caia Image/F1online
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Fotos (Innenteil): Jürgen Georg
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Finidr s. r. o., Český Těšín
Printed in Czech Republic
Das vorliegende Buch ist eine Übersetzung aus dem Amerikanischen. Der Originaltitel lautet „From Novice to Expert – Excellence and Power in Clinical Nursing Practice, Commemorative Edition“ von Patricia Benner.
© 2001. Pearson Education / Health, Inc.
3. Auflage 2017
1. und 2. Auflage 1994 und 2012 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
© der 3., unveränd. deutschsprachigen Auflage 2017 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-95771-5)
ISBN 978-3-456-85771-8
http://doi.org/10.1024/85771-000
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Geleitwort zur ersten deutschen Ausgabe (1994)
Wenige Bücher aus dem Bereich der Pflege haben Berufsangehörige in Praxis, Ausbildung und Führung so stark beeinflusst wie «From Novice to Expert». Dieses Buch ist ein Meilenstein. Das Werk gilt als einer der wichtigsten Beiträge zum philosophisch-wissenschaftlichen Verständnis der Pflege. In den Jahren seit seinem Erscheinen hat «From Novice to Expert» überlieferte Auffassungen der Pflegeausbildung und Führung gesprengt und eine Deutung der Praxis angeboten, in der sich viele Pflegende wiedererkennen. Anhand von Geschichten aus der täglichen Pflege beschreibt Patricia Benner die meisterhafte Praxis erfahrener Berufsangehöriger. Ihre Interpretation stärkt das berufliche Selbstverständnis vieler Pflegender und bietet eine Sprache an, die es ermöglicht, wesentliche Anliegen und Inhalte der Pflege auszudrücken.
«From Novice to Expert» ist eine Studie, der Interviews mit erfahrenen und weniger erfahrenen Pflegenden sowie Beobachtungen ihrer Praxis zugrunde liegen. Die Studie besteht aus zwei interessanten Teilen. Patricia Benner wandte erstens das von den Brüdern Dreyfus entwickelte Modell des durch Wissen und reiche Erfahrung ermöglichten Kompetenzerwerbs auf die Krankenpflege an, und zweitens umriss sie das Berufsfeld anhand von sieben Bereichen.
Das Dreyfus-Modell fordert dazu auf, Ausbildungs- und Karrieretraditionen in der Pflege zu überdenken. Die sieben Bereiche ermöglichen eine realitätsnahe Berufsdefinition und tragen wesentlich zu einem differenzierten Selbstverständnis der Pflegenden bei.
Möge diese Ausgabe von «From Novice to Expert» im deutschsprachigen Raum viele Pflegende inspirieren und dazu anregen, ihre eigene Praxis nach unvergesslichen lernintensiven Erlebnissen zu durchforschen und über solche Erfahrungen nachzudenken. Möge das Buch zur Entwicklung und Reflexion der Pflege im deutschsprachigen Raum beitragen und sowohl in der Ausbildung als auch in der Führung neue Impulse geben.
Bern, im Oktober 1993Annemarie Kesselring, Prof., RN, PhD
Vorwort
Dieses Buch leistet einen herausragenden Beitrag für die Pflege. Patricia Benner analysiert Beobachtungen aus der Pflegepraxis und wendet dabei ein Modell des Kompetenzerwerbs an, das Hubert L. Dreyfus und Stuart E. Dreyfus entwickelt haben. Mit ihrer Analyse gibt sie uns eine klare und anschauliche Beschreibung der Pflegepraxis von Expertinnen und Experten. Diese Beschreibung gewinnt noch an Bedeutung und Brisanz, wenn man sich die vielen weitreichenden Folgen vor Augen führt, die sich daraus für Pflegende in Administration, Ausbildung und Praxis ergeben. Wir erfahren, wie sich Pflegeexpertinnen und -experten in spezifischen Pflegesituationen verhalten und in welcher Weise sich ihr Verhalten von dem der Anfängerinnen und Anfänger unterscheidet. Wir erfahren auch, wie sich das Denken der Pflegenden im Lauf ihrer beruflichen Entwicklung verändert, wie sie ihr Wissen verinnerlichen und organisieren. Sie beginnen, sich bei ihren Entscheidungen auf eine andere Grundlage zu stützen als diejenige, welche ihnen in ihrer Ausbildung vermittelt wurde.
Der Wert dieses Werkes liegt darin, dass es uns das Geheimnis der Pflege auf Expertenstufe näherbringt und gleichzeitig ein Bewusstsein dafür schafft, dass dieses Geheimnis respektiert werden muss. Es kann nicht einfach gelöst oder in vorgefertigte Formen gepresst werden kann, indem man es bestimmten Regeln, Methoden oder Vorschriften unterwirft.
Dieses Buch wendet sich an verschiedene Leserinnen und Leser. Es richtet das Augenmerk von Führungspersonen darauf, wie wichtig ein fachkundiger und umsichtiger Umgang mit professionellen Entwicklungsmöglichkeiten ist. In allen Pflegenden steckt die Möglichkeit, eine fachgerechte, einfühlsame und effektive Versorgung von Patienten zu erbringen − wenn sie die ihrem individuellen Entwicklungsstand entsprechende Förderung erhalten. Konsequenzen ergeben sich auch für Personalentwicklung, Stellenbeschreibungen, Leistungsanforderungen und -bewertungen sowie die professionelle Karriere in der Pflege. Damit sich die Möglichkeiten, die in Pflegeexpertinnen und -experten stecken, entfalten können, müssen wir uns von Formalismus, Regeln, Vorschriften und starren Verfahrensweisen befreiten. Gelingt es, verborgene berufliche Entwicklungsmöglichkeiten freizusetzen und die Fähigkeiten von Pflegenden zu fördern, werden sich Führungs- und Organisationsprobleme vereinfachen und der Dienst am Patienten wird an Qualität gewinnen. Wer Entscheidungen zu treffen hat, die Pflegende betreffen, wird sich klugerweise mit ihnen absprechen, sie unterstützen und ihre Autorität in ihren Arbeitsfeldern anerkennen.
Wer Pflegende ausbildet, kann ebenfalls eine Lehre aus den provokativen Aussagen dieses Buches ziehen. Greifen wir auf das Wissen, das Pflegeexpertinnen und -experten im Laufe ihrer beruflichen Erfahrung angesammelt haben, zurück, so wirde dies die Lehrpläne verändern. Wir brauchen einen Ansatz zur Erforschung der Pflegepraxis, der andere Mittel anwendet als Aufgabenanalyse, Zuständigkeitslisten und abstrakte wissenschaftliche Konzepte, die nur scheinbar in einem Zusammenhang mit pflegerischen Fragen stehen.
Derart anschauliche Beschreibungen pflegerischer Wirklichkeit wie wir sie in diesem Buch finden, gab es bisher kaum. Bei der Darstellung einzelner Praxisbereiche werden zahlreiche Situationen und Umstände geschildert, in denen pflegerische Kompetenz zum Einsatz kommt und erweitert wird. Diese Beschreibungen werden Lehrende dazu herausfordern, ihren Unterricht wirkungsvoller zu gestalten, um raschere Fortschritte zu erzielen. Wie lassen sich die verschiedenen Abläufe, Grundsätze und Situationen besser miteinander verbinden? Wie lässt sich Lernen ganzheitlicher und wirklichkeitsnaher organisieren? Wodurch lässt sich erreichen, dass Pflegende bei ihren Entscheidungen mehr auf das zurückgreifen, was sie über praktische Situationen wissen als auf abstrakte Grundsätze, die mühsam und umständlich anzuwenden sind? Für alle, denen das öffentliche Bild der Pflegenden am Herzen liegt, ist dieses Buch eine Quelle für Ideen und Bilder, die wir in Gesprächen mit anderen und zur Erweiterung unseres eigenen pflegerischen Selbstverständnisses einbringen können. Dieses Buch zeigt, was Pflegende zum Besten von Patientinnen und Patienten leisten. Patricia Benner hat ein bemerkenswertes und äußerst wertvolles Werk verfasst, das uns allen neue Einblicke eröffnet in das Wirken engagierter Pflegender.
Myrtle K. Aydelotte
Ehemalige Geschäftsführerin der Vereinigung der amerikanischen Pflegefachpersonen
Professorin am College of Nursing
University of Iowa
Einleitung
Dieses Buch beruht auf vertieftem Nachdenken über pflegerisches Handeln und auf Gesprächen mit Pflegenden. Im Rahmen unseres Forschungsansatzes zeigten sich fünf Entwicklungsstufen in der Pflegepraxis: Anfänger, fortgeschrittene Anfänger, kompetente Pflegende, erfahrene Pflegende und Pflegeexperten. Diese Stufen werden hier mit den Worten von Pflegenden beschrieben, die einzeln oder in Gruppen befragt und beobachtet wurden. Viele Situationen, in denen Pflegende effektiv zum Wohl des Patienten beitragen konnten, haben wir in dieses Buch aufgenommen. In Beispielen kommt anschaulich zum Ausdruck, wodurch gute Pflege sich auszeichnet. Dabei handelt es sich nicht um abstrakte Ideale, sondern um Realitäten in einem Umfeld, das von Unvollkommenheit und unvorhersehbaren Ereignissen geprägt ist. Pflegende bemühen sich Tag für Tag, diese Ungewissheit zu meistern.
Ein Wort an die Skeptiker
Wer die Beispiele liest, empfindet möglicherweise Zweifel und sich fragt sich, ob das beschriebene Vorgehen in der Pflegepraxis überhaupt möglich ist. Solche Skepsis ist berechtigt, denn die Beispiele beziehen sich auf außergewöhnliche klinische Situationen, in denen Pflegende neue Einsichten gewonnen haben oder einen bedeutsamen Beitrag zum Wohl eines Patienten geleistet haben. Beruht diese Skepsis auf einer grundsätzliche Ernüchterung über die Möglichkeit, als Pflegende einfühlsam und wirkungsvoll zu handeln, – dann bietet dieses Buch dem Zweifelnden eindringliche Gegenbeweise. Ein Hoffnungsstrahl für die Ernüchterten wird sichtbar.
Sinneswahrnehmung als Ursprung ausgezeichneten pflegerischen Könnens
Dieses Buch stellt einige der unerschütterlichen Überzeugungen und Annahmen im Bereich professioneller Pflege in Frage. Wir behaupten, dass Wahrnehmen eine zentrale Rolle für die Qualität pflegerischer Entscheidungen spielt. Häufig bilden vage Ahnungen und allgemeine Einschätzungen den Ausgangspunkt der Pflege. Eine systematische Analyse findet zunächst noch nicht statt. Theoretische Klarheit steht oft nicht am Anfang, sondern erst am Ende des Prozesses. Pflegeexpertinnen und -experten beschreiben ihre Wahrnehmungen oft mit Worten wie «ich hatte ein ungutes Gefühl », «es kam mir seltsam vor» oder «ich ahnte, dass irgendetwas nicht stimmte». Solche Worte sind für Lehrpersonen und Praktikerinnen problematisch. Denn es gilt, über solche ersten Eindrücke hinauszugehen und zu belegbaren Schlussfolgerungen zu kommen. Pflegeexpertinnen und -experten wissen, dass mehr als nur vage Vermutungen notwendig sind, um die Verfassung eines Patienten klinisch zu beurteilen. Ihre Erfahrung hat sie jedoch gelehrt, sich bei der Informationssuche auch von unscharfen Empfindungen und Eindrücken leiten zu lassen.
Auf der Suche nach wissenschaftlichen Begründungen übersehen Pflegende, Ärzte und Berater häufig, wie bedeutsam die Wahrnehmungsfähigkeit ist. Wären Pflegende seelenlose Computer oder Monitore, so wären sie auf eindeutige Signale angewiesen, um einen bestimmten Aspekt eines Problems zu erkennen. Glücklicherweise können Menschen bei ihren Entscheidungen auf eine ganzheitliche Gestaltwahrnehmung zurückgreifen. Sie reagieren auf feinste Veränderungen bei einem Patienten, indem sie nach weiteren Informationen suchen und dabei vom Team unterstützt werden. Experten und Expertinnen bleiben niemals bei bloßen Vermutungen stehen. Zugleich lassen sie jedoch auch vage Vermutungen niemals unbeachtet. Sie begreifen sie als Chance, um ein Problem möglichst früh zu erkennen, um nach weiteren Informationen zu suchen, die Klarheit schaffen können.
Entscheidungsspielräume
Es wäre nicht in unserem Sinn, das hier beschriebene Modell des Kompetenzerwerbs als Plädoyer für unsystematisches Lernen und für eine Rückkehr zu frühen Ausbildungsformen zu verstehen. Dies wäre ein Missverständnis. Deshalb möchten wir erwähnen, dass wir ein Modell des Kompetenzerwerbs verwendet haben («Dreyfus-Modell»), das ursprünglich im Rahmen eines Forschungsprojekts für Piloten in Notfallsituationen entstand. Piloten fliegen nicht einfach los, um durch Versuch und Irrtum ein Gefühl für das Flugzeug zu entwickeln. Unter diesen Bedingungen würde ein angehender Pilot nicht einmal seine Grundausbildung überleben. Dasselbe gilt für die Pflege. Pflegerische Tätigkeiten sind mit ebenso gro- ßen Risiken verbunden − sowohl für Patienten als auch für Pflegende. Es bedarf gut geplanter Unterrichtsprogramme, um fähige Pflegefachpersonen auszubilden. Fähigkeiten durch Erfahrung zu erwerben, gelingt sicherer und schneller, wenn eine solide Grundausbildung vorhanden ist.
Die Absicht dieses Buches besteht darin, die Grenzen formaler Regeln aufzuzeigen und auf die Bedeutung der Urteilsfähigkeit der Pflegenden hinzuweisen. Das heißt nicht, über die Prinzipien von Physiologie, Krankenpflege und Medizin hinwegzusehen. Wir plädieren nicht für Chaos und Anarchie. Auch behaupten wir nicht, es gäbe keine Regeln – das wäre so, als erlaubten wir, generell die Regeln der Asepsis außer Acht zu lassen, nur weil unter Notfallbedingungen manchmal auf steriles Arbeiten verzichtet werden muss. In außergewöhnlichen Situationen dürfen allgemeingültige Grundsätze nicht einfach ignoriert werden. Ich befürworte keineswegs, sorglos Regeln zu vernachlässigen, sondern vertrete die Position, dass ein sachverständiges, auf Erfahrung gestütztes Erfassen der Situation auch ohne starres Befolgen von Regeln möglich ist.
Sobald die Situation erfasst ist, wird klar, was vernünftigerweise zu tun ist. Dies entspricht den Erfordernissen der Situation besser als sich starren Grundsätzen und Regeln zu unterwerfen. Es könnten immer neue Regeln erzeugt werden, um eine große Spannbreite von Ausnahmen zu berücksichtigen. Doch ein Experte oder eine Expertin wissen auch in neuen Ausnahmesituationen, was das Richtige ist.
Dieses Buch beschäftigt sich mit riskanten, situationsspezifischen Entscheidungen, über die man normalerweise nicht spricht. Sich hinter Regeln und vorgegebenen Verfahrensweisen zu verstecken, stellt für Menzies (1960) eine Form der Angstabwehr dar. Es handelt sich um eine Bewältigungsstrategie, die zusätzlich belastend ist, weil sie echte Erkenntnis verhindert und dem eigentlichen pflegerischen Handeln im Weg steht.
Die ungeschminkte Realität
Manche Leser hätten es wahrscheinlich bevorzugt, wenn ich nur Beispiele ausgewählt hätte, in denen eine vorbildliche Zusammenarbeit und eine ideale Beziehung zwischen Ärzten und Pflegenden zum Ausdruck kommen. Tatsächlich haben mich Ärzte und leitende Pflegefachpersonen darauf angesprochen. Beispiele, in denen die Beziehung zwischen Ärzten und Pflegenden in einem negativen Licht erscheinen, finden sie problematisch. Auch ich hätte mir gewünscht, bei dieser Untersuchung nur auf vorurteilsfreie, kooperative Beziehungen zwischen Pflegenden und Ärzten zu stoßen. Das wäre jedoch reines Wunschdenken und keine beschreibende Forschung – ein ideales Modell anstelle eines empirisch überprüften. Probleme zwischen den Berufsgruppen sind in dieser Studie eher zu wenig thematisiert, wenn man berdenkt, wie viel Raum dieses Thema in den Interviews einnahm.
In der Realität haben Pflegende und Ärzte gute und schlechte Tage. Ist ärztliche Hilfe in Krisensituationen nicht sofort verfügbar, springen Pflegende viel häufiger ein als offiziell zugegeben wird. Wer sagt, es handle sich hier nicht um Pflege, lässt außer Acht, was Pflegende in ihrem Beruf tatsächlich tun. Eine Leistung gilt als ausgezeichnet, wenn trotz widriger Umstände (z.B. keine kooperative Beziehung oder keine ursprünglich pflegerische Aufgabe) für den Patienten getan wurde, was notwendig war. Hätten wir nur ein Idealbild dargestellt, wäre uns vieles entgangen, was charakteristisch für die heutige Pflegepraxis ist. Nicht zu wissen, wer und was wir jetzt sind, macht es uns schwer, dahin zu gelangen, wo wir in Zukunft sein möchten.
Pflegeperson-Patienten-Beziehung: Nähe und Distanz
Zu Recht mag die Leserin oder der Leser die Repräsentativität dieser Arbeit in Frage stellen. Es war nicht das Ziel, den ganz normalen Alltag zu beschreiben, sondern die Höhepunkte − die Momente, in denen praktisches Wissen erweitert wird. Die Teilnehmenden wurden gebeten, klinische Situationen zu beschreiben, die sich durch etwas Besonderes auszeichneten. Pflegende sind Tag für Tag in engem Kontakt mit Patienten. Den größten Teil der Zeit sind sie sich nicht bewusst, welchen Einfluss ihre Handlungen auf die Patienten haben. An viele Begegnungen erinnern sich Pflegende später nicht mehr. Die Beziehung zwischen Patienten und Pflegenden stellen ein Kaleidoskop aus Nähe- und Distanzmomenten dar. Dabei handelt es sich um einige der dramatischsten, ergreifendsten und auch unscheinbarsten Momente im Leben. Die unscheinbaren Augenblicke wurden hier ausgespart, denn unsere Forschungsstrategie legte das Hauptaugenmerk auf außergewöhnliche klinische Situationen. Da wir herausragende Leistungen darstellen wollten, sind keine negativen Beispiele aufgeführt, in denen Fehler gemacht wurden (Beispiele für das Erkennen von Defiziten enthält der Beitrag von Fenton, S. 248ff.)
Nur ein Anfang
Es beunruhigt mich, dass die 31 beschriebenen Kompetenzen für «absolut» angesehen werden könnten, um daraus ein starres System zu errichten bzw. eine ein für alle Mal festschriebene Kompetenzliste daraus zu machen. Die Absicht dieser Arbeit liegt darin, Pflegende zu motivieren, ihre eigenen Beispiele zu sammeln und sich mit Forschungsfragen zu beschäftigen, die sich aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz ergeben. Diese Arbeit stellt neue Sichtweisen der Pflegepraxis vor, was auch heißt, dass wir die Beschreibung dieser Praxis am Ende nicht wieder auf einen vereinfachten, geradlinigen Problemlösungsvorgang reduzieren möchten. Eine solche Schematisierung und Verkürzung würde ein volles Verständnis für die Vielschichtigkeit und Bedeutung unserer Arbeit nur verhindern. Eine Pflegende meinte: «Wisst ihr, ich habe heute sehr schnell gehandelt und einem Kind das Leben gerettet. Das ist doch etwas Besonderes!» Offensichtlich war ihr die Bedeutung ihres Handelns gar nicht klar gewesen, als sie ihren schriftlichen Bericht verfasste.
Ich bin den Kolleginnen und Kollegen dankbar, die diese Arbeit bereichert haben, indem sie Beispiele für die praktischen Anwendungsmöglichkeiten dieser Arbeit beisteuerten und einen ersten Ausblick ermöglichten.
Patricia Benner
Diese Arbeit entstand im Rahmen eines staatlich finanzierten Projekts «Entwicklung von Methoden beruflicher Konsensfindung, Leistungsmessung und Beurteilung» (Achieving Methods of Intra-professional Consensus, Assessment, and Evaluation, AMICAE). Ziel des Projekts war, Bewertungsmethoden für die sieben teilnehmenden Pflegeschulen und fünf Kliniken in San Francisco und Umgebung zu entwickeln.
Danksagung
Grundlage für dieses Buch war ein Gemeinschaftsprojekt mit vielen Beteiligten. Unser Dank gilt allen denjenigen, die mit uns zusammengearbeitet haben und uns ermöglicht haben, mit unseren Fragebögen und Interviews über 1.200 Pflegende zu erreichen. Die Untersuchung wäre ohne die seit zehn Jahren bestehende Zusammenarbeit zwischen Pflegediensten und Ausbildungsinstitutionen nicht zustande gekommen. Diese Zusammenarbeit wird vom San Francisco Committee on Nursing and Nursing Education unter der Leitung von Dr. Helen Nahm gefördert.
Zu Dank verpflichtet sind wir allen Pflegedienstleiterinnen und Pflegedienstleitern der beteiligten Kliniken sowie den Leitungspersonen der teilnehmenden Pflegeschulen. Sie haben dieses Projekt möglich gemacht.
Mitarbeiter des AMICAE-Projekts waren maßgeblich an den Untersuchungen beteiligt. Ruth Colavecchio, Deborah Gordon und Judith Wrubel assistierten bei den Interviews und deren Auswertung. Deborah Gordon führte auf zwei chirurgischen Stationen ausgiebige Beobachtungen und Befragungen durch. Ruth Colavecchio erarbeitete in Zusammenarbeit mit einer der beteiligten Kliniken ein Karrieremodell, das auf dem Dreyfus-Modell des Kompetenzerwerbs basiert. Kathy Fields besonderes Interesse galt einer neuen Form, pflegerische Kompetenzen zu beschreiben. Ihr Beitrag ermöglichte es, die Gespräche effektiv zu protokollieren. Sie verfasste auch das Manuskript und arbeitete an der Herausgabe des Buches mit. Denise Henjum transkribierte die Interviews.
Besonderer Dank gilt Prof. Hubert L. Dreyfus und Prof. Stuart E. Dreyfus, die uns mit ihrem fachlichen Rat bei der Anwendung ihres Modells auf die Pflegepraxis unterstützten. Auch den vielen Pflegenden, die an der Untersuchung beteiligt waren, möchte ich meinen Dank aussprechen. Ich hoffe, dass in diesem Buch die Leistungen der Pflegenden gewürdigt werden, die uns sehr motiviert und engagiert ihre Praxis beschrieben haben und sich bei ihrer Arbeit über die Schulter blicken ließen. Ihre Geschichte ist es, die auf den folgenden Seiten erzählt wird. In ihren Beschreibungen von Pflegesituationen widerspiegelt sich ihre Erfahrung und ihre Hingabe an ihren Beruf. Die Einzigartigkeit des Fachs und der Kunst der Pflege kommt zum Vorschein. Themen, die den Kern der Pflege ausmachen − Einsatz für den Patienten, Fachkenntnis und Engagement − wiederholen sich immer wieder in den Berichten der Pflegenden.
Dankbar bin ich der Herausgeberin Edith (Pat) Lewis für ihre unermessliche Hilfe beim Entstehen des Buches. Ihre gründliche Kenntnis der Pflege ermöglichte ihr, den Wert dieser Arbeit zu erkennen und sie durch ihre scharfsichtige Unterstützung in die richtige Richtung zu lenken.
Zu Dank verpflichtet bin ich auch dem Verlag Addison-Wesley, insbesondere Nancy Evans, der Hauptherausgeberin sowie Jan de Prosse, dem Herstellungsleiter. Beide trugen durch ihre professionellen Rat entscheidend dazu bei, aus einer Monografie ein Buch zu machen. Ihr Feedback, ihr inhaltliches Interesse und ihr hoher Anspruch kamen dieser Arbeit sehr zugute.
Dankend erwähnen möchte ich schließlich noch folgende Personen, die das Manuskript vor der Veröffentlichung durchgesehen und wertvolle Anregungen beigesteuert haben: Kathleen Fisher, University of Michigan Hospitals; Marian Langer und Mary Hutchings, St.John’s Hospital, St.Louis; Sydney Krampitz, University of Kansas; Shirley Martin, University of Missouri; Rosalyn Jazwiec und Teresa Tapella, Northwestern Memorial Hospital.
P.B.
Exzellente Pflege im 21. Jahrhundert
Patricia Benners Impulse für eine patientensensible Pflegepraxis
Dr. Diana Staudacher
Eine Zeitenwende in der Pflege
Die Perspektive des Patienten einnehmen, um ihn «von innen her» zu verstehen − das ist für Patricia Benner der Ausgangspunkt professioneller Pflege. Sie motiviert Pflegende, sich folgende Fragen zu stellen: Was erlebt dieser Mensch im Moment? Was empfindet er? Was braucht er in dieser Situation?
Pflegen beginnt für Patricia Benner mit «Hineindenken» und «Einfühlen» in den Patienten. Dies nennt sie «Intuition». Mit diesem Begriff möchte sie darauf aufmerksam machen, dass professionelles Pflegen weit mehr umfasst als «technisches», regelgeleitetes Können und medizinisch-naturwissenschaftliches Wissen. Denn Pflegende begegnen Personen, deren Identität durch ihr Kranksein radikal bedroht und verändert wurden (Benner, 2004). Krankheit, so betont Patricia Benner, betrifft niemals den Körper allein. Eine Erkrankung zieht immer auch das «innerste Selbst» eines Menschen in Mitleidenschaft. Seine körperliche und seine seelische Integrität werden durch die Erkrankung empfindlich verletzt. Patricia Benner spricht deshalb von der «veränderten Identität» («altered identity») und vom «andersartigen Selbstempfinden» («altered sense of self») des erkrankten Menschen (Benner, 2004). Aus dieser Sichtweise leitet Patricia Benner ihr Pflegeverständnis ab. Professionelle Pflege wendet sich an Menschen in Situationen äußerster Verletzlichkeit («persons made vulnerable by illness and injury») (Benner, 2004). Diese Verletzlichkeit erfordert schützendes und somit ethisches Verhalten.
Für Patricia Benner ist professionelle Pflege ein durch und durch ethisches Handeln zum Schutz des körperlich und seelisch verletzten Menschen. Pflege umfasst
das vertiefte Verstehen erkrankter Menschen («knowing the patient»)das Deuten ihrer Lebenssituation durch Perspektivenübernahme («interpretative hermeneutics»)das Erhalten oder Wiederaufrichten ihres krankheitsbedingt bedrohten bzw. verletzten Personseins («preserving personhood»)klinische Entscheidungen und Interventionen, die ethisch reflektiert sind, d.h. den Werten des Patienten entsprechen («ethical decicion-making», «moral agency»).Patricia Benner fragt nicht abstrakt: «Was ist Pflege?», sondern patientenbezogen: «Was macht Pflege wertvoll für diesen individuellen Patienten?» Ihre Antwort ist scharf profiliert: Wertvoll ist eine wirksame, «exzellente» Pflege, die genau auf die Bedürfnisse und Werte des Patienten abgestimmt ist.
Pflege muss sich an ihrer Wertschöpfung für den individuellen Patienten messen lassen. Deshalb führt Patricia Benner einen Höchstleistungsanspruch in die Pflege ein. Sie strebt «Exzellenz» in der Pflegepraxis an («nursing excellence») und beschreibt, wodurch sich die meisterhafte Pflege von «Experten» auszeichnet. Dieser zugleich patientenzentrierte, ergebnisorientierte und ethikbasierte Ansatz macht ihr Konzept relevant und bedeutsam für die heutige Situation. Die Pflege des 21. Jahrhunderts wird konsequent patientenzentriert und ergebnisorientiert sein, um ihr wichtigstes Ziel zu erreichen: Das körperliche und seelische Befinden des Patienten spürbar zu verbessern und beste Patientenergebnisse zu erreichen. Dies bedeutet «Werte für den Patienten» («value for patients») zu schaffen (Porter & Olmsted Teisberg, 2006).
Um beste Patientenergebnisse zu erreichen, sind professionelle Höchstleistungen erforderlich, die weit über technische, regelgeleitete Fertigkeiten hinausgehen: Psychosozial und ethisch hoch kompetente Fachpersonen sind gefragt. Mit diesem professionellen Anspruch leitet Patricia Benner eine Wende im Pflegeverständnis ein (Brykczinski, 2010). Sie
führt das Patientenerleben bzw. die Patientenperspektive/Innenperspektive in das pflegerische Wahrnehmen ein («phänomenologische Wende»)beschreibt Pflegen als ein verstehendes, interpretierendes Handeln («hermeneutische Wende»)betont die Untrennbarkeit von ethischem und klinischem Handeln («ethische Wende»).Damit vollzieht Patricia Benner einen Paradigmenwechsel im pflegerischen Denken und Handeln (Nelson, 2004): Sie durchbricht das geltende naturwissenschaftlich-«objektive», kognitiv-analytische Paradigma (Chinn, 1985). Ihr Blick richtet sich auf das innere Erleben des Patienten: Professionell pflegen heißt «sich dem Erleben des Patienten zu verpflichten» («to attend to the lived experiences») (Benner, 2004). Diese Innensicht des Patientenerlebens hat Patricia Benner für die Pflege eröffnet.
Wegweiserin der professionellen Pflege
Patricia Benner zeigte zukunftsorientierte Wege auf, wie Pflegende ihre klinischen Fertigkeiten immer weiter verfeinern können, um mehr Verantwortung für Patienten zu übernehmen und eine höhere professionelle Autonomie zu erreichen. Auf diese Weise hat sie wesentliche Fortschritte in der professionellen Pflege vorbereitet und gefördert:
Professionalisierung und Akademisierung der Pflege (Wynd, 2003)«Advanced Nursing Practice» (vertiefte Pflegepraxis; Hamric et al., 2004)Expertenpflege (Brykczinski, 1998)Spezialisierung («Specialist Nurses», z.B. Breast Care Nurse, Wound Care Nurse, Multiple Sclerosis Nurse; Royal College of Nursing, 2010) «Nursing Leadership» (Feldman, 2008)Karrieremodelle (Buchan 1999; Shapiro 1998; Snyder 1997; Jones, 1996; Corley et al., 1994; De Vellis 1991)Der Einfluss Patricia Benners auf die moderne Pflege ist kaum zu unterschätzen (Nelson, 2004a). Ihre Publikationen «wurden zur Grundlage für die professionelle Entwicklung und die Arbeitsorganisation in der Pflege. Ihre Schriften beeinflussten weltweit die Lehrpläne der Pflegeausbildung. Auf diese Weise prägt sie bis heute, was wir unter Pflegepraxis und klinischer Expertise verstehen. Anhand ihrer Modelle erklären wir, wie sich pflegerisches Wissen und Können entwickelt» (Nelson, 2004a). Die Kombination von professioneller Höchstleistung, konsequenter Patientenorientierung und einer ausgeprägten ethischen Verantwortung macht Patricia Benners Pflegeverständnis einzigartig − und zukunftsweisend. Was ihre Texte für Pflegefachpersonen heute noch lesens- und bedenkenswert macht, versucht diese Einführung aufzuzeigen. Hierbei werden auch die Grenzen ihrer Konzepte deutlich.
«Vertieftes Patientenverstehen»
Patienten vertieft zu verstehen, bedeutet nach Patricia Benner konkret:
die Person als einzigartiges Individuum wahrnehmen: Was unterscheidet sie von allen anderen mit demselben Krankheitsbild/denselben Symptomen?wissen, wie ein Patient auf bestimme Interventionen, Medikamente etc. reagiertGewohnheiten und Präferenzen kennenkörperliche Belastbarkeit genau abschätzen könnenpsychische Belastbarkeit, innere Ressourcen und Bewältigungsstrategien kennenwissen, was eine Krankheit für einen Menschen in seiner Lebenssituation bedeutetJe besser Pflegende einen Patienten verstehen, desto genauer können sie seinen momentanen Pflege- und Unterstützungsbedarf einschätzeneinen Pflegeplan für ihn erstellen Interventionen auswählen, die seinen Zustand verbessern oder linderneinschätzen, wie pflegerische Interventionen wirken.Vertieftes Patientenverstehen ermöglicht somit, «einen der wichtigsten Werte der Pflege praktisch umzusetzen: Pflege auf die Einzigartigkeit eines individuellen Menschen abzustimmen» (Radwin, 1996). Patricia Benner spricht von «individualisierter Pflege» (Benner & Tanner, 1993). Nur eine «individualisierte Pflege» ist eine menschwürdige, humane Pflege. Patienten nicht zu verstehen, führt zu falschen klinischen Entscheidungen und unwirksamen Interventionen. Fühlen sich Patienten unverstanden und nicht als Persönlichkeit in ihrer existenziellen Lebenssituation erkannt, erleben sie sich in ihrer Würde verletzt und persönlich zurückgestoßen (Hem & Heggen, 2004).
Patienten vertieft zu «verstehen», erfordert von Pflegenden Sensibilität, Wahrnehmungsschärfe, emotionales Engagement und innerliches beteiligt sein. Es geht darum, die Situation des erkrankten Menschen von innen her zu erfassen, «in seine Haut zu schlüpfen». Dabei vergegenwärtigen sich Pflegende den momentanen Zustand des Patienten in ihrem eigenen Körper und in ihrer eigenen Psyche. Ihr eigener innerer Zustand entspricht dann dem Gefühlszustand des Patienten. Dies bezeichnet Patricia Benner als «Übereinstimmung» («attunement») (Benner, 2004, 197).
Pflegen unterscheidet sich also wesentlich von unbeteiligtem, distanziertem und «objektivem» Beobachten «von außen», wie Patricia Benner betont (Benner, 2000).
Ihr Konzept des «Patientenverstehens» gilt inzwischen als wichtige Voraussetzung für verantwortliches klinisches Entscheiden («clinical reasoning») (Radwin, 1995). Wie Studien belegen, kann vertieftes «Patientenverstehen» die Behandlungsergebnisse positiv beeinflussen (Radwin, 1995) sowie Notfälle und Komplikationen verhindern (Benner & Tanner, 1993). Als Erkenntnismethode, die dem vertieften Patientenverstehen entspricht, führt Patricia Benner die «phänomenologische Methode» in die Pflege ein.
Pflegerische Phänomenologie
Menschen leben nicht nur, sondern sie erleben. Was sie erleben hat eine Bedeutung für sie. Mit den Methoden der Naturwissenschaft können wir die Bedeutung, die eine Krankheit für den Menschen hat, nicht erfassen. Naturwissenschaft «entlebt das Erleben und entweltet die uns begegnende Welt» sagt der Philosoph Martin Heidegger (Heidegger, 2001). Deshalb brauchen wir eine Erlebens- und Bedeutungswissenschaft, die sogenannte «Phänomenologie». Menschliches Erleben soll für sich selbst sprechen und sich zeigen dürfen (griechisch: phainomenai).
Anders als Naturwissenschaftler versuchen Phänomenologen
so nahe wie möglich bei der Sache/bei den Menschen und den Dingen zu seinso offen und vorurteilslos wie möglich für die Menschen und die Dinge zu seinsich auf das, was sie sehen und hören, maximal einzulassen (Rezeptivität/Responsivität)zu fragen: Welche Einstellung muss ich wählen, damit sich eine Sache/ein Mensch in seiner Einzigartigkeit und Eigentümlichkeit zeigen kann?Phänomenologen wählen eine besonders erlebensnahe Sprache, die das, was sie beschreibt, den Lesern/Hörern lebhaft vor Augen führt. Phänomenologie bedeutet, körperlich fühlen, was man liest bzw. körperlich fühlen, was man hört. Denn wer etwas verstehen will, muss es zunächst «in sich fühlen».
Für Pflegende kann die Phänomenologie eine wertvolle Methode sein, dem Erleben eines erkrankten Menschen so nahe wie möglich zu kommen und ihn tiefgreifend «von innen her» zu verstehen.
«Existenziales Krankheitserleben»
Angst, Einsamkeit, Sinnbedrohtheit, Haltlosigkeit und Sterblichkeit gehören unausweichlich zum menschlichen Dasein (Heidegger, 2001). Sie sind Grundsituationen der Existenz («Existenzialien»). Doch im Alltag nehmen Menschen diese «Existenzialien» meist gar nicht wahr. Hauchdünne «schützende Filter» (Boss, 1989) trennen sie vom bewussten Erleben der Sterblichkeit oder Einsamkeit. Wird ein Mensch schwer oder lebensbedrohlich krank, so zerreißt dieser «schützende Filter». Kranksein ist – so gesehen − eine schutzlose Konfrontation mit den «Existenzialien» Sterblichkeit, Endlichkeit, Angst, Sinnbedrohtheit, Haltlosigkeit und Einsamkeit. Krank zu sein bedeutet, «dem Menschenwesen auf den Grund blicken» (Binswanger, 1994).
Diese «existenziale» Betrachtungsweise sensibilisiert Pflegende für das, was in erkrankten Menschen innerlich vorgeht. Die phänomenologische Methode ermöglicht ihnen, Krankheitszeichen menschenbezogen und erlebensorientiert zu verstehen und zu beschreiben. Patricia Benner entwickelt eine «interpretative hermeneutische Phänomenologie» als Grundlagenwissenschaft der Pflege.
Pflegerische Phänomenologie bedeutet:
den inneren Zustand eines Patienten zu lesen («reading emotional states») – anhand von Gesten, Gesichtsausdruck, Stimme, Haltung u.a. (Benner 2000b, 15).die existenziale Verletzlichkeit und Schutzbedürftigkeit eines erkrankten Menschen zu erfassen und zu lindernden verletzten Selbst- bzw. Weltbezug zu erfassen und wiederherzustellen.Pflegerisches Wahrnehmen ist für Patricia Benner identisch mit phänomenologischem Wahrnehmen. Sie betont, dass sich die phänomenologische Methode direkt auf die tägliche Praxis auswirkt: Der phänomenologische Ansatz verhindert ein standardisiertes, regelhaftes Pflegen ohne Ansehen der Person, ihres Erlebens und ihrer Lebenswelt («human experience of illness in particular lifeworlds»).
Krankheiten werden körperlich empfunden und zugleich seelisch erlitten. Jeder Mensch erlebt eine Erkrankung anders. Sein Krankheitserleben ist einzigartig und persönlich geprägt. Deshalb ist jedes helfende Geschehen für den kranken Menschen ein hermeneutisches Geschehen, ein Bedeutungsverstehen – und somit kein rein sachliches, naturwissenschaftliches Geschehen. Eine rein naturwissenschaftlich orientierte Pflege würde das Erleben und Bedeuten nicht berücksichtigen.
Patricia Benners Methode der «interpretativen Phänomenologie und Hermeneutik» (Benner, 1994b) ist somit eine unverzichtbare Voraussetzung, um Patienten tiefgreifend zu verstehen und zugleich «die Verletzlichkeit eines Patienten zu begrenzen, ihn vor Schaden zu bewahren sowie eine heilsame Umgebung und Beziehung zu gestalten» (Benner, 1990, 16).
Das pflegerische Menschenbild
«Wir brauchen andere, die uns helfen, sonst würden wir unsere körperlichen und seelischen Verletzungen nicht überleben. Wir sind auf die Hilfe und Unterstützung anderer angewiesen, die von Zeit zu Zeit an unsere Stelle treten und für uns das tun, was wir aus eigener Kraft nicht mehr vermögen» (MacIntyre 2001, 87). Dieses Bild des verletzlichen, auf Hilfe und Zuwendung angewiesenen Menschen legt Patricia Benner allem pflegerischen Handeln zugrunde. Verletzlichkeit und aufeinander angewiesen sein, sollten nicht negativ als «Schwäche» bewertet, sondern als Grundsituation jedes Menschen anerkannt, bejaht und bewusst gelebt werden. Werte wie «Autonomie», «Selbstständigkeit» und «Unabhängigkeit» entsprechen nicht der Lebenswirklichkeit erkrankter Menschen. Auch am Anfang und am Ende des Lebens sowie in Zeiten der Krankheit sind wir ohne die Hilfe unserer Mitmenschen nicht überlebensfähig. Patricia Benner hat immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Pflegen den höchsten Wert einer Gesellschaft darstellt, da er alle anderen gesellschaftlichen Tätigkeiten überhaupt erst ermöglicht: Sie spricht vom «Vorrang der Fürsorge» bzw. von der «Priorität der Pflege» («primacy of caring»): «Pflegen und Fürsorge sind lebensermöglichende Tätigkeiten. ‹Vorrang der Fürsorge› stellt die Grundlage dar für jedes sorgende, engagierte und Menschen zugewandte Verhalten. Menschen sind weltschöpferisch, indem sie andere pflegen und sich um sie kümmern» (Benner, 2000b, 15). Eine Gesellschaft mit vielen pflegebedürftigen, chronisch kranken und alten Menschen wird nur menschenwürdig sein können, wenn sie sich in eine fürsorgende Gesellschaft entwickelt. Professionell Pflegende sind schon heute soziale Vorbilder einer «Kultur der Fürsorge» («caring culture»).
Sie sehen ihre Aufgabe darin,
«sich verletzlicher Menschen anzunehmen, sie zu stützen und ihnen Selbstgewissheit zu verleihen» («to meet, comfort and empower vulnerable others»).«die Verletzlichkeit zu verringern» («limiting vulnerablility»)«die Integrität des Selbst aufrecht zu erhalten» («sustaining the integrity of the self»)In existenziellen Leidenssituationen kann das Selbst eines Menschen so tiefgehend erschüttert sein, dass kein «Selbstmanagement» und kein «Coping» mehr möglich sind. Erkrankte, leidende Menschen brauchen ein Mindestmass an Selbstintegrität und Selbstkohärenz, das nur durch Fürsorge gewährleistet ist (vgl. Halpern & Little, 2011, 144): Kein Coping ohne Caring, keine Selbstständigkeit ohne Fürsorglichkeit, wie Patricia Benner betont: «Der Vorrang der Fürsorge besteht in der Aufgabe, das Selbstempfinden eines Menschen aufrecht zu erhalten und ihm ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln». Sie zitiert die Aussage einer Pflegenden: «Der Patient war sehr verletzlich und fühlte sich sicherer, wenn jemand bei ihm war, der wirklich stark war» (Benner, 1990, 19). Fürsorge bedeutet, «anderen auf eine Weise zu helfen, die ihnen Freiheit gewährt und sie stärkt, ohne ihnen dabei den Willen der Pflegenden aufzuzwingen» (Benner, 2000b, 5).
Klinische Kompetenz
Was bedeutet «Kompetenz» in der Pflege?Patricia Benner hat diesem Begriff eine neue, umfassendere Dimension verliehen: «Patricia Benner fügte den technischen Aspekten der klinischen Kompetenz andere Aspekte hinzu, die weit mehr als technisches Können erfordern, beispielsweise die menschliche Würde des Patienten aufrecht zu erhalten angesichts von Schmerz und psychischem Zusammenbruch oder seelisch-stützendes Anwesendsein sowie Kommunikation durch Berührung. Diese Fertigkeiten erfordern Sensibilität und Engagement für andere Menschen in Situationen der Verletzlichkeit und extremer seelischer Belastung. Bemerkenswert an Patricia Benners Definition ist der zielorientierte Grundzug der Pflegepraxis. Was Pflegende tun, muss immer auf dieses ethische Ziel bezogen sein» (Gastmanns, 2002, 495) Wer klinische Entscheidungen trifft, bestimmt zugleich, was das Beste für einen Menschen in einer bestimmten Situation ist, unterstreicht Patricia Benner (Benner, 2000b, 12). Klinisches Entscheiden ist somit immer ethisch bedeutsam. Ethik kommt also nicht zusätzlich zur Pflege hinzu: Pflegen ist eine ethische Praxis. Ethische Kompetenz stellt also in der Pflege keine Kompetenz unter anderen dar.Sie ist die primäre pflegerische Kompetenz, wie Patricia Benner immer wieder hervorhebt. Pflegefachpersonen sind umso kompetenter,
je mehr sie sich in den individuellen Patienten hineinversetzen könnenje mehr sie sich für ihn engagieren könnenje persönlicher sie seine Pflege gestalten können undje mehr sie sich dabei von allgemeinen Regeln, Normen. Standards und reiner Pflegetechnik lösen können (Benner, 2004, 196-197).Eine regelgeleitete, Leitlinien folgende und die Situation analysierende Pflege wäre im Sinne Patricia Benners keine professionelle Pflege. Denn die drei zentralen Elemente pflegerischer Professionalität fehlen hier: Die Individualität der Interventionen (spezifisch für einen bestimmten Patienten), das ethische Engagement und die ganzheitliche Sichtweise. Analytisches und kritisches Denken sind für Patricia Benner kein Zeichen professioneller Kompetenz. Im Gegenteil: Sie sollten überwunden werden zugunsten einer umfassenden «klinischen Vorstellungskraft» («clinical imagination») (Benner, 2009). Bis heute ist das Verständnis professioneller Kompetenz in der Pflege unscharf (National Nursing Research Unit, King’s College London, 2009) und lässt sich deshalb nur schwer nachweisen, evaluieren und lehren. In der Pflegeausbildung ist häufig unklar, was Pflegende können bzw. wissen müssen (Bradshaw, 1998): Wodurch zeichnet sich eine kompetente Pflegefachperson aus und wie kann sie auf ihre professionellen Aufgaben effektiv vorbereitet werden?
Ist pflegerische Kompetenz ohne analysierendes, kritisches Denken möglich? Klinische Situationen können hoch komplex sein, weshalb Analyse und selbstkritisches Abwägen unverzichtbar sind. Fehlen sie, setzt die Pflegende den Patienten ungerechtfertigten Gefahren aus (Bradshaw, 1998, Eraut, 1994). Professionelle Kompetenz sollte immer selbstkritisch sein. Nur Selbstkritik kann Pflegende davor schützen, ihrer «klinischen Vorstellungskraft» naiv zu vertrauen. Entscheidende Informationen können fehlen, nicht äußerlich beobachtbar und nicht im Erfahrungswissen verfügbar sein. Patricia Benners Verständnis von Kompetenz ist allzu optimistisch und kaum evaluierbar (Bradshaw, 1998). In Zukunft wird es erforderlich sein, pflegerische Kompetenz nachzuweisen. Umso wichtiger ist es, Kompetenz-Standards zu definieren und diese kontinuierlich an den aktuellen Stand der klinischen Praxis und Forschung anzupassen.
Auch das biomedizinische Wissen, das für pflegerische Kompetenz unverzichtbar ist, kommt bei Patricia Benner nicht ausreichend zur Geltung (Bradshaw, 1998).
Expertise und Exzellenz
«Die Fähigkeit, sich in Patienten hineinzuversetzen und ethische Handlungsfähigkeit («moral agency») zu entwickeln, führt zu pflegerischer Expertise» (Benner, 2004, 188). Expertinnen und Experten in der Pflege sind daran zu erkennen, dass sie
schnell und sicher handeln können, weil sie den Patienten und seine Situation tiefgreifend verstehenüber hervorragende klinische Fertigkeiten verfügen und wissen, wann und wie sie sie einsetzen müssendas ganzheitliche Bild sehen («seeing the big picture»): sie nehmen gedanklich vorweg, wie sich die Situation des Patienten entwickeln wird und denken über den aktuellen klinischen Zustand hinaus.ethische Handlungsfähigkeit besitzen («moral agency»): Die Pflegeperson-Patienten-Beziehung schützt die Verletzlichkeit und das bedrohte Selbst des Patienten.Nicht alle Pflegenden können jedoch zu «Experten» werden, wie Patricia Benner betont: «Wer Schwierigkeiten hat, zwischenmenschliche Fähigkeiten und Engagement auszubilden, erreicht die Expertenstufe nicht» (Benner, 2004; 88). Das emotionale Engagement der Pflegenden ist die Grundlage für die Expertenpraxis und ermöglicht den Pflegenden, sich auf den Patienten zu konzentrieren, statt alle Aufmerksamkeit auf ihre Tätigkeiten zu richten («patient focused» statt «task focused») (Bonner & Greenwood, 2003). Eine ausschließlich «rationale, wissenschaftlich objektive» Praxis entspricht nicht Patricia Benners Anforderung an professionelle Pflege. «Ein rein theoriegeleiteter Zugang zur Praxis und eine innere Distanz zum Patienten verhindern, klinische Erfahrung zu sammeln und zu verinnerlichen. Das rational-technische Modell eignet sich nicht, um beziehungs- und wahrnehmungsfördernde Fertigkeiten zu entwickeln» (Benner, 2004; 88). Eine umfassende und genaue Definition pflegerischer Expertise fehlt bis heute (Morisson & Symes, 2011). Expertenerfahrung ist untrennbar mit der Praxis verbunden und lässt sich akademisch nicht vermitteln bzw. in der Ausbildung lehren, so Patricia Benner. Dennoch sollten Pflegepersonen die besonderen Kompetenzen von Experten kennen und auch beschreiben können, wodurch sie sich auszeichnen (Adams et al., 1997). Was Experten charakterisiert, sollte bewusst und beschreibbar sein. Dies würde Pflegenden ermöglichen, den Wert ihrer Praxis einzuschätzen und die Fertigkeiten zu verstehen, die es braucht, um Patienten in Zeiten erhöhter Verletzlichkeit zu pflegen – in allen Settings und pflegerischen Rollen (Morrisson & Symes, 2011).
«Nursing Presence»: Pflegerische Nähe
Menschen in existenziell erschütternden Situationen brauchen an ihrer Seite eine starke pflegerische Persönlichkeit, die ihr verletztes Selbst schützen und aufrecht erhalten kann. Umso wichtiger ist die Art und Weise, wie Pflegende bei ihren Patienten anwesend sind (Benner, 2004). «Mit-Sein» mit dem Patienten bedeutet nicht nur körperlich anwesend sein, sondern auch seelisch stützend für ihn zu sein. Dies ist oft genauso wichtig wie etwas «für den Patienten zu tun». Pflegende sollten sensibel dafür sein, «wie viel Nähe ein Patient braucht in äußerst verletzlichen, tragischen Situationen» (Benner, 1992, 111).
Dem Patienten innerlich, seelisch nahe zu sein, beschreibt Patricia Benner als Qualität der emotionalen Verbundenheit («emotional connection») (Benner, 2004): Sich mit dem Erleben des Patienten verbinden (Doona et al., 1999, 54). Eine unerträgliche Situation kann dadurch erträglich werden. Pflegerische Nähe («nursing presence») wirkt also transformierend und therapeutisch. Die krankheitsbedingt verletzte Selbstintegrität der Patienten wird dadurch gestärkt. Sie erleben «nursing presence» als «Energie», um ihr Selbst aufrecht zu erhalten. Patricia Benner spricht von der «existenziellen Praxis des Mit-Seins mit dem Patienten» («existential practice of being with a patient») und zählt sie zu den Kennzeichen pflegerischer Exzellenz und einer tragende Pflegeperson-Patienten-Beziehung. Je höher die Verletzlichkeit eines erkrankten Menschen, desto sensiblere und stärkere Präsenz ist nötig, um sein Selbst zu schützen. «Pflegerische Nähe und Präsenz» ist ein Mittel gegen den Selbstverlust und verhindert den Zusammenbruch seelischer Widerstandskraft (Resilienz). Professionelle Reife zeichnet sich nach Patricia Benner durch heilsame, d.h. therapeutische Präsenz aus. Je erfahrener die Pflegeperson, desto stärker ihre therapeutische Präsenz und ihre ethische Fähigkeit, die Würde des Patienten in Situationen äußerster Vulnerabilität aufrecht zu erhalten. Für die Pflegeperson selbst stellt intensives «beim Patienten sein» die Grundlage für vertieftes Patientenverstehen dar. Es ermöglicht ihr, individuelle, zur Situation passende Interventionen auszuwählen (Benner & Tanner, 1987). Je erfahrener die Pflegeperson ist, desto intensiver kann sie sich «auf den Patienten in seiner spezifischen Situation» konzentrieren, statt auf die Tätigkeiten, die sie ausführt (Radwin, 1998).
«Psychoneuroimmunologie» der Pflegebeziehung
Eine stützende, feinfühlige Pflegeperson-Patienten-Beziehung wirkt sich messbar auf die Physiologie aus und kann die Patientenergebnisse signifikant beeinflussen (Halldorsdottir, 2008). Mit Hilfe der «Psychoneuroimmunologie» lässt sich inzwischen nachweisen, wie stark das Immunsystem beispielsweise durch Empathie aktiviert wird. Dies wird einschneidende Konsequenzen für die Pflege haben (Halldorsdottir, 2008). Bei einfühlsamer pflegerischer Zuwendung setzt der Organismus vermehrt das Hormon Oxytocin frei (Uvnäs-Moberg, 2003). Dadurch lösen sich bestehende Nervenzellverbindungen und neue werden gebildet: Ein emotionales Umlernen (Desensibilisierung) wird möglich. In solchen Momenten können Menschen dann beispielsweise Hoffnung fassen, d.h. ihre momentane Situation anders als bisher deuten und überschreiten (Kandel, 2006). Wie wir Mitmenschen begegnen wirkt sich auf unsere Immunfunktion aus (Kiecolt-Glaser et al., 2002). Insensibles, distanziertes Pflegen kann Heilungsprozesse verzögern: Entzündungsfördernde Zytokine werden stimuliert durch negative Emotionen und Stresserleben. Eine tragende Pflegeperson-Patientenbeziehung ist deshalb für den Heilungsprozess entscheidend.
Diese Dimension wird zukünftig anhand von physiologischen Indikatoren nachweisbar sein und neue Prioritäten setzen − für das Management und die Pflegeforschung (Halldorsdottir, 2008). Organisation und Rahmenbedingungen der Pflege sollten so gestaltet sein, dass die pflegerische Beziehung optimal zur Geltung kommen kann. Eine der größten Herausforderungen der Pflege wird sein, die Patientenbeziehung maximal förderlich zu gestalten (Noble, 1995). Das Interesse der Forschung sollte sich stärker auf die Frage konzentrieren, wie pflegerische Empathie sich auf den Heilungs- und Bewältigungsprozess auswirkt − und somit die Patientenergebnisse beeinflusst (Hartrick, 1997).
Die patientensensible Erkenntnisweise: Intuition
Als «Intuition» bezeichnete Patricia Benner die spezifisch pflegerische Wahrnehmungs- und Erkenntnisweise. Sie umfasst
«Schärfe der Wahrnehmung» («perceptual acuity»): Hoch komplexe Situationen mit einem Blick fürs Wesentliche klar erfassen, um sicher und schnell klinische Entscheidungen zu treffen.«Denken in Aktion» («thinking in action»): Handlungsorientiert vorgehen: Sofort Prioritäten setzen können, welche Interventionen unverzüglich Vorrang haben und welche zweitrangig sind.«Vorausschauend handeln» («thinking in ongoing situations»): Über den Augenblick hinaus denken, vorwegnehmen, wie sich der Zustand eines Patienten in den nächsten Stunden entwickeln wird, um Vorsorge treffen zu können.Höchste Flexibilität: Jederzeit vorbereitet sein auf Unerwartetes, Unvorhersagbares (z.B. Komplikationen). Bereit sein, Traditionen und Regeln zu brechen, wenn es die Lage des Patienten verlangt: Interventionen stets individuell patienten- und situationsbezogen (nicht «blind» nach einem Schema) auswählen.Pflege ist für Patricia Benner wesentlich ein Geschehen zwischen zwei Personen (Patient und Pflegeperson): Dies verlangt eine Erkenntnisweise, die der Einzigartigkeit des Patienten gerecht werden kann. Häufig ist hierbei wortloses Verstehen notwendig, da «lebenserschütternde» Situationen, Schmerz und Leiden Menschen sprachlos machen. Diesen Besonderheiten der Pflegesituation kann «intuitives» Verstehen entsprechen.
Neurobiologie der Intuition
Was Patricia Benner über Intuition schrieb, ist bis heute unter Pflegenden umstritten (Paley, 1996; Cash, 1995; English, 1993). Kritiker halten Intuition als Erkenntnismethode auf Expertenstufe für «unprofessionell» und «unwissenschaftlich», da Intuition nicht messbar und nicht an andere Pflegende vermittelbar ist.
Patricia Benner war jedoch ihrer Zeit weit voraus. Sie versuchte, etwas zu beschreiben, was wir heute dank der Neurowissenschaften gründlicher verstehen: Menschen besitzen spezielle Nervenzellen, die «intuitives» Verstehen ermöglichen (Gallese et al., 1996). Diese sogenannten «Spiegelneuronen» registrieren Zeichen, die von der Körpersprache anderer Menschen ausgehen: Blicke, Mimik, Stimme, Körperhaltung, Bewegungen. Haben Pflegende beispielsweise einen Menschen vor Augen, der starke Schmerzen hat, werden ihre eigenen Nervenzellen für Schmerzempfinden aktiviert. Ein kurzer Anblick genügt, um sofort «intuitiv» vorwegnehmen zu können, was im nächsten Moment passieren wird: Welche Bewegungen und Empfindungen sind zu erwarten? Die «Spiegelneuronen» bewirken, dass wir in unserem eigenen Körper nacherleben, was in einem anderen Menschen vor sich geht. «Spiegelneuronen» speichern Informationen, die wir sekundenschnell aktivieren können, wenn wir schnell handeln müssen, z.B. in klinischen Krisensituationen. Somit sind diese speziellen Nervenzellen die biologischen Instrumente unserer Intuition. Sie verdeutlichen, wie tief zwischenmenschliches Verstehen und empfindsame Resonanz in unserem Gehirn verinnerlicht sind. Meist messen wir «objektiven» Fakten hohe Bedeutung zu und halten Emotionen für unbedeutend. In unserem Gehirn ist dies jedoch umgekehrt. Nur durch subjektives Empfinden findet unser Bewusstsein überhaupt Zugang zu den Fakten. Das Gehirn «fühlt» sozusagen immer mit. Intuition ist heute anerkannt als auslösendes Moment, um im Gehirn Handlungsprozesse zu aktiveren. Pflegerisches Handeln wird also durchaus durch starkes emotionales Engagement («emotional involvement») eingeleitet (King & Appleton, 1997). In dieser Hinsicht bestätigt die Wissenschaft Patricia Benners Konzept der «Intuition».
Pflege ist ein Beruf, in dem feinste emotionale Resonanzfähigkeit zählt. Dennoch birgt die «intuitive» Erkenntnismethode Gefahren in sich, die hier unbedingt angesprochen werden sollten. Intuition kann zwar helfendes Handeln auslösen, doch es sind kognitive und analytische Gehirnprozesse notwendig, um dieses Handeln wirksam zu gestalten.
Kritische Anfragen an Patricia Benners Pflegeverständnis
Verantwortliches und begründetes klinisches Entscheiden setzt eine unverzichtbare Fähigkeit voraus: «Die Genauigkeit (accuracy) des pflegerischen Diagnostizierens ist entscheidend, um die Einzigartigkeit eines Patienten wahrnehmen. Mangelnde Genauigkeit wirkt sich auf die Pflegequalität aus» (Lunney, 1997, 158; vgl. Lunney, 2001, 1998, Lunney & Paradiso, 1995). Akkurate Pflegediagnosen sind wesentlich, um wirksame Interventionen auszuwählen und bestmögliche Patientenergebnisse zu erreichen. Ungenaue Interpretationen oder Diagnosen führen zu falschen Pflegediagnosen und somit zu unpassenden, möglicherweise sogar schädlichen Interventionen (Lunney, 1997).
Aus dieser Sicht zeichnen sich Expertinnen und Experten in der Pflege durch exzellentes Diagnostizieren und Intervenieren aus (Lunney, 1997). Dies erfordert verfeinerte kognitive Prozesse, beispielsweise Analysieren, Vergleichen, Hypothesen aufstellen, Alternativen ausschließen etc. Hinzu kommt kritisches Denken als «wesentliches Merkmal professioneller Verantwortlichkeit und Garant für die Qualität der Pflege» (Lunney, 1998).
Bis heute steht das Bemühen um genaues Diagnostizieren im Schatten der pflegerischen «Intuition».
Im Zeitalter einer ergebnisorientierten Pflege wird exakte Pflegediagnostik einen entscheidenden Stellenwert einnehmen. Dies erfordert, pflegediagnostische Fähigkeiten und klinisches Urteilen intensiver als bisher zu schulen (Lunney, 2001). Denkprozesse bewusst zu machen, sie fachsprachlich zu benennen und das eigene analytische und konzeptuelle Denken zu schärfen, ist ein Merkmal professioneller Verantwortlichkeit.
Professionelle Pflege erfordert, Körper und Seele gleichzeitig zu betrachten. Fundiertes (patho)biologisches, (patho)physiologisches und organbezogenes Wissen ist eine unverzichtbare Voraussetzung für pflegerisches Diagnostizieren, Intervenieren und Fürsorgen. Denn Pflege befasst sich sowohl mit der Krankheit (biomedizinischer Aspekt, organbezogen, objektiv beobachtbar), als auch mit dem Erleben der Krankheit (psychosozialer Aspekt, erlebnisbezogen, subjektiv beschreibbar) (Käppeli, 1992, 10). Um Pflegequalität gewährleisten zu können, müssen beide Bereiche gleichermaßen berücksichtigt sein (Käppeli, 1992, 10).
Der klassischen biomedizinischen Dimension der Pflege schenkt Patricia Benners Modell oft zu wenig Aufmerksamkeit. Professionelle Pflege setzt nicht nur Patientenverstehen sondern auch biologisches, pathophysiologisches und organbezogenes Verstehen voraus. Die hohe Komplexität des Pflegeberufs erfordert eine doppelte Exzellenz: im körperlich-somatischen (diagnostischen) und im seelisch-psychischen (verstehenden) Bereich.
Der Zukunftsauftrag der Pflege
Patricia Benners Ideen weiterentwickeln und umsetzen.
«Klinische Effizienz»1 und herausragende Patientenergebnisse werden in Zukunft die entscheidenden Zielgrößen sein, an denen Pflege gemessen wird (Porter & Olmsted Teisberg, 2006). «Vertieftes Patientenverstehen» («knowing the patient») im Sinn Patricia Benners eignet sich hervorragend als Grundlage und Leitbild, um eine konsequent patientenzentrierte, ergebnisorientierte Pflege zu verwirklichen. Entscheidend ist jedoch, ihre Konzepte sorgfältig evaluierbar zu machen und sie für die Bedürfnisse der Praxis zu «operationalisieren». Abschließend soll deutlich werden, welche Vorschläge sich hierfür in der aktuellen Forschungsliteratur finden.
Kompetenz in «Performance» übersetzen
Für Patienten ist entscheidend, was Pflegende tatsächlich tun. Wofür sie theoretisch «die Kompetenz» haben, ist nicht relevant für sie (Eraut, 1994). Bedeutsam für die Patientenergebnisse ist somit nicht die pflegerische «Kompetenz» sondern die «Performance» («Leistung»). «Kompetenz» bezeichnet nur die Möglichkeit, etwas zu leisten «potential to perform» nicht die tatsächliche Leistung. Wie Studien zeigen, ist «Kompetenz klinisch nur schwer messbar. Spezifische Instrumente hierfür wurden selten systematisch entwickelt und besitzen häufig keine ausreichende Reliabilität bzw. Validität» (Watson et al., 2002). Umso problematischer ist, dass Kompetenz als solche noch keine hohe Qualität in der Patientenversorgung garantiert (Dolan, 2003): Kompetenz umfasst nur, was eine Person weiß und unter idealen Bedingungen tun kann. Performance beschreibt dagegen das tatsächliche Verhalten im wirklichen Leben. In Zukunft wird deshalb «performance in the real-life clinical setting» einen entscheidenden Stellenwert haben (While, 1994). Somit gilt es «Kompetenz in Performance zu übersetzen». Performance als patienten- und situationssensibles Handeln in der realen Praxissituation wird zum wichtigsten Qualitätsmerkmal in der Pflegeausbildung werden (While, 1994). Das Performance-Verständnis sollte hierbei weit über «technische» Fähigkeiten hinausgehen und die gesamte Komplexität pflegerischen Tuns ins Auge fassen (z.B. wahrnehmende, kommunikative, soziale Dimensionen). «Capable practice» könnte ebenfalls als Qualitätsmerkmal pflegerischer Leistung wichtiger als «Kompetenz» werden. «Capability» zeigt an, wie flexibel Pflegende auf Veränderung eingehen, neues Wissen entwickeln und ihre Praxis verbessern können (Fraser and Greenhalgh, 2001).
Expertise evaluieren
Was Expertinnen und Experten in der Pflege können und wissen, sollte klar beschreibbar, nachweisbar und evaluierbar sein. Vor allem aber sollte es an die kommenden Generationen von Pflegenden in der Ausbildung weiter vermittelt werden (Bleich et al., 2009). Pflegefachpersonen sollten selbst unbedingt Klarheit darüber haben, was genau unter der Experten-Praxis zu verstehen ist. Das Pflegemanagement braucht ebenfalls präzise Antworten auf die Fragen: Wie lässt sich pflegerische Expertise in verschiedenen klinischen Settings charakterisieren? Worin bestehen die Rahmenbedingungen, die eine expertenbasierte klinische Pflegepraxis fördern? Das Kompetenz-Modell von Weiß (2003) spricht eine deutliche Sprache und ermöglicht, die Leistungen der Expertinnen und Experten zu evaluieren. Es enthält vier Kategorien: Expertenurteil (expert judgement), Expertenprognose (expert prediction), Experteninstruktion (expert instruction) und Expertenleistung (expert performance).
«Ethische Sensitivität»
Das Konzept der «ethischen Sensibilität» («ethical sensitivity») (Endicott & Narvaez, 2009; Endicott, 2001) vertieft Patricia Benners unscharfen Begriff der «Intuition» und macht ihn klinisch fassbar.
Ethische Entscheidungen treffen: Ethisch argumentieren, ethische Probleme verstehen, über die Folgen des Handelns nachdenken, Entscheidungen planen.Ethische Motivation: Bewusstsein entwickeln, andere respektieren, verantwortlich handeln, soziale Strukturen wertschätzen, ethische Identität und Integrität entwickeln.Ethisches Handeln: Gelingende Kommunikation anstreben, Bedürfnisse ermitteln, Konflikte und Probleme lösen, die Initiative ergreifen, Ausdauer entwickeln (Endicott, 2001).In der täglichen klinischen Praxis gilt es, klinische Sensitivität aktiv in der Experten-Rolle eines «Fürsprechers für Patienten» («patient advocacy») umzusetzen (Morisson & Symes, 2011).
Teamexzellenz fördern
Die Pflege der Zukunft wird stärker teamorientiert sein. «Exzellenz» wird somit zu einer Eigenschaft von Teams werden, die sich auf die Pflege bestimmter Patientengruppen spezialisiert haben. Exzellente Teams zeichnen sich durch hohe pflegerische und psychosoziale Performance und hervorragendes Fachwissen aus.
Hierarchische Karrieremodelle können dieser Sichtweise nicht mehr ausreichend gerecht werden. Sie sind zwar leistungsmotivierend, aber an der Leistung des Einzelnen und nicht der Teams orientiert. In international führenden Spitälern gilt es inzwischen als Führungsaufgabe, Exzellenz auf allen Ebenen des Pflegeberufs zu fördern (Clifford & Horvath, 1990, 48). Karrieremodelle zu evaluieren, wird eine wichtige Zukunftsaufgabe sein: Wie beeinflussen sie die Patientenergebnisse? Wie wirken sie sich auf die Patientenzufriedenheit aus?
Patricia Benners Botschaften: Die Pflege der Zukunft gestalten
Um die Zukunft der Pflege zu gestalten, formulierte Patricia Benner 2009 eine Reihe von Empfehlungen (Benner et al., 2009). Diese sollen den Abschluss dieser Einleitung bilden. Sie greifen ihre wichtigsten Konzepte und Anliegen nochmals auf. Sie wünscht sich, dass diese Empfehlungen eine Diskussion und Selbstreflexion inspirieren und als Aufruf zum Handeln wirken:
Halten Sie trotz des hohen wirtschaftlichen Drucks an den Kern-Werten der Pflege fest: intelligente klinische Entscheidungen zu treffen («astute clinical judgement»), für die Sicherheit der Patienten zu sorgen und menschliches Leiden zu lindern.Setzen Sie sich für einen radikalen Wandel («radical transformation») der Pflegeausbildung ein.Legen Sie rechtlich fest, dass nur ein Bachelor-Abschluss als Zugang zum Pflegeberuf anerkannt wirdVerpflichten Sie alle Master- und PhD-Studierenden dazu pflegepädagogische Aufgaben zu übernehmen und die zukünftige Generation der Pflegenden zu unterrichten.Entwickeln Sie Lehrmethoden, die Studierende dazu auffordert, die Patientenperspektive einzunehmen. Dadurch trainieren sie, patientenorientierte Entscheidungen zu treffen.Ethik sollte einen hohen Stellenwert im Lehrplan einnehmen. Nicht nur klinisch-ethische Grenzsituationen zu Beginn und am Ende des Lebens sollten im Zentrum stehen sondern die ethische Grundhaltung der Pflegenden. Wissen, klinische Fertigkeiten und ethische Haltung sollten eine untrennbare Einheit bilden.Pflegende sollen zu Akteuren des Wandels ausgebildet werden («agents of change») und darauf vorbereitet sein, Reformen in der Pflegepraxis durchzuführen, einflussreiche Führungspersönlichkeiten zu sein und sich in der politischen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit für ein verbessertes Gesundheitssystem einsetzen. Hierfür brauchen sie Wissen zur Organisationsentwicklung und politischen Entscheidungsfindung sowie Strategien, um Organisationen zu verändern.«Pflegerisch denken» («to think like a nurse») bedeutet, die klinische Situation zu verstehen, wissenschaftlich begründete Antworten auf Symptome zu finden und die Anliegen des Patienten zu berücksichtigen.Professionelle Aufmerksamkeit, Verantwortung und Exzellenz erfordern eine neue ethische Vision für die Pflegeprofession, wobei professionelle Verantwortung, ethisches Verhalten und Rechenschaftspflicht der Dreh- und Angelpunkt ihrer Identität und ihres Handelns sind (Benner, 2009).Zusammenfassung:
Definition professioneller patientensensibler Pflege nach Patricia Benner
Professionelle Pflege setzt vertieftes Patentenverstehen voraus und erfordert von Pflegenden, die Perspektive des Patienten einzunehmen, um eine konsequent individualisierte, d.h. zum Patienten und seiner Situation möglichst perfekt passende Pflege zu gestalten.
Pflege kann nur dann als professionell bezeichnet werden, wenn sie das krankheitsbedingt verletzte oder bedrohte Selbst des Patienten aufrecht erhält und schützt, da ohne diese Fürsorge (Caring) weder Coping noch Selbstmanagement möglich sind.
Professionelle Pflege zeichnet sich dadurch aus, dass sie
alle klinischen Entscheidungen zugleich als ethische Entscheidungen auffasstauf einem Menschenbild der Verletzlichkeit gründetauf intensivem inneren Beteiligt sein am Erleben der Patienten beruht undMenschenwürde als zwischenmenschliches Geschehen auffasst: Würde erlebt ein Patient, wenn er sich in seiner existenziellen Leidenssituation tief verstanden und als individuelle Persönlichkeit erkannt und respektiert erfährt.