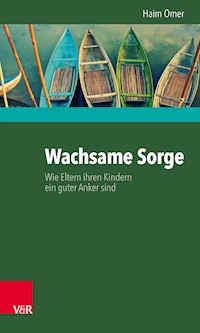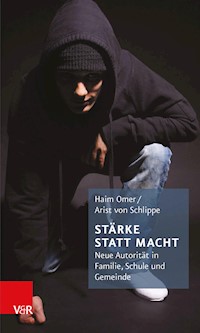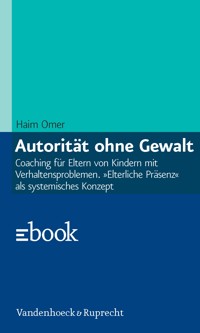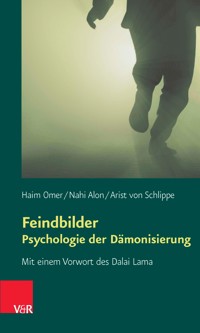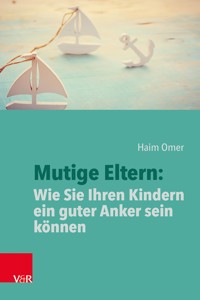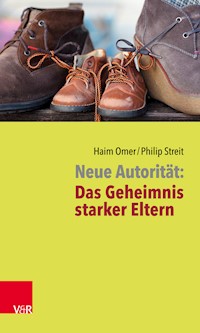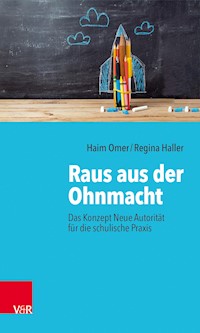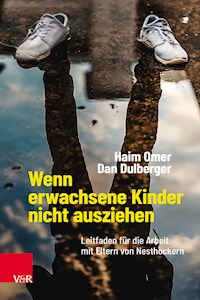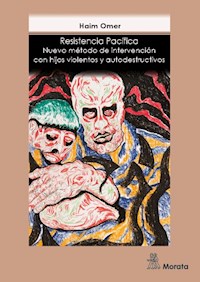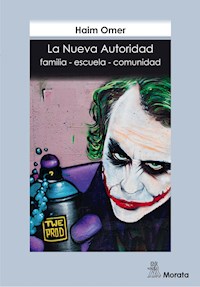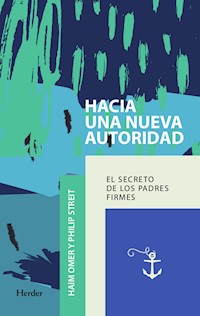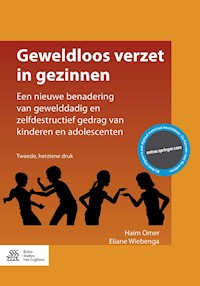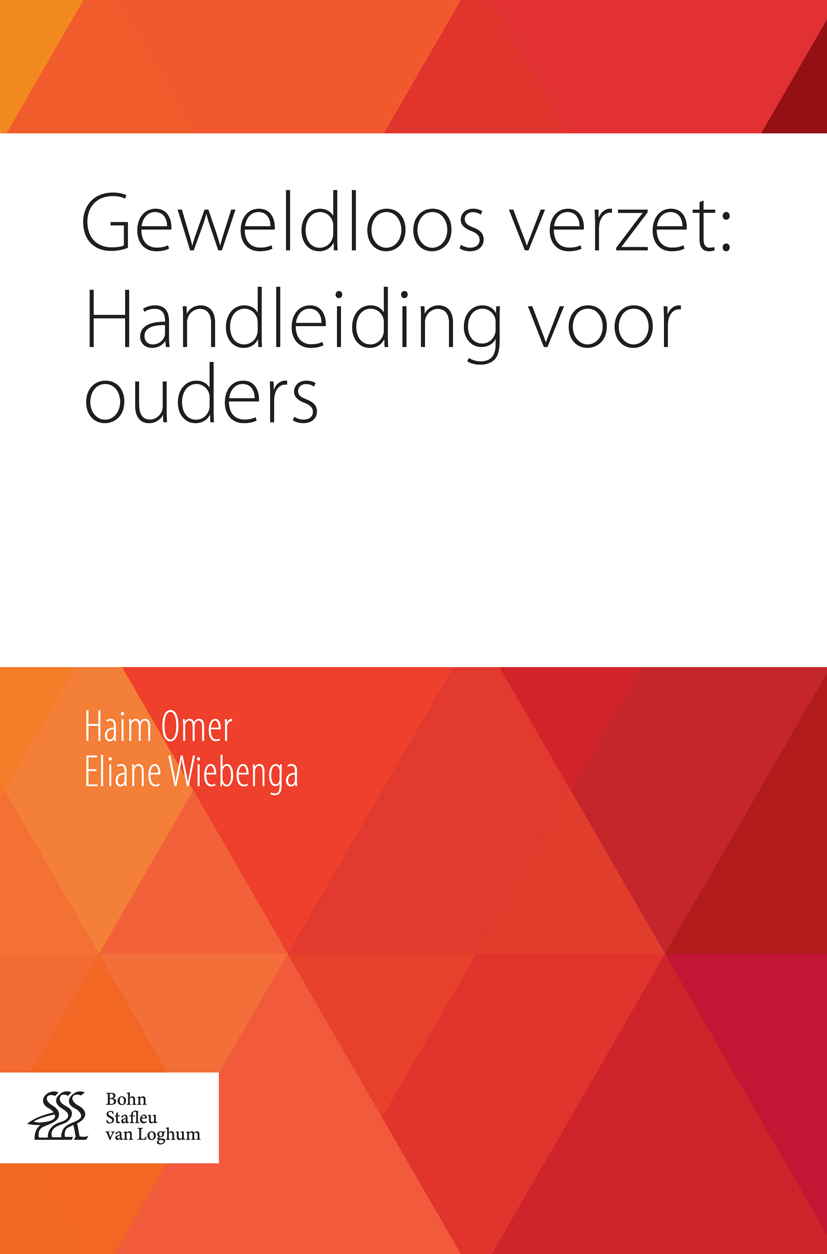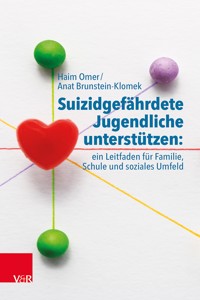
Suizidgefährdete Jugendliche unterstützen: ein Leitfaden für Familie, Schule und soziales Umfeld E-Book
Haim Omer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wenn Jugendliche von Sorgen, Trauer, Angst, Wut, und Enttäuschung überwältigt werden, wenn sich das Leben gerade nicht von seiner sonnigen Seite zeigt und kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, kann der Wunsch aufkommen, nicht mehr auf der Welt sein zu wollen. In der Behandlung von suizidgefährdeten Jugendlichen ist eine Einzeltherapie oft das Mittel der Wahl. Was aber tun, wenn Jugendliche diese Form der Therapie ablehnen und sich die Eltern mit ihren Nöten nicht ausreichend berücksichtigt fühlen? Was, wenn das schulische Umfeld außen vor bleibt, selbst wenn schulische Ereignisse mit der Krise in Verbindung stehen? Wie dafür sorgen, dass alle Beteiligten in der Familie, in der Schule, in der Klinik, im Freundes- und Bekanntenkreis untereinander vernetzt sind? Haim Omer stellt in diesem Buch gemeinsam mit Anat Brunstein-Klomek einen neuen Ansatz zur Suizidprävention vor, der auf seinem Konzept der "Neuen Autorität" basiert. Dieses ist einzigartig und bezieht systemisch das gesamte Netzwerk der betroffenen Jugendlichen ein, Fachleute und Familien werden ermutigt, an einem Strang zu ziehen und gemeinsam zu unterstützen. Eltern ist es wieder möglich, ihrem Kind nahe zu sein. Sie fühlen sich in ihrem Stress und ihrem Schmerz ernst genommen und können Distanziertheit, Verzweiflung, Panik und Wut erkennen und überwinden. Dieses Buch verrät praxisnah und anhand vieler Fallbeispiele, wie es gelingt, dass eine gemeinsame Sprache zwischen allen entsteht, die Teil der Krise sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Haim Omer / Anat Brunstein-Klomek
Suizidgefährdete Jugendliche unterstützen:
ein Leitfaden für Familie, Schule und soziales Umfeld
Aus dem Englischen von Rachel Grünberger-Elbaz
VANDENHOECK & RUPRECHT
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2025 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill BV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill BV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Myrarte/Shutterstock.com
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
EPUB-Erstellung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
E-Mail: [email protected]
ISBN 978-3-647-99256-3
Inhalt
Einleitung
Eltern und pädagogische Fachkräfte
Gewaltloser Widerstand, Neue Autorität und die Ankerfunktion
Erstes Kapitel: die Neue Autorität und andere suizidverhindernde Ansätze
Dialektisch-Behaviorale Therapie
Kognitive Verhaltenstherapie in der Suizidprävention
Interpersonelle Therapie für Jugendliche
Bindungsbasierte Familientherapie
Fazit
Zweites Kapitel: Suizid und Suiziddrohungen aus der Perspektive der Neuen Autorität
Der breite gemeinsame Nenner von Suiziddrohung und tatsächlicher Suizidgefahr
Der Ansatz des »Parlaments des Geistes« und des »Fußes in der Tür«
Die verschiedenen Kreise der Suizidprävention
Der Aufgabenbereich der Neuen Autorität
Drittes Kapitel: Eltern und Unterstützer
Rekrutierung der Eltern und Aufbau einer therapeutischen Allianz
Eskalationsprävention
Die Rekrutierung von Unterstützern
Die Ankündigung
Validierung
Verschärfung der wachsamen Sorge
Schritte zur Wiedergutmachung
Die Fleh-Zeremonie
Eine Einladung zur Zugehörigkeit
Drohungen standhalten
Die Eröffnung neuer Möglichkeiten
Rückfallprävention
Fazit
Viertes Kapitel: »Was würden Sie der Person auf dem Dach sagen?«
Erster Teil: die empathische Haltung
Zweiter Teil: die herausfordernde Haltung
Übungen für Unterstützer
Fazit
Fünftes Kapitel: der externe Kreis – Schulen und informelle Bildung
Das Gatekeeper-Programm
Vom Gatekeeping zur Verankerung
Sechstes Kapitel: die Neue Autorität in Verbindung mit anderen Ansätzen zur Suizidprävention
Wie sich die Neue Autorität in (depressionsbedingte) Einzeltherapien integrieren lässt
Wie sich die Neue Autorität in die Arbeit einer Telefon- oder Online-Krisenhotline integrieren lässt
Treffen mit den Mitarbeitenden einer gemeindeorientierten Freiwilligenorganisation zur Suizidprävention
Fazit
Schluss
Literatur
Erstes Kapitel: die Neue Autorität und andere suizidverhindernde Ansätze
Co-Autorin dieses Kapitels ist Tal Nakash
Der Ansatz der Neuen Autorität kann auf unterschiedliche Arten und in verschiedenen Zusammenhängen angewandt werden: als Coaching-Methode für Eltern und Lehrkräfte (Omer, 2011), als Selbsthilfeansatz für Eltern (Omer, 2020) und Lehrkräfte (Omer, 2022), als Leitfaden für freiwillige Mitarbeiter von Organisationen, die psychische Gesundheitsberatung anbieten, und als integrierte Ergänzung einer bereits vorhandenen Psychotherapie. Dieses Kapitel befasst sich mit der letzten Anwendungsform, nämlich der Integration der Neuen Autorität in laufende Psychotherapien für junge Menschen mit Suizidrisiko.
Um den potenziellen Beitrag der Neuen Autorität zu bereits existierenden therapeutischen Ansätzen zu verstehen, müssen wir uns zunächst mit den in der Suizidprävention üblichen Interventionen auseinandersetzen. Ausnahmslos alle in diesem Kapitel vorgestellten Interventionen zeigen Offenheit für die Komponenten anderer Ansätze oder, wie es im Fachjargon heißt, die »Integration«. In der Suizidprävention ist die Notwendigkeit einer Integration noch viel ausgeprägter zu spüren als in anderen Therapiebereichen. Grund dafür ist, dass Suizid ein komplexes Problem darstellt, das nicht nur suizidale Jugendliche selbst betrifft, sondern ihre gesamte Umgebung (Eltern, Pädagoginnen, Krankenhauspersonal und diverse Körperschaften aus der Gemeinde). Es gibt keinen vereinzelten Ansatz, der das Gesamtspektrum der Herausforderungen ansprechen könnte, die sich auf all diesen Ebenen ergeben. Hinzu kommt, dass Suizidgefahr mit einer Form von Dringlichkeit und Stress einhergeht, die man in solchem Maß in den meisten anderen Bereichen der Psychotherapie nicht kennt. Eine Therapeutin, die einem jungen Menschen gegenübersitzt, der von dem überwältigenden Drang beherrscht ist, seinem Leben ein Ende zu setzen, muss eine Lösung finden, die dem Patienten (und ihr selbst) ein gewisses Maß an Sicherheit bietet. Diese Herausforderung führte Therapeuten der kognitiven Verhaltenstherapie dazu, den Gedanken eines Sicherheitsplans zu entwickeln. Wie es für dieses System so typisch ist, erarbeiteten sie detaillierte Anleitungen zur Erstellung eines solchen Plans. Innerhalb von kürzester Zeit tauchten solche Sicherheitspläne auch in anderen therapeutischen Systemen auf. Dasselbe gilt für weitere Merkmale der Suizidprävention: zum Beispiel die Notwendigkeit von Selbstkontrolle, der Einbeziehung der Eltern und eines Präventionsplans für Rückfälle. Sobald einer der therapeutischen Ansätze eine Lösung für eine dieser Herausforderungen anbot, folgten ihm die anderen auf dem Fuße. Obwohl jeder von ihnen die spezifischen Inhalte des Sicherheitsplans gemäß seiner eigenen Begriffswelt darstellt, ist die Ähnlichkeit der verschiedenen Lösungen offensichtlich. Wir wagen es sogar zu sagen, dass Ansätze zur Suizidprävention bei Teenagern eine Integration mit anderen Ansätzen »erfordert«, da kein Ansatz den Entwicklungen anderer gegenüber gleichgültig bleiben kann.
Es gibt verschiedene Psychotherapien, die sich auf die Suizidprävention bei Jugendlichen konzentrieren, darunter die Dialektisch-Behaviorale Therapie für Jugendliche (DBT-A); die kognitive Verhaltenstherapie zur Suizidprävention (KVT-SP); die Interpersonelle Psychotherapie für depressive Jugendliche (IPT); und die Bindungsorientierte Familientherapie (ABFT). Die ersten drei dieser Therapien sind individuell, bei der vierten handelt es sich um eine Familientherapie. Aber selbst die individuellen Therapien erkennen die Notwendigkeit an, die Eltern miteinzubeziehen, und manchmal auch die Schule.
Über die verschiedenen Therapien für suizidale Jugendliche sind zahllose Bücher und Artikel geschrieben worden, ihre Wirksamkeit für diesen Sektor blieb jedoch bis vor wenigen Jahrzehnten unerforscht. Das änderte sich erst, als sich einige der genannten Ansätze bei der Einschränkung von depressiven Symptomen als effizient erwiesen hatten und Suizidversuche und Suizidgedanken mitunter sogar verringern konnten. Die Neue Autorität ist im Zusammenhang mit Suizid nicht direkt getestet worden, hat sich aber bei einer Reihe von Variablen, die mit Suizid bei Jugendlichen assoziiert werden, als wirksam erwiesen, darunter Depression, Vereinsamung, Impulsivität, Krisen von Eltern-Kind-Beziehungen und problematischen elterlichen Reaktionen (Omer, 2021; Turecki u. Brent, 2016).
Wie wichtig die Entwicklung effektiver psychologischer Interventionen für den Suizid bei Jugendlichen ist, wird von der allgemeinen Unzufriedenheit mit medikamentösen Behandlungen für Heranwachsende, darunter dem Einsatz von Antidepressiva und Medikamenten gegen Angstzustände, noch stärker unterstrichen.2 Obwohl solche Medikamente die Symptome einer Depression oder eines Angstzustands erheblich mildern können, hat die Forschung sie zugleich auch mit einem erhöhten Suizidrisiko in Verbindung gebracht. 2004 veröffentlichte die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) eine Warnung, dass diese Medikamente bei einigen Kindern und Jugendlichen mit Depressionen oder Angstzuständen suizidale Gedanken und Verhaltensweisen hervorrufen können (Lenzer, 2004). Vor wenigen Jahren wurden einige Studien veröffentlicht, die anführen, dass die Vorteile dieser Medikamente ihr Risiko überwiegen, solange sie unter strenger Aufsicht eingenommen werden (Center for Drug Evaluation and Research, 2018). Dennoch ist diese Warnung nach wie vor gültig und verstärkt die Notwendigkeit von Psychotherapien, die keine derartigen Risiken enthalten.
In der Forschungsliteratur werden vier Hauptkriterien genannt, nach denen eine Behandlung als wirksam angesehen werden kann (Kaslow u. Thompson, 1998):
die Behandlung geht mit einem detaillierten therapeutischen Protokoll einher;
die getesteten Eigenschaften sind klar definiert;
die Behandlung wurde in einer stichprobenartigen klinischen Studie getestet; und
mindestens zwei Forscherteams konnten die Wirkung der Intervention nachweisen.
Die hier vorgestellten Behandlungen zur Suizidprävention befinden sich in unterschiedlichen Stadien ihrer Bewertung als forschungsbasierte Interventionen im Sinn dieser Kriterien. Wie wir bereits sagten, wurde der Ansatz der Neuen Autorität noch nicht direkt an einer Population suizidgefährdeter Heranwachsender getestet. Seine Wirksamkeit ist jedoch an verschiedenen anderen Bevölkerungsgruppen mit erhöhtem Suizidrisiko getestet worden, darunter: Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (Schorr-Sapir, Gershy, Apter u. Omer, 2021); Kinder mit Angststörungen (Lebowitz, Omer, Hermes u. Scahill, 2014; Lebowitz, Marin, Martino, Shimshoni u. Silverman, 2019); Erwachsene mit Abhängigkeiten (Lebowitz, Dolberger, Nortov u. Omer, 2012) und Jugendliche mit Mediensucht (Sela, 2020). Weiter wurde die Effizienz des Ansatzes auch in diversen Zusammenhängen untersucht, beispielsweise Pflegefamilien (Van Holen, Vanderfaeillie u. Omer, 2016; Van Holen, Vanderfaeillie, Omer u. Vanschoolandt, 2018) und Psychiatrie (Van Gink et al., 2018, 2019). Für jede dieser Konstellationen gibt es ein detailliertes therapeutisches Protokoll.
Bevor wir die Therapien vorstellen, ist es wichtig zu beachten, dass – wie bei allen psychologischen Interventionen – die Elemente, die alle guten Psychotherapien gemeinsam haben, höchstwahrscheinlich die wichtigsten sind. Zu diesen gemeinsamen Elementen zählen: die therapeutische Allianz, ein wertfreier Ansatz und eine wachsende Motivation. Im Zusammenhang mit dem Suizid von Jugendlichen spielen die Eltern eine zentrale Rolle. Daher ist die Fähigkeit, mit ihnen eine therapeutische Allianz einzugehen und sie für die Präventionsbemühungen zu gewinnen, so überaus entscheidend. Zudem müssen die Therapeuten in der Lage sein, offen und direkt über Suizid zu sprechen und auch außerhalb ihrer offiziellen Arbeitsstunden zur Verfügung stehen. Jeder Therapeut, der suizidgefährdete Heranwachsende betreut, muss mit der emotionalen Erfahrung des suizidalen Jugendlichen vertraut sein, unabhängig davon, welchen Ansatz er vertritt. Israel Orbach (1997, 2007) hat viel über diese Aspekte veröffentlicht. Er betonte die Sehnsucht zu leben, die beim suizidgefährdeten Jugendlichen parallel mit dem Wunsch zu sterben einhergeht, und forderte Therapeuten auf, die beängstigenden Erfahrungen dieser jungen Menschen und ihren unerträglichen emotionalen Schmerz nachzuvollziehen. Orbach war davon überzeugt, dass paradoxerweise nur eine unerschrockene Empathie für den Patienten, zu der auch dessen Todessehnsucht gehört, Hoffnung und die Bereitschaft erwecken kann, das Leben zu wählen.
Dialektisch-Behaviorale Therapie
Die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) wurde ursprünglich von Marsha Linehan als Ansatz für Erwachsene mit Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt (Linehan u. Wilks, 2015). Später übernahm man ihn auch für Jugendliche mit derselben Persönlichkeitsstörung (Miller, Rathus u. Linehan, 2007). Die Therapieform basiert auf vier Elementen: individueller Psychotherapie, Gruppentherapie, einer Mehrfamiliengruppe zum Erlernen und Üben von Fähigkeiten und einer Supervisions- und Selbsthilfegruppe für therapeutische Fachkräfte. Die Eltern sind ein untrennbarer Teil dieser Therapie. Sie nehmen an den Sitzungen der Mehrfamiliengruppen zum Erlernen von Kompetenzen teil. Bei Bedarf auch an Einzelsitzungen.
Das dialektische Denken, auf dem der Ansatz basiert, betont die Begegnung zwischen Kontrasten. So ist diese Therapie ebenso validierend wie herausfordernd und spricht die Tendenz zum Zerstören und die Tendenz zum Funktionieren, den Wunsch zu leben und den Wunsch zu sterben gleichermaßen an. Eine weitere dialektische Grundannahme ist, dass der Teenager, obwohl er seine Probleme nicht verursacht hat, doch der Einzige ist, der sie lösen kann. Das Ziel des dialektischen Denkens ist nicht, einen Aspekt überwiegen zu lassen, sondern vielmehr beide Aspekte in einer reicheren Synthese miteinander zu verbinden. Dieser Ansatz ist auch von ostasiatischen Doktrinen beeinflusst (zum Beispiel dem Zen-Buddhismus), etwa in der Anwendung von Mindfulness. Einer seiner Schwerpunkte ist die Validierung der Erfahrung des Jugendlichen: seine Reaktionen werden als signifikant bezeichnet und gelten angesichts seiner aktuell erfahrenen Lebenssituation sogar als vernünftig. Validierung ist ein wichtiges therapeutisches Ziel, nicht nur für den Jugendlichen, sondern auch für die Eltern. Die Validierung der Erfahrung bedeutet jedoch keineswegs eine Legitimierung des Aktes selbst. In einer Therapie bedeutet dialektisches Denken nicht nur eine theoretische Grundthese des Therapeuten. Es wird zu einer gemeinsamen Sprache, mit der der Jugendliche und die Eltern lernen, die entgegengesetzten Aspekte ihrer Erfahrung zu artikulieren und auszuhalten.
Die wichtigste Verhaltenskomponente dieses Ansatzes ist das Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Stresstoleranz und Kontrolle von Emotionen. Zudem soll auf der zwischenmenschlichen Ebene eine größere Wirksamkeit entstehen. Diese Fähigkeiten sind auch ein zentrales Ziel der Arbeit mit Eltern. Diese behaviorale Komponente kommt in einer Kombination aus direkten Anweisungen, deren praktischer Übung während und zwischen den Sitzungen und einer positiven Verstärkung der von der Therapeutin wie auch den Eltern erbrachten Ergebnissen zur Geltung.
Die Inhalte einer Einzeltherapie sind hierarchisch strukturiert, wobei lebensbedrohende Verhaltensweisen und Akte der Selbstverletzung oberste Priorität haben. Der nächste Schwerpunkt gilt Verhaltensweisen, die die Behandlung untergraben, zum Beispiel mangelnde Kooperation, Zuspätkommen oder Nichterscheinen bei Terminen. Nur wenn es keine lebensgefährdenden oder die Therapie torpedierenden Inhalte gibt, konzentriert sich das Gespräch auf Inhalte, die mit der Lebensqualität zusammenhängen, darunter Konflikte mit Gleichaltrigen, schulische Probleme oder die Beziehung zu den Eltern.
Zu jeder Sitzung gehört die Besprechung eines wöchentlichen Tagebuchs, in dem der Teenager Verhaltensweisen wie Selbstverletzung, Lebensgefährdung oder andere destruktive Handlungen aufschreibt. Die Überprüfung des Tagebuchs zu Beginn jeder Sitzung bestimmt die Tagesordnung. Sollte es eine suizidale oder eine selbstschädigende Handlung gegeben haben, führen der Teenager und die Therapeutin eine »Verhaltensanalyse« durch, bei der sie die Schwachstellen und Verletzlichkeiten herausarbeiten, die mit dem Vorfall, den Auslösern und den Auswirkungen – zum Beispiel einer positiven oder negativen Verstärkung des problematischen Verhaltens – zusammenhängen könnten. Die Therapeutin ermutigt den Teenager, sie anzurufen, sobald er gegen den Drang zur Selbstverletzung ankämpft oder Hilfe braucht, um eine der genannten Fähigkeiten anzuwenden.
In der Mehrfamiliengruppe erlernen die Teenager und ihre Eltern oder andere Familienmitglieder gemeinsam vier Gruppen von Fähigkeiten und Fertigkeiten:
Achtsamkeit (mindfulness) – Sie lernen, ihre Gedanken und ihre Aufmerksamkeit auf die Gegenwart zu richten und sie mit urteilsfreiem Denken und Akzeptanz der Realität zu verbinden.
Schmerztoleranz – Die Teilnehmenden wählen eine Reihe von Erfahrungen, die sie für unerträglich halten, und lernen, sie zu betrachten, ohne zu versuchen, sie sofort zu ändern.
Emotionsregulation – Die Teilnehmenden erlernen Fähigkeiten zur Kontrolle starker Emotionen wie Wut, Angst und Verzweiflung.
Arbeit an zwischenmenschlichen Beziehungen – Die Teilnehmenden erlernen Strategien zur Verbesserung von Beziehungen und zur Konfliktbewältigung. Für die Eltern gibt es dabei ein zweifaches Ziel: die Verbesserung ihres eigenen Verhaltens und als Vorbilder für ihre Kinder zu dienen.
Selbsthilfegruppen für therapeutische Fachkräfte sind ein untrennbares Element dieses Ansatzes. Sie werden unterstützt und ermutigt, therapeutische und persönliche Schwierigkeiten anzusprechen, sie lernen, sich an die therapeutische Hierarchie zu halten und diskutieren die Notwendigkeit, in das Umfeld des Teenagers einzugreifen, zum Beispiel durch Termine mit der Familie, der Schule oder anderen betreuenden Beteiligten. Dies bereichert den Ansatz um eine integrierte systemische Dimension.
Die erste systematische Studie des Dialektisch-Behavioralen Ansatzes konzentrierte sich auf suizidale Heranwachsende mit Borderline-Persönlichkeitsmerkmalen (Rathus u. Miller, 2002). Die Versuchsgruppe erhielt zwölf Wochen lang zusätzlich zu einer Mehrfamilien-Studiengruppe zweimal wöchentlich auch eine individuelle DBT-Therapie. Die Kontrollgruppe erhielt zwölf Wochen lang zweimal wöchentlich eine psychodynamische Therapie, zusätzlich zu einer wöchentlichen Familiensitzung. Hinsichtlich der Zahl der während der Behandlung aufgetretenen Suizidversuche konnte die Studie keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen nachweisen. Dennoch gab es bei der DBT-Gruppe während der Behandlung weniger Hospitalisierungen, eine niedrigere Dropout-Rate und einen bedeutenden Rückgang der suizidalen Gedanken, der allgemeinen psychiatrischen Symptome und der Borderline-Persönlichkeitssymptome. Eine weitere Studie desselben Zentrums, die DBT mit einer gewöhnlichen Therapie verglich, wurde in einer Krankenhausabteilung für Jugendliche durchgeführt, die bereits Suizidversuche hinter sich hatten (Katz, Cox, Gunasekara u. Miller, 2004). Dabei stellte man fest, dass die mit einer DBT behandelten Patienten während ihres Krankenhausaufenthalts eine signifikante Verbesserung ihrer Verhaltensstörungen zeigten. Nach Abschluss der Behandlung und eines einjährigen Follow-ups wiesen die Therapie- und die Kontrollgruppe eine ähnliche Verbesserung ihres suizidalen Verhaltens, ihrer depressiven Symptome und ihrer suizidalen Gedanken auf.
DBT und Neue Autorität verfolgen zwar zum Teil übereinstimmende Ziele, benutzen dabei aber unterschiedliche Mittel. Beide Ansätze bemühen sich um Validierung, Selbstkontrolle und Miteinbeziehung von Eltern und Angehörigen. Ein bedeutender Unterschied liegt jedoch darin, dass die Neue Autorität Eltern und andere Parteien aus dem Umfeld des Teenagers auch miteinbezieht, wenn er sich nicht in Therapie befindet und nicht kooperativ ist. Vereinfachend darf man folgende Feststellung treffen: Bei einer DBT dient die Zusammenarbeit mit den Eltern zur Verstärkung der Arbeit mit dem Heranwachsenden, während sie bei der Neuen Autorität ein eigenständiges Ziel darstellt. Ein weiterer Unterschied sind die Ziele, die Mittel und die Sprache, die in der Kommunikation mit den Eltern gebraucht werden. So geht es beim Ansatz der Neuen Autorität schwerpunktmäßig darum, die Eltern, ihre Autorität und ihren Einfluss im Leben des Teenagers und der Familie zu verstärken. Das zentrale Konzept ist die elterliche Verankerung. Das bedeutet vor allem Maßnahmen für eine Verbesserung der Verbundenheit und den gleichzeitigen Widerstand gegen die zerstörerische Tendenz. Wir denken, dass diese Ziele und Konzepte für die meisten Eltern wichtig sind und eine hohe Rekrutierungsrate wie auch eine minimale Abbrecherquote ermöglichen (Omer, 2021).
In Anbetracht der gemeinsamen Ziele scheint eine Kombination mit dem Ansatz der Neuen Autorität vielversprechend. Dementsprechend wurde in den Niederlanden ein Programm entwickelt, das die auf der Neuen Autorität basierte Zusammenarbeit mit den Eltern und die Behandlung von Jugendlichen mittels einer DBT-A verbindet (Van Dongen et al., 2023).3 Dabei ging man davon aus, dass Eltern ihre eigene Therapie und Hilfe brauchen, was nicht unbedingt eine 1:1-Kopie der Arbeit mit ihren Kindern bedeutet. Die Neue Autorität lieferte den Organisatoren des Programms das nötige Werkzeug. Die Eltern wurden im Rahmen von Gruppen behandelt. Dieser Rahmen erschwerte es jedoch, ein gemeinsames Treffen mit den Unterstützern zu organisieren. Dafür fanden die Leiter des Programms eine originelle Lösung: Sie planten eine Sonderveranstaltung für alle Eltern, ihre organischen Unterstützer und die Jugendlichen selbst. Dieser Abend hat sich als enorm effektiv und stabilisierend erwiesen. Viele Familien beschreiben ihn als das zentrale Ereignis der gesamten Therapie.
Kognitive Verhaltenstherapie in der Suizidprävention
Ein spezifisches Suizid-Präventionsprogramm wurde auch im Rahmen des Ansatzes der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) entwickelt. Dieses Programm diente ursprünglich der Arbeit mit Erwachsenen und wurde später auch für Heranwachsende übernommen, die an Depressionen litten und Suizidversuche hinter sich hatten (Brown et al., 2005; Stanley et al., 2009).
Schwerpunkt der Therapie ist die Interaktion von Gedanken, Emotion und Verhalten. Zur Arbeit auf der kognitiven Ebene gehört es, automatische Gedanken und kognitive Verzerrungen wie zum Beispiel schwarzweiße Denkmuster oder eine katastrophale Sichtweise der Ereignisse zu erkennen, die bekanntlich mit Suizid verbunden sind. Weiter umfasst die therapeutische Arbeit Elemente der Verhaltensaktivierung und der Wiederaufnahme freudiger Aktivitäten sowie die Entwicklung von Problemlösungsfähigkeiten. Diese Elemente zielen darauf ab, Passivität, Anhedonie und erlernte Hilflosigkeit zu verbessern. Die Therapie umfasst auch eine Komponente des emotionalen Bewusstseins, der emotionalen Kontrolle und der Akzeptanz von negativen Emotionen und Stresszuständen. Diese Komponente hat sich erst in der dritten Generation der KVT entwickelt und wurde von der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) (Hayes, Strosahl u. Wilson, 1999) inspiriert. Tatsächlich ist das Programm keine »reine« KVT, sondern eher ein Beispiel für einen integrierten Ansatz, da es auch viele Komponenten der DBT enthält.
Die Therapie beginnt mit dem Entwurf eines Sicherheitsplans (Stanley u. Brown, 2012). Der Therapeut fragt ganz direkt danach, ob die Gefahr bestehe, dass sich der Teenager bis zur nächsten Therapiesitzung selbst verletze. Diese Frage ermöglicht die Erforschung suizidaler Absichten und zielt darauf ab, alternative Reaktionen wachzurufen. Der Sicherheitsplan wird in Zusammenarbeit zwischen Therapeuten, Teenagern und den Eltern entworfen und enthält eine schriftliche Liste von Bewältigungsstrategien. Diese Liste ist hierarchisch aufgebaut, sodass der Teenager zur nächsten Strategie übergehen kann, wenn eine davon nicht funktioniert. Sie umfasst ein breites Spektrum an Maßnahmen, von Selbstberuhigungs- oder Ablenkungstechniken (Musik, Fernsehen, Sport) über die Hilfe von signifikanten Anderen (darunter Eltern oder Fachpersonal) bis hin zu einem dringenden psychologischen Gutachten und die Überweisung in eine Klinik. Eines der wichtigsten Werkzeuge von KVT ist das so genannte »Hoffnungs-Kit«. Zu diesem Bausatz gehört eine Liste von Gründen für das Weiterleben. Die suizidale Person legt Briefe, Bilder oder Objekte in diesen Baukasten, die sie an ihre Lebensgründe erinnern, wenn sich der Suiziddrang bemerkbar macht.
Der erste Therapieabschnitt wird mit einer Kettenanalyse der Ereignisse fortgesetzt, die zu dem versuchten Suizid geführt haben. Sie umfasst die Gedanken, Emotionen und das Verhalten der Person, ebenso wie die Reaktionen signifikanter Anderer und ihrer selbst im Hinblick auf den Suizidversuch. Diese Analyse zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Therapie. Sie wird anfänglich während der ersten beiden Sitzungen vorgenommen und dann die ganze Therapie hindurch weiterverarbeitet und detailliert. Die Verkettung der Vorfälle ermöglicht es, Defizite in den emotionalen, verhaltensbezogenen und kognitiven Fähigkeiten herauszufiltern, die in der Therapie bearbeitet werden können.
In der mittleren Therapiephase geht es darum, Fähigkeiten wie Verhaltensaktivierung, kognitive Rekonstruktion, emotionale Kontrolle und Stresstoleranz, Problemlösung und zwischenmenschliche/soziale Skills zu erlernen und zu praktizieren. Außerdem sollen vermehrt Aktivitäten auf der Tagesordnung stehen, die den Patienten Freude bereiten. Die Teenager spielen eine aktive Rolle bei der Auswahl der Fähigkeiten, auf die sich ihre Therapie konzentrieren soll.
Zu Beginn jeder Sitzung bespricht die Therapeutin mit dem Teenager Verhaltensmuster, die lebensbedrohend sind oder die Therapie untergraben. Diese Komponente ist mit der objektiven Hierarchie in der dialektischen Verhaltenstherapie identisch. Der Heranwachsende und seine Therapeutin besprechen die vorausgegangene Sitzung und die dort erteilten Hausaufgaben. Darauf basierend stecken sie dann die wichtigsten Ziele für die aktuelle Sitzung ab. Am Ende der Stunde fassen sie das Gelernte zusammen und beschließen, welche Aufgaben zu Hause geübt werden müssen.
Ein Beispiel für eine solche im Verlauf einer Therapie erlernte Fähigkeit ist die kognitive Rekonstruktion. Mithilfe einer Kettenanalyse der Vorfälle identifiziert der Therapeut eine Anzahl von »automatischen« Gedankenmustern, die mit dem Suizidverhalten verbunden sind. Typisch für automatische Gedanken sind zum Beispiel Selbstgespräche der Verzweiflung (»Es hat keinen Sinn!«), Hilflosigkeit (»Ich kann es nicht reparieren!«), Wertlosigkeit (»Ich bin ein Versager«), Mangel an Liebe oder Feindseligkeit (»Jeder hasst mich!«), das Gefühl, eine Last zu sein (»Meinen Eltern ginge es ohne mich viel besser!«) oder das Fehlen eines Grundes, zu leben (»Ich habe nichts, wofür es sich zu leben lohnt!«). Der Therapeut arbeitet mit dem Heranwachsenden daran, wie man alternative Gedanken wachruft, oder auch daran, wie man die negativen Gedanken akzeptiert, ohne zu versuchen, gegen sie anzukämpfen oder sich von ihnen zu destruktiven Handlungen verleiten zu lassen.
Eine weitere Fähigkeit, an der in der mittleren Phase der Therapie gearbeitet wird, ist die Fähigkeit, Stress zu tolerieren und Emotionen zu kontrollieren. Dazu muss man zunächst sein Bewusstsein entwickeln und problematische Gefühle benennen können. Die jugendliche Person lernt, zwischen veränderbaren und unveränderbaren stressverursachenden Situationen zu unterscheiden. Fällt die Antwort positiv aus, konzentriert sich das Gespräch darauf, was aktiv getan werden kann, um eine solche Veränderung herbeizuführen. Wenn die Situation unveränderlich ist, müssen die Fähigkeiten der Stresstoleranz und der Emotionskontrolle aktiviert werden. KVT schreckt nicht davor zurück, scheinbar einfache Strategien zur emotionalen Regulierung anzuwenden, zum Beispiel Musik hören, angenehme Erinnerungen wachrufen, Sport treiben oder Computerspiele spielen. Diese Aktivitäten sprechen die meisten Jugendlichen an und sind daher ein wesentlicher Bestandteil des therapeutischen Dialogs. So können Therapeuten mit ihren Patientinnen zum Beispiel darüber sprechen, welche Art von Musik sie lieben und welche spezifischen Spiele sie spielen werden. Die Bereitschaft des Therapeuten, im Detail über diese verschiedenen Musikgenres oder Spiele zu sprechen, die dem Teenager hilfreich sein könnten, schafft eine wohlwollende mentale Präsenz.
Eine weitere Kompetenz, an der während des mittleren Therapieabschnitts gearbeitet wird, ist die Problemlösung. Mit dem Teenager zusammen untersucht die Therapeutin, welche die Hauptprobleme sind, die sein Leben belasten, darunter Konflikte mit den Eltern, Schwierigkeiten mit Freunden, Lehrern und so weiter. Der Teenager lernt es, sich in problematischen Situationen emotional zu regulieren, Handlungsalternativen zu aktivieren und die Vor- und Nachteile jeder dieser Alternativen abzuwägen. Zum Abschluss des Prozesses entscheidet sich der Teenager für eine leidlich gute Alternative, versucht sie zu üben und sich selbst zu ermutigen, den Prozess zu bestehen. Diese Technik lehrt Teenager, mit kleineren und größeren Herausforderungen umzugehen.
Der letzte Abschnitt der Therapie ist der Zusammenfassung und der Rückfallprävention gewidmet. Dieser Prozess besteht aus vier Stufen: Zunächst wird dem Teenager und seinen Eltern die Aufgabe erklärt. Im Anschluss daran wird der Teenager gebeten, mithilfe von geführten Gedankenbildern die Abfolge der Ereignisse aufs Neue zu »durchleben«, die zu seinem suizidalen Zustand geführt haben. Dann fordert man ihn auf, sich diese Abfolge noch einmal vorzustellen, diesmal jedoch unter Anwendung der in der Therapie erlernten und geübten Fähigkeiten. Zum Abschluss wird der Teenager aufgefordert, sich vorzustellen, wann und wie er diese Fähigkeiten bei zukünftigen Krisen einsetzen kann.
KVT für depressiv-suizidale Jugendliche wurde erstmals in einem breit angelegten, vom »US National Institute of Mental Health« unterstützten Forschungsprojekt untersucht. Die Studie verglich drei Gruppen: KVT unter Verabreichung von Antidepressiva, KVT ohne Medikamente und eine rein medikamentöse Therapie. Die Behandlungen umfassten eine zwölfwöchige akute Therapiephase und eine sechsmonatige Nachbeobachtungszeit (Brent et al., 2009). Diese Erststudie zeigte ebenso wie die folgenden Studien, dass KVT zu einem Rückgang der suizidalen Gedanken und des suizidalen Verhaltens bei Jugendlichen führt, die bereits einen Suizidversuch unternommen hatten. Im Vergleich mit einer rein medikamentösen Behandlung konnte die Psychotherapie jedoch keinerlei Vorteile aufweisen. Die vielversprechendsten Ergebnisse zeigte in diesen Studien eine mit Antidepressiva verbundene KVT (Brent et al., 2011; Stanley et al., 2009; Turner, 2009).
In diesen Studien waren die kognitiven Verhaltenstherapien vorwiegend individuell. Eltern wurden nur sofern nötig miteinbezogen, gehörten jedoch nicht zum Standardprotokoll.
Wir vermuten, dass die Ergebnisse auf die Notwendigkeit einer systematischen und intensiven Beteiligung der Eltern und eventuell auch anderer Unterstützer hinweisen. Weite Teile des therapeutischen Protokolls, darunter der Sicherheitsplan, das Erstellen eines Hoffnungs-Kits und der Rückfallpräventionsplan stimmen mit dem Ansatz der Neuen Autorität überein. Eines der Ziele unserer Arbeit mit Eltern und Unterstützern ist es, im Geist des Jugendlichen eine ungebrochene mentale Präsenz zu schaffen, die imstande ist, die Intensität der Todesgedanken zu mindern und die Lebensgedanken zu verstärken. Das bereichert den inneren Dialog des Teenagers um ein System zwischenmenschlicher Erinnerungshilfen. In dieser Situation hängt die Kraft der lebensverstärkenden Gedanken nicht nur von der Fähigkeit des Teenagers ab, sie hervorzurufen, sondern wird zugleich durch die wohlwollende Präsenz der Eltern und Unterstützer verstärkt. Zum Beispiel können Unterstützer, die ein gutes Verhältnis zu dem Teenager haben, ihm helfen, das »Hoffnungs-Kit« zu entwickeln. Sie können ihre eigenen Gründe hinzufügen (»Ich werde nicht auf unseren Plan verzichten, diesen Marathonlauf gemeinsam zu bestehen«) oder die vom Teenager angeführten Gründe verstärken, zum Beispiel, indem sie Bilder und Geschichten hinzufügen, die mit den vom Teenager genannten positiven Inhalten verbunden sind. Die beiden Ansätze bereichern sich gegenseitig. Inspiriert durch den KVT-Präventionsplan haben wir daher in unserer Methode ein Parallelprogramm entwickelt.
Interpersonelle Therapie für Jugendliche
Die interpersonelle Therapie ist eine fokussierte, auf zwölf Sitzungen begrenzte Kurzzeittherapie, die ursprünglich für depressive Erwachsene entwickelt wurde (Weissman et al., 2000). Später wurde der Ansatz auch für Heranwachsende übernommen, die an einer nicht-bipolaren oder psychotischen Depression litten (Mufson et al., 2004; Samoilov, 1994). Weiter wurde die Therapie an ein präventionsorientiertes Gruppenformat angepasst, um junge Menschen zu erkennen, die Gefahr laufen, eine klinische Depression zu entwickeln (Young et al., 2019). Vor nicht allzu langer Zeit wurde sie schließlich auch für nicht-suizidale depressive Jugendliche mit Selbstverletzungsneigungen (Jacobson u. Mufson, 2012) sowie für suizidgefährdete depressive Kinder und Jugendliche (Klomek, Catalan u. Apter, 2021) übernommen.
Eine zentrale Ausgangsthese des Ansatzes ist, dass Depressionen und suizidale Krisen die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Patienten und wichtigen Bezugspersonen in ihrem Leben maßgebend beeinflussen und von ihnen beeinflusst werden. Somit ist es das therapeutische Ziel, die depressiven Symptome und das Risiko von suizidalem Verhalten durch eine Verbesserung des sozialen Miteinanders zu reduzieren, und alternativ dazu durch eine Milderung der Depression zu einer Verbesserung desselben zu führen.
In der Therapie werden die beobachtbaren Symptome einer Depression im Zusammenhang mit vier Problembereichen untersucht:
Trauer – Verlust einer nahestehenden Person;
zwischenmenschliche Defizite – Konflikte mit dem Freundeskreis/Lehrkräften/Eltern/Geschwistern;
Rollenwechsel – und andere bedeutende Übergänge, die wichtige Lebensereignisse darstellen;
Schwierigkeiten oder Defizite bei zwischenmenschlichen Kompetenzen.
Der hauptsächliche Problembereich wird am Ende des ersten Therapieabschnitts abgesteckt. Manchmal hat eine Patientin eine ganze Reihe von Problembereichen. Dennoch ist es wichtig, Prioritäten festzulegen und zu beschließen, welcher davon zuerst bearbeitet werden sollte.
Bei der für Jugendliche mit nicht-suizidaler Selbstverletzung entwickelten Version (Jacobson u. Mufson, 2012) wurde das Behandlungsprotokoll um eine Reihe neuer Elemente erweitert, darunter: Bewertung der Häufigkeit und Schwere der Selbstverletzung, psychologische Aufklärung über Selbstverletzung, Untersuchung der Motivation des Jugendlichen zur Selbstverletzung und eine Erweiterung der Sicherheitsvorkehrungen. Zu letzteren gehören auch die Verfügbarkeit der Therapeutin rund um die Uhr und ein Überwachungsprotokoll zur Dokumentation des selbstverletzenden Verhaltens. Schon ab Beginn der ersten Therapiephase arbeiten Teenager und Therapeutin zusammen, um alternative Verhaltensweisen zu entwickeln. Zum Beispiel, Eiswürfel in die Hand zu nehmen, anstatt Körpergewebe zu verletzen.