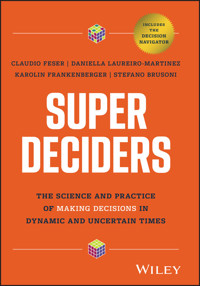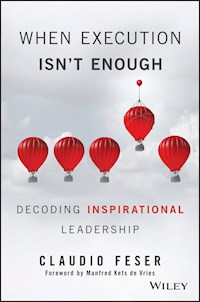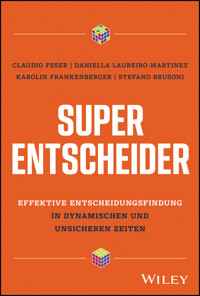
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Verbessern Sie die Entscheidungen, die Sie tagtäglich treffen, mithilfe neuester neurowissenschaftlicher Erkenntnisse drastisch!
Täglich treffen wir Hunderte von Entscheidungen, von kleinen - wie die Frage, was wir heute anziehen und wie wir zur Arbeit fahren - bis hin zu großen - wie die Unternehmensstrategie und die Frage, ob ein Umstrukturierungsprogramm eingeleitet werden soll, das sich auf Tausende von Menschen auswirken kann. Studien zufolge verbringen Führungskräfte 40 Prozent ihrer Zeit damit, Entscheidungen zu treffen und die Wirksamkeit ihrer Entscheidungen bestimmt weitgehend die Ergebnisse der von ihnen geführten Unternehmen.
In diesem Buch liefert ein Team renommierter Forscher und Unternehmensberater eine Anwendung der neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse, um die schwierigsten Entscheidungen effektiv zu treffen - nämlich diejenigen, die wir in dynamischen Umgebungen treffen, in Situationen der Ungewissheit, wenn wir Ergebnisse vorhersagen müssen, uns aber relevante Informationen fehlen, die Zeit knapp ist und sich die Umgebung ständig verändert.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil bietet es einen praktischen Rahmen für effektive Entscheidungen unter Unsicherheit. Im zweiten Teil des Buches werden Ansätze zur effektiven Umsetzung dieser Entscheidungen erörtert, so dass der Wandel auf allen Ebenen, vom Einzelnen bis zur Organisation, bewältigt werden kann. Schließlich enthält das Buch Vorschläge, wie Führungskräfte die für die Entscheidungsfindung relevanten kognitiven Fähigkeiten bei sich selbst und bei ihren Mitarbeitern analysieren und verbessern können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das englische Original erschien 2024 unter dem Titel Super Deciders: The Science and Practice of Making Decisions in Dynamic and Uncertain Times bei John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
© 2024 by Claudio Feser, Daniella Laureiro-Martinez, Karolin Frankenberger, and Stefano Brusoni. All rights reserved.
All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc.
Alle Bücher von WILEY-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, GermanyAlle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Print ISBN: 978-3-527-51212-6ePub ISBN: 978-3-527-85104-1
Umschlaggestaltung: Christian Kalkert (in Anlehnung an das englische Originalbuch)
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
Die Struktur des Buches
Prolog
Notiz
Teil I: ENTSCHEIDUNGEN UNTER UNSICHERHEIT VERSTEHEN
1 Fundierte Vorhersagen
Notiz
2 Erstes Fallbeispiel: Menschenzentrierte Entscheidungen
3 Die Entwicklung von Optionen zur Annäherung an die bestmögliche Entscheidung
Anmerkungen
Teil II: ENTSCHEIDUNGEN UNTER UNSICHERHEIT TREFFEN
4 Zweites Fallbeispiel: Strategische Entscheidungen
5 Identifizierung und Überprüfung der Annahmen
6 Drittes Fallbeispiel: Wachstumsentscheidungen
7 Die Entwicklung besserer Optionen
Teil III: DER UMGANG MIT SPANNUNGEN BEI ENTSCHEIDUNGEN UNTER UNSICHERHEIT
8 Viertes Fallbeispiel: Die Umsetzung von Entscheidungen
9 Change Management: Die Steuerung des Wandels
Teil IV: SUPER-ENTSCHEIDER WERDEN
10 Fünftes Fallbeispiel: Work-Life-Balance-Entscheidungen
11 Optimierung des Entscheidungsfindungsprozesses
12 Sechstes Fallbeispiel: »Harte« Entscheidungen
13 Der Umgang mit Fehlentscheidungen
Reaktive emotionale Neigungen
Teil V: FAZIT
14 Nachwort
15 Fazit
Anhänge
Anhang 1 – Beschreibung der Alpina Travel Group (ATG)
Anhang 2 – Lebenslauf (CV), Isabelle Dubois
Anhang 3 – Fallbeispiel 1: Die Wirtschaft
Anhang 4 – Fallbeispiel 1: Der Reisemarkt
Anhang 5 – Fallbeispiel 1: Die finanzielle Situation
Anhang 6 – Digitale Trends in der Reisebranche
Anhang 7 – Fallbeispiel 2: Wettbewerbsmonitoring
Anhang 8 – Fallbeispiel 2: Trends und SWOT-Analyse
Anhang 9 – Fallbeispiel 3: Internationale Expansionsdaten
Anhang 10 – Fallbeispiel 4: Belegschaftsumfrage ATG
Literaturverzeichnis
Die Autoren
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Unser Gehirn ist darauf programmiert, Vorhersagen zu treffen....
Abbildung 1.2: Auswirkung ausgewählter Optimierungsmaßnahmen auf die Vorhers...
Abbildung 1.3: Wann erzielen Teams bessere Ergebnisse?
Abbildung 1.4: Hinweise auf die allgemeine Vorhersagegenauigkeit (Multiple R...
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Unser Gehirn ist darauf programmiert, in Entweder-oder-Katego...
Abbildung 3.2: Innerhalb des Exploit-Explore-Kontinuums gibt es eine unbegre...
Abbildung 3.3: Sieben Heuristiken
Abbildung 3.4: Die Beziehung zwischen Ambitions- und Aktionsniveau bei der U...
Abbildung 3.5: Sieben Faktoren (Heuristiken), die das Gleichgewicht zwischen...
Abbildung 3.6: Vierstufiger Entscheidungsnavigator
Abbildung 3.7: Vergleich zwischen Exxon und Meta
Abbildung 3.8: Zusammenfassung des vierstufigen Entscheidungsnavigators
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Vierstufiger Entscheidungsnavigator mit einer Lösung für Fall...
Abbildung 4.2: Zusammenfassung der vier strategischen Optionen, die das Topm...
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Das T-Experiment
Abbildung 5.2: Das menschliche Gehirn
Abbildung 5.3: Das Zusammenwirken der drei »Hirnschichten«
Abbildung 5.4: Das Geheimnis der Gruppen: mehr Ideen, breiterer Lösungsraum...
Abbildung 5.5: Fünfstufiger Entscheidungsnavigator
Abbildung 5.6: Zusammenfassung des fünfstufigen Entscheidungsnavigators
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Fünfstufiger Entscheidungsnavigator mit Lösung/Beschluss für ...
Abbildung 6.2: Fünfstufiger Entscheidungsnavigator mit Lösung/Beschluss für ...
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Fünfstufiger Entscheidungsnavigator mit Lösung/Beschluss für ...
Abbildung 7.2: Sechsstufiger Entscheidungsnavigator mit Lösung/Beschluss für...
Abbildung 7.3: Die Auswirkung der wissenschaftlich orientierten Denkweise au...
Abbildung 7.4: Das Entscheidungsmodell, das die Vorteile des induktiven und ...
Abbildung 7.5: Der Dunning-Kruger-Effekt
Abbildung 7.6: Zusammenfassung des sechsstufigen Entscheidungsnavigators
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Ansätze zur Überwindung von Spannungen im Unternehmen
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Sechsstufiger Entscheidungsnavigator für Fallbeispiel 4
Kapitel 11
Abbildung 11.1: MAB-Test
Abbildung 11.2: Sieben Faktoren, die zur Erklärung der Exploit-Explore-Entsc...
Abbildung 11.3: Aufmerksamkeitskontrolle
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Sechsstufiger Entscheidungsnavigator für Fallbeispiel 5
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Erkenne dein Temperament
Abbildung 13.2: Erkenne deinen Charakter
Anhang
Abbildung Anhang 3.1: Weltbruttosozialprodukt weltweit, aktuelle Preise, bis...
Abbildung Anhang 3.2: Hat sich die Rezession bereits auf Ihre Belegschaft au...
Abbildung Anhang 3.3: Wie lange wird die Rezession nach Ihrer Einschätzung a...
Abbildung Anhang 4.1: Weltweites Tourismusaufkommen nach Anzahl der Ankünfte...
Abbildung Anhang 4.2: Weltweite Tourismuseinnahmen von Jahr –8 bis Jahr 0 (A...
Abbildung Anhang 4.3: Umfrage zum Ort der Reisebuchung (z. B. Reisebüro, Int...
Abbildung Anhang 4.4: Prozentualer Anteil des Preisanstiegs, Übernachtungsab...
Abbildung Anhang 4.5: Was ist für Sie bei der Wahl eines Reisebüros wichtig?...
Abbildung Anhang 4.6: Achten Sie bei der Buchung einer Reise mehr auf die Ma...
Abbildung Anhang 5.1: Einnahmen der ATG von Jahr -5 bis Jahr 0 (Amtsübernahm...
Abbildung Anhang 5.2: Erfolgsrechnung der ATG (in Millionen Schweizer Franke...
Abbildung Anhang 5.3: Bilanz und Kapitalflussrechnung ATG (in Millionen Schw...
Abbildung Anhang 5.4: Verteilung der ATG-Reisebüros nach Deckungsbeitrag, St...
Abbildung Anhang 6.1: Informationsquellen, die für Urlaubsplanung in eigener...
Abbildung Anhang 6.2: Verteilung der Urlaubsreisen in Europa nach Länge und ...
Abbildung Anhang 6.3: Wo buchen Sie gewöhnlich Individualreise-Serviceleistu...
Abbildung Anhang 6.4: Warum buchen Sie Individualreise-Serviceleistungen gew...
Abbildung Anhang 6.5: Warum buchen Sie Individualreise-Serviceleistungen nic...
Abbildung Anhang 6.6: Welche Reise- und Urlaubs-Serviceleistungen haben Sie ...
Abbildung Anhang 7.1: Die größten Reiseveranstalter in Europa im Jahr 0 (Amt...
Abbildung Anhang 7.2: Ranking der Reiseveranstalter in der Schweiz mit dem b...
Abbildung Anhang 8.1: Aktuelle Trends in der Reisebranche, 1.
Abbildung Anhang 8.2: Aktuelle Trends in der Reisebranche, 2.
Abbildung Anhang 8.3: Aktuelle Trends in der Reisebranche: Größe und Wachstu...
Abbildung Anhang 8.4: SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) de...
Abbildung Anhang 9.1: Daten zur geplanten Expansion in Nordamerika oder Asie...
Abbildung Anhang 10.1: Allgemeine Einschätzung der Mitarbeitenden hinsichtli...
Abbildung Anhang 10.2: Wie stark ist die innere Bindung an Ihr Unternehmen?...
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
Prolog
Fangen Sie an zu lesen
Anhänge
Literaturverzeichnis
Die Autoren
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
197
199
200
201
203
204
205
206
207
208
209
210
211
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
Vorwort
Ich war im Verlauf meiner Karriere mehr als zehn Jahre lang als CEO in großen Versicherungskonzernen tätig. Entscheidungsfindung ist ein kontinuierlicher, prägender Aspekt meines Arbeitsalltags und genau das, was Mitarbeitende mit und ohne Führungsverantwortung von mir erwarten. Ich habe während meiner beruflichen Laufbahn eine Menge gelernt, von der Produktvielfalt bis hin zu den Schattierungen der Märkte und den Präferenzen der einzelnen Akteurinnen und Akteure. Vor allem habe ich jedoch gelernt, Entscheidungen in unsicheren Zeiten und in den unterschiedlichsten Krisensituationen zu treffen.
Dieses Wissen und die langjährige Erfahrung haben mich nach meiner Überzeugung befähigt, fundierte, gute Entscheidungen zu treffen, die den aktuellen Entwicklungen in unserer Branche Rechnung tragen.
Die Versicherungsbranche befindet sich heute – wie jeder andere Industriezweig – im Umbruch. Was einst als reifer, hochgradig regulierter und relativ stabiler Wirtschaftssektor galt, ist nun infolge der technologischen Fortschritte und der veränderten Kundenbedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder einem rasanten und grundlegenden Wandel unterworfen.
Zukunftsweisende Technologien, insbesondere die digitale Konnektivität, Big Data und Künstliche Intelligenz (KI) haben innovative Wettbewerbsteilnehmende auf den Plan gerufen und den Branchenführern neue Chancen eröffnet. Die digitale Konnektivität – die Vernetzung auf der Grundlage digitaler Infrastrukturen – ermöglicht uns heute zum Beispiel, unserer Klientel nützliche und notwendige Dienstleistungen anzubieten und den Zugang zu einer Versicherung zu erleichtern und zu beschleunigen. Big Data, die in großer Menge, Vielfalt und mit hoher Geschwindigkeit anfallenden Daten, erlauben uns, Risiken mit der gebotenen Sorgfalt einzupreisen, Klientinnen und Klienten mit guter Risikobewertung zu belohnen und die Kreditexpositionen angemessen zu steuern. KI schafft hervorragende Möglichkeiten, Serviceleistungen zu verbessern und präzisere Risikobewertungsmodelle zu entwickeln.
Die rapiden Veränderungen der Kundenpräferenzen und Erwartungen sind nicht nur ein Ergebnis des technologischen Fortschritts, sondern auch auf den demografischen Wandel zurückzuführen. Mit dem Aufstieg der Gen Z, der zwischen Mitte der 1990er und Anfang der 2010er Jahre geboren, entstanden Erwartungen ganz eigener Art. Für die Angehörigen dieser Generation sind Kompetenz im Bereich der digitalen Technologien, das Bedürfnis nach personalisierten und zweckdienlichen Serviceleistungen und ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein charakteristisch. Sie interessieren sich zunehmend für Versicherungsprodukte, die auf ihre Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet sind. Dazu zählen zum Beispiel Versicherungspolicen, die Schutz für öko-freundliche Initiativen, grüne Technologien und Risiken bieten, die mit dem Klimawandel einhergehen.
Das Thema Nachhaltigkeit verändert nicht nur die Erwartungen der Klientel, sondern auch vieler anderer Stakeholder. Die Stakeholder im Versicherungssektor repräsentieren ein breites Spektrum, das Investoren, Regulierungsbehörden, Interessenverbände und die allgemeine Öffentlichkeit umfasst. Sie fordern zunehmend, dass Versicherungsunternehmen eine aktive Rolle bei der Lösung von Umwelt- und sozialen Problemen übernehmen. Das schließt eine Verpflichtung auf nachhaltige Praktiken ein, zum Beispiel die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, die Unterstützung erneuerbarer Energien und die Bereitstellung von Versicherungsprodukten, die Nachhaltigkeit fördern, wie Policen für grüne Unternehmen oder Projekte, die erneuerbare Energien voranbringen. Auch der Ruf nach mehr Transparenz und ethischem Verhalten wird immer lauter. Stakeholder erwarten von den Versicherungskonzernen, dass sie ihre Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Bilanz offenlegen, das heißt, Bericht über ihre Initiativen hinsichtlich Kohlenstoffemissionen, Diversität und Inklusion zu erstatten und sich, unter anderem, verantwortungsbewusste Investitionspraktiken auf die Fahnen zu schreiben. Vor allem Investorengruppen bewerten Versicherungskonzerne zunehmend nach ihrer Herangehensweise an das Thema Nachhaltigkeit. Unternehmen, die Nachhaltigkeit begrüßen, stehen angesichts der vielfältigen Umwelt- und gesellschaftlichen Disruptionen bei den Anlegern, die Wert auf zukunftsfähige Renditen legen, hoch im Kurs, weil diese als resilienter eingestuft werden.
Diese Veränderungen verlangen sowohl von Organisationen als auch von Führungskräften Agilität und Reaktionsfähigkeit.
Doch Agilität beschränkt sich nicht nur auf einen adäquaten Umgang mit diesen Formen des Wandels. Auch die Fähigkeit, adäquat auf die erhöhte Unsicherheit zu reagieren, ist von zentraler Bedeutung. Die Unvorhersehbarkeit, die mit den neuen Technologien, dem veränderten Verhalten der Klientel und den aufscheinenden Erwartungen der Stakeholder Einzug gehalten hat, wird von den geopolitischen Entwicklungen und neuen Risiken wie dem Ausbruch von Pandemien in den Fokus gerückt. In einem volatilen Umfeld, das von Kriegen, geopolitischen Krisen und neuen Gesundheitskrisen geprägt ist, sieht sich die Versicherungsbranche – genau wie viele andere Wirtschaftssektoren – zunehmender Unsicherheit und zahlreichen Risiken gegenüber. Geopolitische Verwerfungen können zu wirtschaftlicher Instabilität, regulatorischen Anpassungen und wachsender Sorge um die Sicherheit führen.
Niemand kann wirklich voraussagen, wie sich dieser Wandel weiterentwickeln wird, wohin er führen und wie die Versicherungsbranche am Ende dieses Jahrzehnt aussehen wird.
Wissen und Erfahrung haben uns in der Vergangenheit gute Dienste geleistet, aber sie sind möglicherweise nicht ausreichend, um große Unternehmen in unserem Wirtschaftssektor zukunftssicher aufzustellen und so zu führen wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Im Gegenteil, Wissen und Erfahrung mögen die Eckpfeiler einer effektiven Entscheidungsfindung sein, aber sie können uns blind für die neuen Herausforderungen und Chancen in einer rastlosen, sich rapide verändernden, unsicheren Zeit machen.
Dieses Buch bietet Orientierungshilfen für die Optimierung unseres Wissens- und Erfahrungspotenzials in Szenarien, die von Unsicherheit geprägt sind. Es beschreibt einen Entscheidungsfindungsansatz, der auf kollaborativer Teamarbeit, kritischem Denken, Daten und Fakten, intellektueller Bescheidenheit und Werten aufbaut.
Kollaborative Teamarbeit bedeutet, dass auf sämtlichen Ebenen der Organisation unterschiedliche Perspektiven, Ideen und Standpunkte ermutigt, zusammengetragen und in Entscheidungsprozessen verankert werden, die unter dem Strich vielschichtiger und fundierter sind.
Kritisches Denken bedeutet, sich an der Praxis zu orientieren, Fragen zu stellen, statt Antworten im Alleingang durchzusetzen, oder bereit zu sein, sich Zeit zu nehmen, um nachzuhaken, zum Beispiel mit Überlegungen wie »Was überzeugt mich an meiner Problemlösung?«, »Von welchen Annahmen gehe ich aus?« oder »Warum hältst du deine Option für die beste? Welche Hypothesen liegen ihr zugrunde?«.
Daten und Fakten bieten die Möglichkeit, unseren Entscheidungsfindungsansatz anzupassen, indem wir Hypothesen und Annahmen überprüfen und validieren, sprich auf seine Praxistauglichkeit testen. Es geht darum, unseren Denk- und Sprachmustern auf den Grund zu gehen, die mit unseren Überzeugungen einhergehen. Es gilt, unser Narrativ zu verändern, von »Ich bin überzeugt …« zu »Meine Hypothese lautet …« oder »Ich gehe davon aus …«. Überzeugungen sind persönlich, rigide und schwer infrage zu stellen. An den Grundfesten einer Überzeugung zu rütteln, wird oft als Versuch gewertet, die Identität oder den Charakter eines Menschen in Zweifel zu ziehen. Hypothesen und Annahmen sind im Gegensatz dazu kein persönliches Attribut. Sie sind ausschließlich das, was sie sind: Thesen und Theorien, die sich überprüfen und validieren lassen. Sie sind flexibel und können sich ändern, wenn neue Fakten auftauchen. Diese Flexibilität ermöglicht Lernprozesse, fördert die Anpassung an neue Gegebenheiten und weicht starre Denk- und Entscheidungsmuster auf.
Intellektuelle Bescheidenheit erfordert die Erkenntnis, dass sie im Führungsverhalten unverzichtbar ist, weil wir nicht alle Antworten haben und von anderen lernen können.
Werte sind der innere Kompass, an dem wir die Entscheidungsfindung ausrichten sollten. In dynamischen Situationen sehen wir uns bisweilen einem Dilemma gegenüber, da keine der verfügbaren Optionen wünschenswert ist. Wenn uns die Möglichkeit oder die Zeit fehlt, nach einer optimalen Lösung zu suchen, müssen wir uns manchmal mit einer Entscheidung begnügen, die sich später als die falsche Wahl erweisen könnte. In solchen Situationen spielen Werte – unser innerer Kompass – eine wichtige Rolle. Wenn sich die Umstände rapide verändern, und nicht zu unseren Gunsten, müssen wir am Ende des Tages vielleicht feststellen, dass wir den falschen Weg eingeschlagen haben. Aber zumindest haben wir mit einer Entscheidung richtiggelegen: unsere »Follower« ins Boot zu holen und zu inspirieren, was Führungskräften bei der nächsten Entscheidung zugutekommt. Diese Fähigkeit, wertebasierte Entscheidungen zu treffen, unterscheidet die erste Liga vom Rest der Führungskräfte.
Die in diesem Buch beschriebene Herangehensweise an den Entscheidungsfindungsprozess fördert eine Kultur des kontinuierlichen Lernens. Sie ermutigt Organisationen, zu experimentieren, sich auf Neues einzulassen, die Kompetenzen fortwährend zu erweitern und sich mit jedem Entwicklungsschritt den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.
Aber es geht nicht nur um Anpassung an eine Umgebung in stetigem Wandel; noch wichtiger ist die Fähigkeit, den Kurs der Entwicklungen aktiv mitzugestalten. Unternehmen werden oft mit lebendigen Organismen verglichen, die auf Veränderungen ihrer Umwelt reagieren. Doch Unternehmen sind keine biologischen Einheiten. Sie werden durch die Entscheidungen und Aktivitäten ihrer Führungskräfte beeinflusst.
Dieses Buch rückt das Konzept der »Superentscheidungen« in den Fokus der Aufmerksamkeit und weist auf die Macht einer effektiven Führung bei der Gestaltung von Organisationen hin. Es stellt eine Einladung dar, eine Form der Entscheidungsfindung zu begrüßen, die einen erheblichen Unterschied in der Entwicklung von Organisationen zu bewirken vermag. Und da Organisationen aus Menschen bestehen, hat sie darüber hinaus auch erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Lebens ihrer Mitarbeitenden und auf die Gesellschaft schlechthin.
Die Fähigkeit, »Superentscheidungen« zu treffen, kann einen aktiven Beitrag zur Gestaltung unserer Zukunft leisten.
Mario Greco,
Chief Executive Officer
Zurich Insurance Group
Prolog
Claudio Feser, David Redaschi und Karolin Frankenberger
Es war ein ungewöhnlich sonniger, eiskalter Tag im November, als Franziska ein wenig nervös vor der Tür zu den Büroräumen stand, um die neue Firmenchefin in Empfang zu nehmen. Sie war Assistentin der Geschäftsleitung von Alpina Travel Group, kurz ATG, einem großen Reiseveranstalter mit Sitz in Zürich. Jack Mayer, der letzte CEO, war steif und unnahbar gewesen. Er blieb stets auf Distanz und ließ sich nicht das leiseste Lächeln entlocken. Deshalb war Franziska ziemlich überrascht, als Isabelle Dubois eintraf. Die Frau mit den dunklen Haaren und der liebenswürdigen Miene war zweifellos die neue Vorstandsvorsitzende der ATG.
Franziska schluckte. »Guten Morgen, Frau Dubois. Ich bin Franziska Knecht, Ihre Assistentin.«
»Ich freue mich, Sie kennenzulernen«, erwiderte Isabelle und reichte ihr die Hand zur Begrüßung.
Franziska machte Anstalten, die elegante, ein wenig abgewetzte Aktentasche ihrer Chefin zu ergreifen, doch Isabelle kam ihr zuvor. »Nett von Ihnen, vielen Dank, aber die müssen Sie nicht für mich tragen«, erklärte sie lächelnd, aber mit Nachdruck. »Ist das mein neues Büro?«
Franziska nickte, sichtlich verwirrt angesichts des Auftretens ihrer Vorgesetzten, die selbstsicher, aber zugewandt wirkte und einen Umgang auf Augenhöhe andeutete, in krassem Gegensatz zum Verhalten ihres Vorgängers.
»Vielen Dank, dass Sie mich so nett willkommen heißen«, sagte Isabelle. »Sind Sie schon lange im Unternehmen?«
»Seit ungefähr drei Jahren, Frau Dubois«, erwiderte Franziska, als sie das Büro betraten. »Ich habe für Ihren Vorgänger, Dr. Mayer, gearbeitet.«
»Bitte nennen Sie mich Isabelle«, forderte die neue CEO sie ruhig, aber bestimmt auf.
»Gerne, Frau Dubois … tut mir leid, ich meinte Frau Isabelle, ähm, Isabelle.«
»Alles gut. Ist es in Ordnung, wenn ich Sie Franziska nenne?«
»Ja natürlich, gerne! Vielen Dank.«
»Was ist das für ein Gefühl, bei ATG zu arbeiten? Gefällt es Ihnen im Unternehmen?«
Verblüfft angesichts Isabelles Interesse stellte Franziska fest, dass die Anspannung der letzten Wochen von ihr abzufallen schien und sie offen ihre Meinung zu äußern begann. »Bei ATG zu arbeiten, macht Spaß und ist eine große Ehre für mich. Ich reise für mein Leben gerne. Ich finde, Reisen erweitert den Horizont, eröffnet neue Perspektiven, fördert die Empathie und das Verständnis für andere Kulturen. Es bringt die Menschen einander näher.«
»Mir geht es genauso, Franziska, ich empfinde es auch als Privileg, für ATG zu arbeiten. Ich habe gleich eine Bitte an Sie: Könnten Sie feststellen, ob die GET-Angehörigen Zeit für ein kurzes Meeting haben? Ich würde das Topmanagement-Team gerne persönlich kennenlernen.«
»Natürlich. Ich rufe sofort an und erkundige mich, wer verfügbar ist …«
Franziskas Stimme verklang, als sie beinahe rückwärts das Büro der CEO verließ.
Isabelle lächelte kaum merklich, lehnte sich in ihrem Chefsessel zurück und genoss die Aussicht. Ihr neues Büro befand sich im obersten Stockwerk eines Hochhauses in Zürich. Die Panoramafenster boten einen fantastischen Ausblick auf die Skyline und die dahinter aufragenden Alpen. Es lag nur wenig Schnee auf den Gipfeln, obwohl sich der November bereits dem Ende zuneigte. Stolz, wieder in ihrer Schweizer Heimat zu sein und ihr neues Vorstandsbüro in Besitz zu nehmen, ließ Isabelle die Ereignisse der letzten Monate noch einmal Revue passieren.
Seit der verstorbene Alpenforscher Manfred Lohner vor mehr als achtzig Jahren die Alpina Travel Group gegründet hatte, war die ATG als Veranstalter im Sektor Urlaubsreisen tätig. Zu den Stärken des Unternehmens gehörten unter anderem sein Kundenstamm und seine Destinationsexpertise. ATG war auf die Planung, Gestaltung und Koordination von Reisen für Gruppen jeder Größe und mit den unterschiedlichsten Reisepräferenzen spezialisiert. Unter dem Strich konnte das Unternehmen eine langjährige Geschichte vorweisen, die von einem konstanten gewinnträchtigen Wachstum gekennzeichnet war.1
Im vergangenen Jahr war ATG jedoch zunehmend unter Druck geraten. Die sich ändernden Kundenbedürfnisse und der Aufstieg von Online-Reiseanbietern wie Booken.com hatten zur Folge, dass der Marktanteil schrumpfte. Aus diesem Grund hatte der Vorstand Jack F. Mayer, oder Dr. Mayer, wie er genannt werden wollte, zum neuen CEO ernannt. Der erfolgreiche und erfahrene Topmanager, der aus der Reisebranche stammte, trat sein Amt bei ATG mit festgefügten Ansichten und einem autokratischen Führungsstil an. Seine Überheblichkeit, Arroganz und Rechthaberei erwiesen sich letztlich als Stolpersteine, die ihn zu Fall brachten. Seine Aufgabe hatte vor allem darin bestanden, ATG an den branchenweiten Wandel anzupassen und wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Er scheiterte und schredderte damit auch die interne Arbeitsmoral. Die ohnehin schon missliche Marktsituation des Unternehmens verschlechterte sich zusehends, und der Umsatz brach ein.
Es gehörte zwar noch immer zu den Branchenführern, war aber nicht mehr der Leitstern, den Isabelle als aufstrebende Führungskraft vor acht Jahren verlassen hatte. Während sich die Abwärtsspirale bei ATG fortsetzte, brauchten Vorstand und Aufsichtsrat annähernd ein Jahr, um sich über Mayers Nachfolge zu beraten, der offenkundig überrascht war, dass er seinen Chefsessel räumen musste. Im Verlauf dieser Zeit wurden mehrere interne und externe Kandidatinnen und Kandidaten in Betracht gezogen. Am Ende erwiesen sich jedoch alle als ungeeignet.
Im vergangenen Frühjahr hatte Carlo Proconi, Aufsichtsratsvorsitzender in den letzten Jahren von Mayers Amtszeit, Isabelle kontaktiert. Er hatte einen Aufenthalt in Dänemark geplant und ein Treffen mit ihr vereinbart. Sie hatte ihre berufliche Laufbahn bei ATG begonnen und rasch Karriere gemacht, bevor sie zu The Travel Group überwechselte, einem kleineren dänischen Reiseveranstalter, bei dem sie als Head of Marketing eine höhere Führungsposition bekleidete. Zwei Jahre später wurde sie mit der Leitung des Vertriebs- und Marketingbereichs betraut.
Als sich Carlo bei ihr meldete, war Isabelle ein wichtiges Mitglied des Leitungsgremiums von The Travel Group. Das Unternehmen zu verlassen, wäre ihr nicht in den Sinn gekommen. The Travel Group, ein rasant wachsender Reiseveranstalter mit Sitz in Kopenhagen, der auf eine Marktnische fokussiert und im Besitz einer europäischen Kapitalbeteiligungsgesellschaft war, konnte auf eine starke Marktposition verweisen und bot hochpreisige personalisierte Reiseerfahrungen im gesamten europäischen Raum an. Bei Branchenkennern war hinlänglich bekannt, dass Isabelle die treibende Kraft hinter dem Wachstum war und beträchtlichen Einfluss besaß, der weit über ihre Rolle im Vertrieb und Marketing hinausging.
Carlo traf sich mit ihr in Kopenhagen, »um sich über die aktuellen Trends in der Branche auszutauschen«, wie er es ausdrückte. Er war ein hochgewachsener Mann Anfang sechzig und ebenfalls Schweizer, stammte jedoch aus dem italienischsprachigen Teil des Landes. Er war pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk, bescheiden, nachdenklich und ein alter Hase in seinem Metier. Er konnte auf eine beeindruckende Laufbahn in der Finanzindustrie zurückblicken und genoss auch in der breiter gefächerten Schweizer Geschäftswelt den größten Respekt, der seinem unternehmerischen Scharfsinn, seinem Urteilsvermögen und seiner Integrität geschuldet war.
Während des gemeinsamen Mittagessens wurde kaum über Geschäftliches geredet. Sie unterhielten sich vornehmlich über Themen, die ihre Familien und persönliche Interessen betrafen. Isabelle war überrascht über den Verlauf des Gesprächs, zumal sie sich zuvor noch nie begegnet waren. Doch sie fühlte sich in seiner Gegenwart auf Anhieb wohl. Am Ende des Tages, kurz bevor Carlo aufbrach, um seinen Rückflug nach Zürich nicht zu verpassen, fragte er, ganz beiläufig, wie es schien: »Isabelle, könnten Sie sich vorstellen, in die Schweiz und zu ATG zurückzukehren?« Er erzählte ihr von der Chance, eine neue strategische Unternehmenseinheit zu leiten, die sich auf Geschäftsreisen und den B2B-Markt fokussierte. Ehrgeizig, wie es ihrem Wesen entsprach, war Isabelle offensichtlich interessiert, da ATG fünfmal größer war als The Travel Group.
»Nun, ich werde darüber nachdenken«, erwiderte sie. »Ich gebe zu, ich fühle mich geehrt. Ich muss natürlich mit meinem Mann und meinen Töchtern sprechen, aber ich denke, es wäre fantastisch, die Führung von ATG zu übernehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich auf dem Laufenden halten.«
Monatelang hörte Isabelle nicht mehr von Carlo. Sie dachte, dass er vermutlich seine Meinung geändert hatte. Sechs Monate später, als sie das Gespräch beinahe vergessen hatte, rief Carlo an: »Isabelle, wir ziehen Sie für die Position der CEO in Betracht. Könnten Sie innerhalb der nächsten Wochen nach Zürich kommen, um sich unseren Aufsichtsratsmitgliedern vorzustellen?«
»Wow«, sagte Isabelle. Als CEO-Kandidatin in die engere Wahl zu kommen, überstieg ihre kühnsten Erwartungen. Alle möglichen Gedanken gingen ihr durch den Kopf, und sie hatte damit zu kämpfen, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten. »Ich muss natürlich über Ihr Angebot nachdenken und mit meiner Familie sprechen. Bis wann brauchen Sie eine Antwort?«
»Reichen 24 Stunden?«, erwiderte Carlo.
Isabelle nahm sich ein paar Stunden frei. Sie machte einen Spaziergang durch den nahegelegenen Park, in dem sie gewöhnlich frühmorgens laufen ging. Sie musste ihre Gedanken ordnen und sich das Ganze in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Am Abend unterhielt sie sich mit Marco, ihrem Mann, stundenlang über die Chance, in die Schweiz und zu ATG zurückzukehren. Acht Jahre zuvor, als aufstrebende Führungskraft bei ATG, schien das Angebot, zur Travel Group überzuwechseln, ein gewagter Schritt zu sein, aber Isabelle hatte darin eine Chance gesehen, ihre Karriere zu beschleunigen.
Marco hatte die Veränderung damals akzeptiert, wenngleich zögernd. Da er bereits gute Arbeitsbeziehungen zu Verlagen in Zürich unterhielt, schien der Umzug nach Dänemark für seine Karriere als Autor keineswegs ideal zu sein. In Marcos beruflicher Entwicklung trat ebenfalls eine Wende ein: Statt sich der schweren Lektüre zu widmen, wie mit seinem Buch Mann & Menschheit, das für den Booker-Preis nominiert worden war, hatte er sich auf historische Detektivromane fokussiert, eine im Aufbau befindliche Serie, die aufgrund ihrer Authentizität und scharfsinnigen Plots bekannt war. Sein Verleger und er hofften, dass sich die Serie Charlemagnes Geheimnisse gut verkaufte. Und tatsächlich – sie gelangte auf die Bestsellerlisten und hielt sich dort.
Seither waren acht Jahre vergangen, und es machte ihm Spaß, anspruchsvolle Kriminalromane zu schreiben und in Kopenhagen zu leben. Isabelle und er hatten einen großen Freundeskreis aufgebaut, und ihre Töchter Marie und Annelies waren glücklich, kamen in der Schule gut zurecht und entwickelten sich prächtig.
Marco wusste natürlich, was Isabelle die Position als CEO der ATG bedeutete, und war bereit, wenngleich nicht gerade begeistert, wieder mit seiner Familie nach Zürich umzusiedeln. Die fünfzehnjährige Marie gehörte zu einer Gruppe von Klimaschutzaktivist*innen, die in Greta Thunberg ihr großes Vorbild sah; Annelies, zwölf Jahre alt, galt als aufgehender Stern im Tennisteam ihrer Schule. Isabelle und er hofften, dass die beiden Mädchen in Zürich vergleichbare Möglichkeiten hatten, ihren Interessen nachzugehen.
Solange sie sich erinnern konnte, hatte Isabelle hart gearbeitet, hatte alles gegeben, um irgendwann einmal eine solche Chance zu bekommen. Sie war das jüngste von sechs Geschwistern. Ihre Familie war arm. Der Vater, oft arbeitslos und alkoholabhängig, verrichtete Gelegenheitsarbeiten als Schreiner. Wenn er betrunken war, wurde er gewalttätig. Regelmäßig hatte er seine Frau und die Kinder geschlagen. Isabelles Mutter hatte sich nach besten Kräften bemüht, über die Runden zu kommen und den Kindern das Notwendigste zu beschaffen. Darüber hinaus hatte sie ihnen nicht viel zu bieten gehabt, weder Zeit noch Zuneigung.
Die traumatischen Kindheitserfahrungen hatten Wunden bei Isabelle hinterlassen. Sie war oft traurig und gereizt. Sie sehnte sich nach Anerkennung, ohne sagen zu können, warum. Sie fühlte sich ständig unter Druck gesetzt, der Welt und sich selbst zu beweisen, dass sie alles erreichen konnte, was sie sich vornahm, aber nur wenige Menschen außer Marco wussten um die Tiefe ihrer Verletzungen und Gefühle. Es fiel ihr schwer, anderen zu vertrauen, abgesehen von Marco und ihren Töchtern. Sie hatte keine Freundin, der sie ihre geheimsten Gedanken offenbaren konnte. Auch die Geschwister hatten keine vertrauensvolle Beziehung zueinander, trotz ihrer gemeinsamen, trostlosen Kindheit. Wenn sie überhaupt etwas verband, dann war es der Konkurrenzkampf um die ohnehin geringe Aufmerksamkeit der Mutter gewesen. Noch heute war die Geschwisterrivalität in allen Lebensbereichen zu spüren. Isabelles perfekt aufpoliertes äußeres Erscheinungsbild, das Selbstbewusstsein ausstrahlte, gab wenig über ihre tief verwurzelten Unsicherheiten preis. Sie war eine Einzelkämpferin, die gelernt hatte, ihre Gefühle zu verbergen.
Trotz ihrer Kindheitserfahrungen war es ihr jedoch gelungen, in vielen Lebensbereichen persönliche Stärken zu entwickeln. Sie hatte gelernt, zu kämpfen. Sie war smart, robust und konfliktfreudig. Sie setzte sich ehrgeizige Ziele und arbeitete hart, um sie zu erreichen. Sie besaß Charaktereigenschaften, die sie voranbrachten: Ehrgeiz, Tatkraft und ihre Arbeitsethik trugen ihr ein Vollstipendium an der Universität Zürich, einen Magister der Betriebswirtschaftslehre und nun ein Angebot als CEO von ATG ein.
Für sie war die Ernennung der Gipfel einer beeindruckenden Karriere und schlussendlich eine Bestätigung ihrer Fähigkeiten. Für eine Frau, die ständig Bestätigung, Anerkennung und Bewunderung suchte, fühlte sich die Chance wie der ultimative Triumph an. »Nach all den Jahren und Opfern, die ich bringen musste, bietet sich mir jetzt die Gelegenheit, ein Unternehmen wie die ATG zu leiten. Unfassbar«, dachte sie.
Am nächsten Morgen rief sie Carlo an. »Ich würde mich gerne um die Position bewerben. Es ist eine große Ehre für mich, eine solche Chance zu erhalten. Danke für das Vertrauen in meine Fähigkeiten. Wann soll ich in die Schweiz fliegen, um mich den Aufsichtsratsmitgliedern vorzustellen?«
»Könnten Sie nächste Woche kommen?«, fragte Carlo.
Zwei Monate später wurde Isabelle Dubois zur CEO der ATG bekannt gegeben.
Trotz ihres Erfolgs bei The Travel Group war ihre Ernennung für alle eine Überraschung. Die Schweizer Wirtschaftsmedien befassten sich ausführlich mit der Personalie. Einige Zeitungen stellten die Entscheidung in Frage. Die Berichterstattung klang, als hätte der Aufsichtsrat eine unerfahrene junge Frau mit der Leitung eines der führenden und bekanntesten Unternehmen des Landes betraut. Mit Mitte vierzig war Isabelle in der Tat jung. Die meisten Angehörigen des Topmanagement-Teams waren Mitte fünfzig. Obwohl Isabelle wichtige Positionen im Finanz- und Marketingbereich sowohl bei der ATG als auch bei der Travel Group bekleidet hatte, war ihre Stellung als CEO eine Premiere.
Isabells Start in ihrem neuen Wirkungskreis ließ sich holprig an. Am ersten Tag, nach einer Reihe von kurzen Einführungsgesprächen mit Angehörigen des Topmanagement- oder Group Executive Teams, kurz GET genannt, und einer Generalversammlung mit einigen hundert Belegschaftsmitgliedern im großen Auditorium der Züricher Zentrale, setzte sich Isabelle mit dem Finanzvorstand, dem CFO Hugo Werner, zusammen, um über die bisherigen Ergebnisse des dritten Quartals zu sprechen.
Der Finanzvorstand war Deutscher, stammte aus einem Münchner Außenbezirk und sprach mit einem starken bayrischen Akzent. Er genoss großes Ansehen in der Investment Community. Er war einer von zwei firmeninternen Bewerbern um die Position des CEO gewesen, schien die Entscheidung des Aufsichtsrats für Isabelle jedoch klaglos zu akzeptieren. Er war kurz angebunden, aber präzise – sagte kein Wort zu viel, nicht einmal dann, wenn er seine Meinung zum Ausdruck bringen sollte –, und die konservativen, formellen Anzüge, die er bevorzugte, spiegelten seine Seriosität und Kompetenz wider. Er zögerte, wenn es um Veränderungen ging, hatte sich jedoch als fähiger Finanzchef erwiesen, der imstande war, entschlossen zu handeln.
»Für das dritte Quartal erwarten wir einen Gewinnrückgang von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr«, eröffnete er Isabelle unverblümt kurz nach ihrer Amtseinführung. »Das ist auf die ungünstigen Wechselkursbewegungen des Schweizer Franken zurückzuführen. Grundlegend sind unsere Position und die Marktimpulse aber nach wie vor stark. Unsere Investoren werden sich das Ganze anschauen und verstehen.«
Das sollte sich als Wunschdenken erweisen.