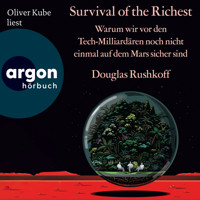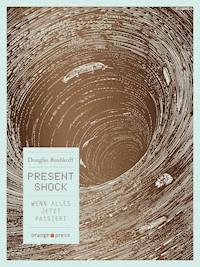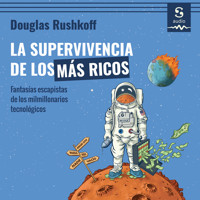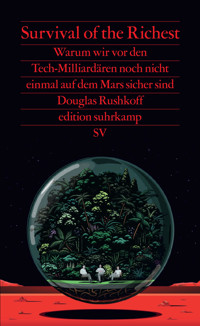
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Spätestens seit der Allianz von Donald Trump und Elon Musk ist klar: Die Tech-Milliardäre sind nicht nur die reichsten Männer der Welt, es geht ihnen auch um politische Macht und um die radikale Umgestaltung von Gesellschaft und Natur.
Als Douglas Rushkoff eine Einladung in ein exklusives Wüstenresort erhält, nimmt er an, dass er dort über Zukunftstechnologien sprechen soll. Stattdessen sieht er sich Milliardären gegenüber, die ihn zu Luxusbunkern und Marskolonien befragen. Während die Welt mit der Klimakatastrophe und sozialen Krisen ringt, zerbrechen sich diese Männer den Kopf, wie sie im Fall eines Systemkollapses ihre Privatarmeen in Schach halten können.
Der Medientheoretiker Rushkoff verfolgt die Internetrevolution seit Jahrzehnten, ist Erfinder der Begriffe »viral gehen« und »Digital Natives«, bewegte sich lange im Kreis von Vordenkern und kreativen Zerstörern. In einer Zeit, in der Elon Musk und Peter Thiel sich immer stärker in die Politik einmischen, rekonstruiert er, wie aus der Aufbruchsstimmung der 1990er ein Programm aus Angst und Größenwahn werden konnte. Viele Tech-Unternehmer wollen uns Normalsterbliche einfach nur hinter sich lassen, werden aber als Visionäre gefeiert. Angesichts der Zerrüttungen, die ihre Geschäftsmodelle produzieren, müssen wir uns von ihrem Mindset befreien – denn mitnehmen werden sie uns auf ihrem Exodus sicher nicht.
Ein flammendes Plädoyer gegen Egomanie und für die Wiederentdeckung kooperativen Handelns
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
3Douglas Rushkoff
Survival of the Richest
Warum wir vor den Tech-Milliardären nicht einmal auf dem Mars sicher sind
Aus dem Englischen von Stephan Gebauer
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Survival of the Richest. Escape Fantasies of the Tech Billionaires bei W.W. Norton & Company (New York).
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der 4. Auflage der deutschen Erstausgabe, 2025.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025© Douglas Rushkoff, 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: nach Entwürfen von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
Umschlagillustration: Oleg Buyevsky/illustrationzone.com
eISBN 978-3-518-78278-1
www.suhrkamp.de
Widmung
5Für Mark Filippi, Michael Nesmith und Genesis Breyer P-Orridge. Wish you were here.
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Einleitung Vorhang auf für das Mindset
1. Die Isolationsgleichung Die Bunkerstrategien der Milliardäre
2. Fusionen und Übernahmen Hab immer eine Exit-Strategie
3. Mutterleib mit Aussicht Geborgen in der technologischen Blase
4. Der Speiseaufzug Aus den Augen, aus dem Sinn
5. Selbstsüchtige Gene Der Wissenschaftsglaube kommt vor der Moral
6. Mit Vollgas voraus Entmenschlichen, beherrschen, ausbeuten
7. Exponentiell Wenn du nicht weiterkommst, gehe Meta
8. Technologie mit Überzeugungskraft Wenn man nur einfach einen Knopf drücken könnte
9. Visionen aus dem Burning Man We Are As Gods
10. The Great Reset Den Kapitalismus retten, um die Welt zu retten
11. Mindset in the Mirror Widerstand ist zwecklos
12. Kybernetisches Karma Mit dem eigenen Pulver hochgejagt
13. Mustererkennung Alles kommt zurück
Anmerkungen
Einleitung Vorhang auf für das Mindset
1. Die Isolationsgleichung Die Bunkerstrategien der Milliardäre
2. Fusionen und Übernahmen Hab immer eine Exit-Strategie
3. Mutterleib mit Aussicht Geborgen in der technologischen Blase
4. Der Speiseaufzug Aus den Augen, aus dem Sinn
5. Selbstsüchtige Gene Der Wissenschaftsglaube kommt vor der Moral
6. Mit Vollgas voraus Entmenschlichen, beherrschen, ausbeuten
7. Exponentiell Wenn du nicht weiterkommst, gehe Meta
8. Technologie mit Überzeugungskraft Wenn man nur einfach einen Knopf drücken könnte
9. Visionen aus dem Burning Man We Are As Gods
10. The Great Reset Den Kapitalismus retten, um die Welt zu retten
11. Mindset in the Mirror Widerstand ist zwecklos
12. Kybernetisches Karma Mit dem eigenen Pulver hochgejagt
13. Mustererkennung Alles kommt zurück
Dank
Informationen zum Buch
3
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
281
282
9
Einleitung Vorhang auf für das Mindset
Eines Tages erhielt ich eine Einladung in ein Superluxusresort, um dort eine Rede zu halten. Ich nahm an, ich würde vor etwa hundert Investmentbankern sprechen. Nie zuvor war mir ein derart hohes Honorar für einen Vortrag angeboten worden – es entsprach etwa einem Drittel meines Jahresgehalts als Professor an einer staatlichen Hochschule. Und das für ein paar Überlegungen zur »Zukunft der Technologie«.
Als Humanist, der sich mit den Auswirkungen der digitalen Technologie auf unser Leben beschäftigt, werde ich oft fälschlicherweise für einen Futuristen gehalten. Aber ich spreche nicht gerne über die Zukunft, vor allem nicht vor reichen Leuten, denn die Frage-und-Antwort-Runde endet immer mit einer Art Gesellschaftsspiel, in dem meine Meinung zu den neuesten Tech-Modeworten abgefragt wird, so als handelte es sich um Tickersymbole an der Börse: KI, VR, CRISPR. Die Zuhörer interessieren sich selten für die Funktionsweise dieser Technologien oder für ihre gesellschaftlichen Auswirkungen jenseits der binären Entscheidung, ob man in sie investieren sollte oder nicht. Aber das Geld hat das Sagen, und also sprach ich auch und nahm die Einladung an.
Ich flog Business Class. Ich bekam Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, und während ich auf dem MacBook meinen Vortrag entwarf, wurde mir eine erwärmte Nussmischung serviert (ja, sie erwärmen die Nüsse tatsächlich). Ich 10wollte darüber sprechen, dass digitale Unternehmen die Kreislaufwirtschaft fördern könnten, anstatt alles auf den extraktiven wachstumsgestützten Kapitalismus zu setzen – dabei war mir schmerzhaft bewusst, dass weder der ethische Wert meiner Worte noch die Emissionszertifikate, die ich zusammen mit meinem Flugticket gekauft hatte, den von mir verursachten Umweltschaden auch nur annähernd wettmachen konnten. Ich finanzierte meine Hypothek und den Sparplan für das Studium meiner Tochter auf Kosten der Menschen und Orte dort unten.
Am Flughafen wartete eine Limousine, die mich geradewegs in die Hochwüste brachte. Ich begann ein Gespräch mit dem Fahrer über den UFO-Kult in dieser Region und über den Kontrast zwischen der einsamen Schönheit dieser Landschaft und dem hektischen Treiben in New York. Vermutlich wollte ich ihm zeigen, dass ich nicht zu jener Art von Leuten zählte, die es sich normalerweise in Limousinen bequem machten. Als wollte er klarstellen, dass es sich bei ihm genau umgekehrt verhielt, eröffnete er mir, dass dies nicht sein Hauptberuf war: Er sei eigentlich ein Daytrader, der jedoch nach ein paar »schlecht getimten Optionsgeschäften« eine Durststrecke überstehen müsse.
Als die Sonne hinter dem Horizont verschwand, wurde mir bewusst, dass ich nun bereits seit drei Stunden in diesem Wagen saß. Was waren das für Hedgefonds-Millionäre, die für eine Konferenz einen Ort aufsuchten, der sich derart weit entfernt vom nächsten Flughafen befand? Dann sah ich es: Neben der Straße setzte ein kleines Flugzeug auf einem privaten Flughafen zur Landung an, ganz so, als würde es sich ein Wettrennen mit uns liefern. Natürlich.
11Einen Hügel weiter befand sich der abgelegenste und zugleich luxuriöseste Ort, den ich je gesehen hatte, ein Resort samt Spa mitten im, tja, Nirgendwo. Eingebettet in eine große Felsformation erstreckten sich über das Areal verstreut moderne Gebäude aus Stein und Glas, von denen aus man die schier unendliche Wüste überblickte. Bei der Anmeldung kam mir außer dem Hotelpersonal niemand zu Gesicht, und ich musste einen Lageplan benutzen, um meinen privaten »Pavillon« zu finden. Zur Unterkunft zählte ein eigener Whirlpool auf der Terrasse.
Am folgenden Morgen wurde ich von zwei Männern in identischen Patagonia-Jacken abgeholt. Wir fuhren in einem Golfcart zwischen Felsen und Strauchwerk hindurch zu einem Konferenzzentrum. Sie führten mich in einen Backstage-Raum, wo ich Kaffee trinken und mich auf meinen Vortrag vorbereiten konnte. Zumindest dachte ich das. Denn anstatt mir ein Mikrofon anzustecken oder mich auf eine Bühne zu führen, brachten sie mein Publikum hierher zu mir. Die Teilnehmer nahmen an einem Tisch Platz und stellten sich vor: Es waren fünf superreiche Männer aus der Welt der Tech-Firmen und Hedgefonds. Mindestens zwei von ihnen waren Milliardäre. Nach ein wenig Smalltalk wurde mir klar, dass sie nicht an meinem Vortrag über die Zukunft der Technologie interessiert waren. Diese Leute waren gekommen, um Fragen zu stellen.
Es ging ganz harmlos und erwartbar los. Bitcoin oder Ethereum? Virtual oder Augmented Reality? Wer wird als Erster einen einsatzfähigen Quantencomputer haben: China oder Google? Aber meine Antworten schienen bei meinen Gesprächspartnern wenig zu verfangen. Kaum hatte ich begonnen, die Vorzüge von Proof-of-Stake und Proof-of-12Work bei der Blockchain gegeneinander abzuwägen, gingen sie schon zur nächsten Frage über. Ich hatte den Eindruck, dass sie weniger meine Kenntnisse als meine Skrupel zu testen versuchten.
Endlich brachten sie das Gespräch auf das Thema, das sie wirklich interessierte: Neuseeland oder Alaska? Welche Region würde am wenigsten unter der kommenden Klimakrise leiden? Von da an wurde es immer schlimmer. Welches war die größere Bedrohung: Klimawandel oder biologische Kriegführung? Auf welchen Zeitraum, in dem man auf sich gestellt sein würde und ohne jede Hilfe von außen zu überleben hätte, müsste man sich einstellen? Sollte ein Zufluchtsort ein eigenes System zur Versorgung mit Atemluft haben? Wie wahrscheinlich wäre eine Kontaminierung des Grundwassers? Schließlich erklärte der Geschäftsführer einer Brokerfirma, er sei fast fertig mit dem Bau seines eigenen unterirdischen Bunkersystems. »Wie kann ich nach dem Ereignis die Befehlsgewalt über meine Sicherheitskräfte bewahren?«, fragte er. Nach dem Ereignis. Mit diesem Euphemismus umschrieben sie Umweltkollaps, gesellschaftliche Unruhen, Atomexplosionen, Sonnenstürme, unaufhaltbare Virusepidemien oder bösartige Hackerangriffe, die ganze Volkswirtschaften lahmlegen konnten.
Dies war die Frage, die die restliche Stunde beschäftigte. Diese Männer wussten, dass sie bewaffnetes Wachpersonal brauchen würden, um ihre Anlagen gegen Plünderer und wütende Mobs zu verteidigen. Einer hatte bereits ein Dutzend Navy SEALs angeworben, die ihm auf ein Signal hin in seiner Anlage zu Hilfe eilen würden. Aber wie sollte er seine Bodyguards bezahlen, wenn auch seine Kryptowährungen wertlos würden? Wie konnte er die Wachen daran 13hindern, sich schließlich von ihm loszusagen und sich einen anderen Dienstherrn zu suchen?
Die Milliardäre spielten mit dem Gedanken, die Lebensmittelvorräte mit speziellen Schlössern zu schützen, deren Kombinationen nur sie kennen würden. Oder sie wollten ihren Leibwächtern als Gegenleistung für deren Überleben an ihrer Seite eine Art von Disziplinarhalsbändern anlegen. Vielleicht konnte man auch Roboter bauen, die sich als Leibwächter und Arbeitskräfte einsetzen ließen – sofern es möglich war, die benötigte Technologie »rechtzeitig« zu entwickeln.
Ich versuchte, sie zur Räson zu bringen. Ich argumentierte sozial und erklärte ihnen, unsere gemeinsamen langfristigen Herausforderungen könnten wir am besten durch partnerschaftliches und solidarisches Vorgehen bewältigen. Die Leibwächter würden in Zukunft am ehesten loyal sein, wenn man sie in der Gegenwart wie Freunde behandle. Man könne nicht nur Munition und elektrische Zäune kaufen, sondern müsse auch in Menschen und Beziehungen investieren. Sie rollten mit den Augen, so sehr musste sich das für sie nach Hippiephilosophie angehört haben. Also eröffnete ich ihnen freimütig, man verhindere am ehesten, dass einem der Sicherheitschef morgen die Kehle aufschlitzt, wenn man heute die Bat Mizwa seiner Tochter sponsort. Sie lachten. Wenigstens bekamen sie ein wenig Unterhaltung für ihr Geld.
Aber sie wirkten auch ein wenig verärgert, denn ich nahm sie nicht ernst genug. Aber wie konnte ich sie ernst nehmen? Dies war wahrscheinlich die reichste, mächtigste Gruppe Menschen, der ich je begegnet war. Und jetzt baten diese Männer einen marxistischen Medientheoretiker um Rat, wo 14und wie sie ihre Bunker für den Weltuntergang anlegen sollten. Dann begriff ich: Zumindest für diese Herrschaften war dies tatsächlich ein Gespräch über die Zukunft der Technologie.
Inspiriert wurden ihre Vorhaben von den Ideen des Tesla-Gründers Elon Musk, der den Mars besiedeln will,1 von Palantirs Peter Thiel, der den Alterungsprozess aufzuhalten versucht,2 und von den KI-Entwicklern Sam Altman und Ray Kurzweil, die beabsichtigen, ihre Gehirne auf Supercomputer hochzuladen.3 Nun wollten sie sich auf eine digitale Zukunft vorbereiten, in der es weniger darum gehen würde, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sondern eher darum, das menschliche Dasein überhaupt hinter sich zu lassen. Ihr extremer Reichtum und ihre privilegierte Position bestärkten sie lediglich in dem Wunsch, sich angesichts der sehr realen und allgegenwärtigen Bedrohung durch Klimawandel, Meeresspiegelanstieg, Massenmigration, globale Pandemien, einwanderungsfeindliche Panik und Ressourcenerschöpfung noch mehr von der übrigen Gesellschaft abzuschotten. In ihren Augen erfüllte die Technologie der Zukunft nur einen Zweck: Sie sollte ihnen helfen, vor dem Rest von uns zu fliehen.
Früher überhäuften diese Leute die Welt mit abstrus optimistischen Business-Plänen, die der menschlichen Gesellschaft großartigen technologischen Nutzen versprachen. Mittlerweile haben sie den technologischen Fortschritt auf ein Videospiel reduziert, bei dem einer von ihnen gewinnt, weil er den Notausstieg findet. Wer wird gewinnen? Bezos, der ins All umzieht? Thiel, der sich in seine Anlage in Neuseeland verkriecht? Zuckerberg, der im virtuellen Metaverse Zuflucht findet? Und diese Milliardäre mit ihrer Ka15tastrophenvision sind die vermeintlichen Gewinner der digitalen Ökonomie, die Triumphatoren in einer Unternehmenswelt, in der das Gesetz der natürlichen Auslese gilt und die diese Überlegungen überhaupt erst angestoßen hat.
Natürlich war es nicht immer so. Anfang der 1990er Jahre schien die digitale Zukunft unbegrenzte Möglichkeiten zu eröffnen. Obwohl ihr Ursprung in der militärischen Kryptografie und Vernetzung lag, hatte sich die digitale Technologie zu einer Spielwiese für die Gegenkultur entwickelt, die in ihr eine Chance auf eine Zukunft mit mehr Teilhabe, besserer Verteilung und Partizipation erblickte. Tatsächlich ging es in dieser neuen, »digitalen Renaissance«, wie ich sie im Jahr 1991 zu nennen begann, um die Entfesselung der kollektiven menschlichen Imagination. Sie umfasste alles von der Chaostheorie über die Quantenphysik bis zu Fantasy-Rollenspielen.
In der frühen Cyberpunk-Ära glaubten viele von uns, dass die enger als je zuvor miteinander verbundenen und koordinierten Menschen jede nur irgendwie vorstellbare Zukunft errichten könnten. Wir lasen Zeitschriften wie Reality Hackers, FringeWare und Mondo2000, in denen der virtuelle Raum mit psychedelischen Welten, das Computer-Hacking mit einer bewussten Evolution und die Online-Vernetzung mit riesigen elektronischen Tanzpartys – Raves – gleichgesetzt wurden. Die künstlichen Grenzen linearer Kausalbeziehungen und hierarchischer Klassifikationen würden durch ein Fraktal sich entfaltender Interdependenzen ersetzt. Das Chaos war nicht beliebig, sondern rhythmisch. Wir würden aufhören, die Weltmeere durch das kartografische Netz von Längen- und Breitengraden 16zu betrachten, sondern sie anhand der zugrundeliegenden Muster der Wellen wahrnehmen. »Gute Surfbedingungen«, verkündete ich in meinem ersten Buch über die digitale Kultur.
Niemand nahm uns wirklich ernst. Jenes Buch wurde im Jahr 1992 vom ursprünglichen Verlag wieder aus dem Programm genommen, weil die Verlagsleitung der Meinung war, die Mode der Computervernetzung werde am geplanten Erscheinungstermin Ende 1993 schon wieder vorbei sein. Erst als später in jenem Jahr das Magazin Wired auf den Markt kam und das entstehende Internet zur Geschäftschance erklärte, nahmen Personen mit Macht und Geld Notiz von der Entwicklung. In der ersten Nummer des Hochglanz-Magazins wurde ein »Tsunami« angekündigt. Aus den Artikeln ging hervor, dass nur jene Investoren, die sich über die von den Futuristen in der Zeitschrift entworfenen Szenarien auf dem Laufenden hielten, die Flutwelle überleben würden.
Es ging nicht länger um die psychedelische Gegenkultur, um Hypertext-Abenteuer oder um das kollektive Bewusstsein. Nein, die digitale Revolution war überhaupt keine Revolution, sondern eine Geschäftschance – eine Gelegenheit, die bereits dahinsiechende Technologiebörse mit Steroiden aufzupäppeln und nach Möglichkeit noch ein paar Jahrzehnte Wachstum aus einer Wirtschaft herauszupressen, die seit dem Absturz der Biotechnologiebranche im Jahr 1987 als totgeweiht galt.
Also strömten die Investoren in den Tech-Sektor zurück, um beim Dotcom-Boom mitzumischen. Die Berichterstattung über das Internet verschwand von den Kultur- und Medienseiten der Zeitungen und wanderte in den Wirt17schaftsteil. Etablierte Unternehmen erkannten im Internet neues Potenzial, aber sie interessierten sich nur für die gute alte Extraktion, die sie seit je betrieben hatten. Währenddessen wurden vielversprechende junge Entwickler mit Einhorn-Börsengängen und Millionenangeboten verführt. Die digitale Zukunft bekam Ähnlichkeit mit Aktien- und Rohstoff-Futures: Sie wurden etwas, über dessen Zukunft man spekuliert und worauf man Wetten platziert. Und genauso behandelte man die Benutzer der Technologie weniger wie kreative Mitwirkende, die es zu befähigen galt, sondern sie verwandelten sich in Konsumenten, die man manipulieren konnte. Je besser man das Verhalten der Benutzer vorhersagen konnte, desto sicherer war die Wette.
Es dauerte nicht lange, da fand man in fast allen Reden, Artikeln, Studien, Dokumentationen oder Weißbüchern über die entstehende digitale Gesellschaft Verweise auf irgendein Tickersymbol eines Börsenwerts. Die Zukunft war nicht länger etwas, das wir durch unsere gegenwärtigen Entscheidungen oder Hoffnungen für die Menschheit erschufen, sondern sie verwandelte sich in ein vorherbestimmtes Szenario, auf das wir unser Risikokapital verwetten, um von da an passiv auf seine Verwirklichung zu warten.
So blieb allen Beteiligten eine Auseinandersetzung mit den moralischen Implikationen ihrer Handlungen erspart. Die technologische Entwicklung diente weniger dem kollektiven Wohlergehen als dem persönlichen Überleben durch die Akkumulation des Reichtums. Mehr noch, wenn man dies ansprach, entlarvte man sich unabsichtlich als Feind des Marktes oder als technologiefeindlicher Mäkler, wie ich beim Schreiben von Büchern und Artikeln über diese Entwicklung erfahren musste. Die Entwicklung der 18Technologie und das Wachstum des Marktes wurden gleichgesetzt und als unvermeidlich und sogar moralisch wünschenswert betrachtet.
Die Rücksicht auf die Erfordernisse des Marktes beherrschte den medialen und intellektuellen Raum, in dem normalerweise eine Auseinandersetzung mit der Frage stattgefunden hätte, welche praktischen ethischen Implikationen die Verarmung der Vielen zum Wohl der Wenigen hatte. Die Mainstream-Debatte kreiste stattdessen um abstrakte Mutmaßungen über unsere vorherbestimmte Hightech-Zukunft: Ist es fair, dass ein Aktienhändler Smart Drugs verwendet? Sollte man Kindern Fremdsprachenimplantate einsetzen? Sollten autonome Fahrzeuge eher das Leben von Fußgängern oder das ihrer Insassen schützen? Sollten die ersten Kolonien auf dem Mars demokratisch regiert werden? Untergräbt eine Veränderung meiner DNA meine Identität? Sollten Roboter Rechte haben?
Die Beschäftigung mit derartigen Fragen, die immer noch anhält, mag philosophischen Unterhaltungswert besitzen. Aber sie ist kaum ein Ersatz für die Auseinandersetzung mit den wirklichen moralischen Dilemmata, die mit der ungehinderten technologischen Entwicklung im Namen des Unternehmenskapitalismus verbunden sind. Digitale Plattformen haben einen bereits ausbeuterischen und extraktiven Markt (man denke an Walmart) in ein System verwandelt, das die Entmenschlichung noch weiter treibt (man denke an Amazon). Den meisten von uns wurden die Schattenseiten dieser Entwicklung bewusst, als wir mit der Automatisierung von Arbeitsplätzen, der Gig-Ökonomie und dem Untergang des lokalen Einzelhandels sowie des Lokaljournalismus konfrontiert wurden.
19Aber besonders verheerend wirkt sich der digitale Vollgaskapitalismus auf die Umwelt, die Armen der Welt und die Zukunft der Zivilisation aus, die ihre Unterdrückung ankündigt. Die Herstellung unserer Computer und Smartphones hängt weiterhin von einem Netzwerk der Sklavenarbeit ab. Diese Praktiken sind tief verwurzelt. Das Unternehmen Fairphone, das mit dem Ziel gegründet wurde, ethisch unbedenkliche Mobiltelefone herzustellen und zu vermarkten, musste feststellen, dass dies unmöglich war. (Mittlerweile hat der Gründer der Firma seinen Produkten die traurige Beschreibung »fairere Handys« verpasst.)4 Die Gewinnung von Metallen Seltener Erden und die Entsorgung unserer hochgradig digitalen Technologien zerstören menschliche Lebensräume, die sich in Giftmülldeponien verwandeln, auf denen verarmte indigene Kinder und ihre Familien nach verwertbarem Material suchen, das wieder an die Hersteller verkauft wird – die dieses »Recycling« zynisch als Teil ihrer Bemühungen um Umweltschutz und Gemeinwohl bezeichnen.
Die externalisierte Armut und Umweltzerstörung nach dem Motto »Aus den Augen, aus dem Sinn« verschwindet nicht einfach, nur weil wir die Welt durch VR-Brillen betrachten und in eine alternative Realität abtauchen. Je länger wir die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen ignorieren, desto größer werden die Probleme. Das wiederum verstärkt die Neigung zu Rückzug, Isolationismus und apokalyptischen Fantasien – und zu aus der Verzweiflung geborenen Technologien und Business-Plänen: ein Teufelskreis.
Je mehr wir dieses Weltbild verinnerlichen, desto eher betrachten wir andere Menschen als das Problem und die 20Technologie als Lösung, um diese anderen zu kontrollieren und in Schach zu halten. Wir betrachten die herrlich eigenwillige, unvorhersehbare und irrationale menschliche Natur nicht mehr als feature, sondern als bug. Technologien betrachten wir trotz ihrer eigenen, in sie eingebauten Verzerrungen als neutral, und lösen sie menschliches Fehlverhalten aus, so sehen wir darin lediglich einen Ausdruck unseres mangelhaften Wesens. Es scheint, als wäre eine angeborene, unabänderliche menschliche Wildheit für unsere Probleme verantwortlich. So wie die Ineffizienz eines lokalen Taximarkts mit einer App »behoben« werden kann, die menschliche Fahrer in den Bankrott treibt, können die ärgerlichen Widersprüche der menschlichen Psyche durch ein digitales oder genetisches Upgrade aus der Welt geschafft werden.
Letzten Endes, so die Lehre der techno-solutionistischen Orthodoxie, wird die menschliche Zivilisation in der Zukunft ihren Zenit erreichen, weil wir unser Bewusstsein in einen Computer hochladen oder – was noch besser wäre – weil wir akzeptieren, dass die Technologie tatsächlich unser evolutionärer Nachfolger ist. Wie die Angehörigen einer gnostischen Sekte sehnen wir uns danach, in die nächste transzendente Phase unserer Entwicklung einzutreten, uns von unseren Körpern zu lösen und sie samt unseren Sünden und unserem Leid, vor allem aber samt den wirtschaftlich Unterlegenen zurückzulassen.
Film und Fernsehen führen uns diese Fantasien vor. Zombie-Serien zeigen uns eine postapokalyptische Welt, in der die Menschen nicht besser sind als die Untoten – und das anscheinend anerkennen. Noch schlimmer ist, dass diese Serien die Zuschauer dazu bewegen, sich die Zukunft 21als Nullsummen-Krieg zwischen den verbliebenen Menschen auszumalen, als einen Konflikt, in dem das Überleben einer Gruppe von der Vernichtung einer anderen abhängt. Sogar in den avanciertesten Science-Fiction-Serien sind uns Roboter intellektuell und ethisch überlegen. Es sind stets die Menschen, die auf wenige Zeilen Programmcode reduziert werden, während die Künstlichen Intelligenzen lernen, bewusster komplexe Entscheidungen zu fällen.
Die geistigen Verrenkungen, die für diesen Rollentausch zwischen Mensch und Maschine nötig sind, beruhen allesamt auf der Annahme, dass die meisten Menschen im Grunde wertlos und gedankenlos selbstzerstörerisch sind. Entweder wir ändern sie, oder wir trennen uns für immer von ihnen. Daher schießen Tech-Milliardäre Elektroautos ins All – als beweise das etwas anderes als die Fähigkeit eines Milliardärs, für sein Unternehmen zu werben.5 Und sollten einige wenige Menschen tatsächlich die Fluchtgeschwindigkeit erreichen und es irgendwie schaffen, in einer Blase auf dem Mars zu überleben – obwohl es uns nicht einmal gelingt, eine solche Blase in zwei Biosphärenprojekten, die mehrere Milliarden Dollar kosten, hier auf der Erde funktionstüchtig zu machen –, wäre das Resultat weniger ein weiteres Kapitel menschlicher Diaspora, sondern vielmehr ein Rettungsboot für die Elite.6 Den meisten denkenden, atmenden Menschen ist klar, dass es kein Entkommen gibt.
Als ich da also saß, an importiertem Eisbergwasser nippte und mit den großen Gewinnern unserer Gesellschaft Weltuntergangsszenarien durchspielte, wurde mir klar, dass diese Männer in Wahrheit die Verlierer waren. Die Milliardäre, die mich in die Wüste holten, um ihre Bunkerstrategien zu beurteilen, sind weniger Sieger im wirtschaftlichen 22Spiel als vielmehr Opfer seiner pervers begrenzten Regeln. Vor allem sind sie in einem Mindset gefangen, in dem »gewinnen« bedeutet, genug Geld zu verdienen, um sich von dem Schaden abzuschotten, den sie verursachen, indem sie auf diese Art und Weise Geld verdienen. Es ist, als wollten sie ein Auto bauen, das schnell genug fährt, um seinen eigenen Abgasen zu entkommen.
Doch bestärkt dieser Silicon-Valley-Eskapismus – ich möchte ihn als »das Mindset« bezeichnen – seine Anhänger in dem Glauben, die Gewinner könnten den Rest der Menschheit irgendwie zurücklassen. Vielleicht war das die ganze Zeit ihr Ziel. Vielleicht ist dieses fatalistische Streben, sich über die Menschheit zu stellen und sich von ihr zu lösen, nicht nur das Resultat des zügellosen digitalen Kapitalismus, sondern auch seine Ursache – eine Art, miteinander und mit der Welt umzugehen, deren Ursprünge wir in den soziopathischen Tendenzen der empirischen Wissenschaft, des Individualismus, der sexuellen Dominanz, ja des »Fortschritts« an sich finden können.
Die Tyrannen sind seit den Zeiten der Pharaonen und Alexanders des Großen bestrebt, sich über große Zivilisationen zu erheben und diese zu beherrschen. Aber nie zuvor sind die mächtigsten gesellschaftlichen Akteure von der Erwartung ausgegangen, die vorrangige Auswirkung ihrer Eroberungen werde darin bestehen, das Leben für alle anderen Menschen auf der Erde unmöglich zu machen. Und nie zuvor verfügten sie über Technologien, die sie in die Lage versetzt hätten, ihre Vorstellungen in die Grundstruktur der Gesellschaft einzulassen. Die Landschaft wimmelt von Algorithmen und Intelligenzen, die ein derart selbstsüchtiges und isolationistisches Weltbild fördern. Jene, die sozio23pathisch genug sind, um es zu übernehmen, werden mit Geld und Kontrolle über den Rest von uns belohnt. Es ist eine selbstverstärkende Feedbackschleife. Das ist neu.
Dank der digitalen Technologien und der von ihnen ermöglichten beispiellosen Vermögensungleichheit erlaubt es das Mindset, Schaden einfach auf andere abzuwälzen, und weckt ein entsprechendes Bedürfnis nach Transzendenz und Trennung von den Menschen und Orten, die unter dieser Externalisierung leiden. Wie wir sehen werden, beruht dieses Mindset auf einem unerschütterlich atheistischen und materialistischen Szientismus, auf einem blinden Vertrauen in das Lösen der Probleme durch Technologie, auf der Befolgung der Schranken des digitalen Codes, auf einem Verständnis zwischenmenschlicher Beziehungen als Marktphänomenen, auf der Furcht vor der Natur und den Frauen, auf dem Bedürfnis, die eigenen Beiträge als einzigartige und beispiellose Neuerungen zu betrachten, und auf dem Bemühen, das Unbekannte zu neutralisieren, indem man es beherrscht und entseelt.
Aber anstatt einfach für immer über uns zu thronen, streben die Milliardäre an der Spitze dieser virtuellen Pyramiden aktiv ein Finale an. Tatsächlich erfordert die Struktur des Mindset eine endgültige Lösung, so als handle es sich um einen Marvel-Blockbuster. Alles muss auf eine Eins oder eine Null, auf Sieger oder Verlierer, auf Geretteter oder Verdammter hinauslaufen. Tatsächlich bevorstehende dramatische Ereignisse von der Klimakrise bis zu Massenmigrationsbewegungen bestätigen den Mythos und eröffnen Möchtegern-Superhelden die Chance, das Finale zu ihren Lebzeiten für sich zu entscheiden. Denn das Mindset beinhaltet auch die vom Glauben getragene Silicon-Valley-Ge24wissheit, man könne eine Technologie entwickeln, die sich über die Gesetze von Physik, Ökonomie und Moralität hinwegsetzen und ihren Eigentümern etwas noch Besseres als die Rettung der Welt ermöglichen werde: Sie soll sie in die Lage versetzen, der von ihnen heraufbeschworenen Apokalypse zu entkommen.
25
1. Die Isolationsgleichung Die Bunkerstrategien der Milliardäre
Als ich mich auf meinem Sitzplatz in dem Flugzeug niedergelassen hatte, das mich nach New York zurückbringen sollte, kreisten meine Gedanken nur noch um die Implikationen des Mindset. Wie war es entstanden? Wodurch war es hervorgerufen worden? Was besagte es? Wer waren seine wahren Gläubigen? Und was, wenn überhaupt, konnte man ihm entgegensetzen? Noch bevor die Maschine in New York landete, postete ich einen Text über mein sonderbares Erlebnis.1 Die Reaktionen überraschten mich.
Fast augenblicklich trafen erste Anfragen von Unternehmen ein, die Dienste für milliardenschwere Prepper anboten und hofften, ich würde sie in Kontakt mit den fünf Männern bringen, über die ich geschrieben hatte. Es meldete sich ein Immobilienmakler, der sich auf katastrophensichere Anwesen spezialisiert hatte. Ein weiteres Unternehmen nahm Kaufreservierungen für seine dritte unterirdische Wohnanlage entgegen, und eine Sicherheitsfirma bot verschiedene Formen von »Risikomanagement« an.
Die für mich interessanteste Mitteilung stammte jedoch von einem ehemaligen Leiter der Amerikanischen Handelskammer in Lettland. J. C. Cole war Zeuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion gewesen und hatte gesehen, wie schwierig es war, praktisch aus dem Nichts eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen. Er hatte auch Gebäude an die Botschaften der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union vermietet und kannte sich mit Sicherheitssys26temen und Evakuierungsplänen aus. »Sie haben in ein Wespennest gestochen«, schrieb er in seiner ersten E-Mail. »Ihre Beschreibung scheint mir durchaus zutreffend: Die Reichen, die sich in ihren Bunkern verstecken, werden ein Problem mit ihren Sicherheitsteams haben … Meiner Meinung nach ist Ihr Ratschlag richtig, dass man ›diese Leute auch jetzt sehr gut behandeln‹ sollte, aber das Konzept kann erweitert werden, und in meinen Augen gibt es ein besseres System, das sehr viel bessere Resultate liefern würde.«
Er legte die Fakten dar. Er war überzeugt, dass das »Ereignis« – ein Grauer Schwan oder eine vorhersehbare Katastrophe, die durch einen feindlichen Angriff, durch Mutter Natur oder einfach durch Zufall ausgelöst werden könnte – unvermeidlich sei. Er hatte eine SWOT-Analyse vorgenommen, das heißt Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken untersucht, und war zu dem Schluss gelangt, dass man zur Vorbereitung auf ein Unglück dieselben Maßnahmen ergreifen müsse wie zu seiner Verhinderung. »Zufällig stelle ich gerade mehrere Safe Haven Farms in der Umgebung von New York fertig«, schrieb er. »Diese sind dafür ausgelegt, ein ›Ereignis‹ möglichst gut zu bewältigen und der Gesellschaft als quasiökologische Farmen zu dienen. Sie sind drei Fahrtstunden von der Stadt entfernt, das heißt so nah, dass man es im Notfall bis dorthin schafft.«
Das klang sehr verlockend. Hier hatte ich es mit einem Prepper zu tun, der mit Sicherheitsfragen vertraut war, praktische Erfahrung besaß und sich mit nachhaltiger Lebensmittelversorgung auskannte. Er war überzeugt, wir könnten die bevorstehende Katastrophe am besten bewältigen, indem wir sofort begannen, unsere Mitmenschen, die Wirtschaft und den Planeten anders zu behandeln. Er hielt es je27doch auch für nötig, ein Netz geheimer, vollkommen autarker landwirtschaftlicher Gemeinden für Millionäre zu errichten, die von schwerbewaffneten Navy SEALs beschützt werden sollten.
J. C. baut gegenwärtig zwei Farmen auf, die Teil seines Projekts »Safe Haven« sind. Sein Vorzeigemodell, die Farm 1 außerhalb von Princeton, »funktioniert gut, solange die Polizei funktioniert«. Die zweite Farm, die irgendwo in den dicht bewaldeten Pocono Mountains in Pennsylvania versteckt ist, muss ein Geheimnis bleiben. »Je weniger Leute die Standorte kennen, desto besser«, erklärte mir J. C. und fügte einen Link zu der Folge der Serie Twilight Zone hinzu, in der verängstigte Nachbarn angesichts eines drohenden Atomkriegs den Schutzbunker einer Familie stürmen. »Der größte Vorzug von Safe Haven ist die Betriebssicherheit, beim Militär OpSec genannt. Falls/Wenn die Lieferkette gestört wird, kommen die Menschen nicht mehr an Lebensmittel heran. Die Corona-Pandemie war ein Weckruf: Die Leute begannen, um Toilettenpapier zu kämpfen. Wenn die Nahrung knapp wird, wird es übel werden. Jene, die intelligent genug sind, zu investieren, achten deshalb auf Geheimhaltung.«
J. C. bot an, nach New York zu kommen, um mir sein Projekt zu erklären, aber ich wollte die Anlage mit eigenen Augen sehen. Er war gerne bereit, sie mir zu zeigen, und lud mich ein, ihn in New Jersey zu besuchen. »Ziehen Sie Stiefel an«, sagte er. »Der Boden ist noch morastig.« Dann fragte er. »Schießen Sie?«
Die Farm umfasste einen Reiterhof und eine Gefechtstrainingsanlage. Außerdem wurden dort Ziegen und Hühner gehalten. J. C. brachte mir bei, mit einer Glock auf 28Pappsilhouetten von Bösen Jungs zu schießen, während er darüber schimpfte, dass Senatorin Dianne Feinstein willkürlich die Zahl der Patronen in einem Magazin für das Pistolenmodell beschränkt habe. J. C. konnte man nichts erzählen. Ich stellte ihm Fragen zu verschiedenen hypothetischen Kampfsituationen: Wie verteidigt man sich gegen eine gewalttätige Bande, die versucht, die Farm zu stürmen? »Man verteidigt sich überhaupt nicht«, antwortete er. »Beim Prepping geht es darum, mit heiler Haut davonzukommen.«
Natürlich lagen die Dinge etwas anders, wenn man eine Anlage besaß wie die, die J. C. baute. »Deine Familie kannst du nur in einer Gruppe schützen«, erklärte er. Genau darum geht es in seinem Projekt: Es soll ein Team gebildet werden, das in der Lage ist, ein Jahr oder länger an einem Ort auszuharren und sich gegen den Ansturm von Menschen zu verteidigen, die unvorbereitet von einer Katastrophe getroffen worden sind. »Das Sondereinsatzkommando einer städtischen Polizeieinheit hat uns besucht. Sie haben uns versichert, dass sie beim ersten Anzeichen von Gefahr hier sein werden.« J. C. hofft auch, junge Landwirte in den Methoden der nachhaltigen Landwirtschaft zu schulen und für jeden Standort wenigstens einen Arzt und einen Zahnarzt anzuwerben.
Wir mussten die Schießübung beenden, weil eine junge Springreiterin mit ihrem Training beginnen wollte. Auf dem Rückweg zum Hauptgebäude erklärte mir J. C. die »mehrschichtigen Sicherheitsmaßnahmen«, die er bei der Errichtung von Botschaftsanlagen angewandt hatte: ein Zaun um das gesamte Gelände, »Zutritt verboten«-Schilder, Wachhunde, Überwachungskameras … all diese Abschreckungs29maßnahmen sollten eine gewaltsame Auseinandersetzung verhindern. Sein Blick wanderte nachdenklich über die Zufahrt. »Um ehrlich zu sein, bewaffnete Banden machen mir weniger Sorge als eine Frau mit einem Baby auf dem Arm, die an der Einfahrt steht und um etwas zu essen bittet.« Er seufzte. »Ich möchte nicht in dieses moralische Dilemma geraten.«
Deshalb will J. C. nicht einfach ein paar isolierte, militärisch gesicherte Rückzugsorte für Millionäre schaffen, sondern Prototypen für nachhaltige Farmen entwickeln, die von anderen kopiert werden können, um die regionale Lebensmittelsicherheit in den Vereinigten Staaten wiederherzustellen. Das von den Agrokonzernen bevorzugte System der »Just-in-time«-Lieferung macht einen Großteil des Landes anfällig für kleinere Krisen wie Stromausfälle oder Verkehrsunterbrechungen. Die Zentralisierung der industriellen Landwirtschaft hat dazu geführt, dass die meisten Farmen von denselben langen Lieferketten abhängen wie die Konsumenten in den Städten. »In den meisten Legebatterien können nicht einmal Hühner gezüchtet werden«, erklärte mir J. C., als er mir die Hühnerställe auf seiner Farm zeigte. »Sie müssen die Küken kaufen. Ich habe Hähne.«
J. C. ist kein idealistischer Umweltschützer. Wenn er von Hillary Clinton spricht, bezeichnet er sie als »sie«, und er veröffentlicht im Internet Texte über die Machenschaften des »tiefen Staates« und die kommenden Ölkriege.2 Aber sein Geschäftsmodell beruht auf demselben Gemeinschaftsgeist, den ich den Milliardären nahezubringen versuchte: Um zu verhindern, dass die hungrigen Massen die Tore durchbrechen, sorgt man am besten im Jetzt für Ernährungssicherheit für alle. So erhalten die Investoren von J. C. für 303 Millionen Dollar nicht nur eine Hochsicherheitsanlage, in der sie kommende Pandemien, Sonnenstürme oder Zusammenbrüche der Stromversorgung überstehen können, sondern auch ein potenziell rentables Netz lokaler Farmen, das die Wahrscheinlichkeit einer katastrophalen Entwicklung von vornherein verringern kann. Sein Unternehmen wird alles dafür tun, damit sich möglichst wenig hungrige Kinder am Tor drängen, wenn der Tag kommt, an dem die Anlage abgeriegelt werden muss.
Bisher hat J. C. Cole keine Investoren für seine American Heritage Farms gefunden. Das bedeutet nicht, dass niemand in solche Projekte investiert. Es liegt eher daran, dass in denjenigen Vorhaben, die am meisten Aufmerksamkeit und Geld bekommen, normalerweise keine Komponenten kooperativer Arbeitsweise enthalten sind. Derartige Projekte sind eher für Menschen bestimmt, die im Alleingang das Überleben ihrer Familien sichern wollen. Die meisten Milliardäre, die sich für das Prepping interessieren, wollen nicht mit einer Gemeinschaft von Landwirten zusammenarbeiten oder gar ihr Geld in die Finanzierung eines robusten nationalen Ernährungsprogramms stecken. Das Mindset, das reiche Personen dazu bewegt, einen sicheren Zufluchtsort zu suchen, ist weniger damit beschäftigt, moralische Dilemmata zu vermeiden, sondern schafft sie sich einfach aus den Augen.
Viele von denen, die ernsthaft nach einem sicheren Zufluchtsort suchen, engagieren einfach ein auf das Prepping spezialisiertes Bauunternehmen, um auf ihrem Grundstück einen vorgefertigten Stahlbunker in der Erde zu versenken. Rising S Bunkers aus Texas baut und installiert Bunker und Tornadoschutzräume. Ein zweieinhalb mal 31vier Meter großer Notunterschlupf kostet gerade einmal 40 000 Dollar. Für betuchte Kunden bietet das Unternehmen die Luxusvariante »Aristocrat« mit Schwimmbecken und Bowlingbahn für 9,6 Millionen Dollar an.3 Auf der Website von Rising S finden sich Fotos der billigeren Modelle, die größeren kann man jedoch nur mittels eines virtuellen Rundgangs erkunden, was vermutlich daran liegt, dass nur wenige (oder überhaupt keine) Bunker von derart gewaltigen Ausmaßen gebaut werden. Die Anlagen sind eher spartanisch eingerichtet und haben größere Ähnlichkeit mit umfunktionierten Frachtcontainern als mit den fantastischen Luxusverstecken, die man aus James-Bond-Filmen kennt. Die Kunden des Unternehmens waren ursprünglich Familien, die sich vor Wirbelstürmen schützen wollten; erst später stieg Rising S in das Geschäft mit der andauernden Apokalypse ein. Das Firmenlogo mit drei Kruzifixen deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Tech-Milliardäre mit Science-Fiction-Visionen, sondern vor allem evangelikale Prepper im republikanischen Amerika ansprechen möchte.
Sehr viel sonderbarer sind die Anlagen, in die die Milliardäre – genauer gesagt, aufstrebende Milliardäre – tatsächlich ihr Geld stecken. Ein Unternehmen namens Vivos bietet in aller Welt Luxuswohnungen in umgewandelten unterirdischen Munitionslagern, Raketensilos und anderen befestigten Arealen aus dem Kalten Krieg an.4 Dort finden Einzelpersonen oder Familien Privatsuiten und Gemeinschaftsanlagen mit Pools, Spiel-, Kino- und Speisesälen vor, die an Miniatur-Club-Med-Resorts erinnern. Zufluchtsstätten für Superreiche, etwa das Oppidum in der Tschechischen Republik, nehmen für sich in Anspruch, die Bedürf32nisse von Milliardären zu erfüllen, und achten auf die langfristige psychische Gesundheit der Bewohner. Geboten wird die Imitation natürlichen Sonnenlichts, genauso wie ein Pool mit einem simulierten sonnenbeschienenen Gartenbereich, und ein Weinkeller und weitere Annehmlichkeiten sollen dafür sorgen, dass sich die reichen Kunden wie zu Hause fühlen.5
Bei genauerem Hinsehen ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass die Bewohner eines befestigten Bunkers tatsächlich sicher sein werden vor der Realität der … Realität. Zunächst einmal erweisen sich die geschlossenen Ökosysteme unterirdischer Anlagen als ungemein fragil. In der wirklichen Welt schwächt die Vielfalt der Biome und ihrer Bewohner die Auswirkungen von Katastrophen ab. In der Natur kann eine Krankheit, eine Dürre oder ein Invasor eine Spezies bedrohen, aber das Ökosystem gleicht die zerstörerische Wirkung aus. Ein von der Außenwelt abgeschotteter Garten, in dem die Pflanzen in Hydrokulturen wachsen, ist anfällig für Kontamination. Vertikale Farmen mit Feuchtigkeitssensoren und computergesteuerten Bewässerungssystemen mögen in Geschäftsplänen und auf den Dächern von Start-up-Unternehmen in der Bay Area sehr gut aussehen, und wenn die Erde in einem Gewächskasten nicht genügend Nährstoffe enthält oder die Pflanzen in einem Beet absterben, kann man sie einfach ersetzen. Aber im für die Apokalypse hermetisch versiegelten Gewächshaus ist eine solche Nachbesserung unmöglich.
Schon die bekannten