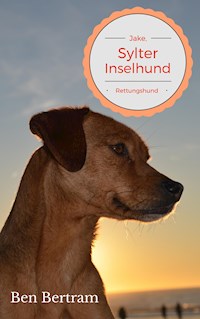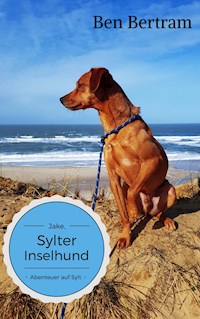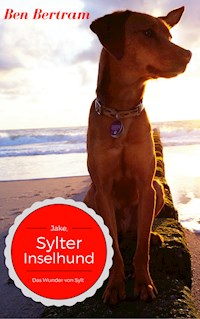3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Durch die vielen Fenster konnte ich Leben erkennen. Ja, meine Pension auf Sylt war zu neuem Leben erwacht und ich war glücklich darüber. Es fühlte sich gut an. Gut? Nein, heimelich und warm, waren die passenderen Worte. Es war beinahe wie früher. Bei der ersten Eröffnung der Pension, hatte ich das Gefühl, die Wolken schmecken zu können. Ich hatte mit meinem besten Freund etwas Großartiges erreicht und mir war klar, dass ich diesen Moment für immer in mir tragen würde. Auch meine damaligen Worte kannte ich noch ganz genau und ich erinnere mich daran, dass ich sie meinem besten Freund ins Ohr geflüstert hatte: „Jetzt wissen wir, wie Wolken schmecken!“ Großartig fühlte es sich auch heute an und so musste ich lächeln, als ich neugierig in Pias Zaubergarten ging und den Schmetterlingen bei ihrem Blumentanz zusah. „Ob es wohl wirklich funktioniert?“ Leise. Nein! Sehr leise, waren meine Worte, während ich mich immer näher an die tanzenden Schönheiten herangetastet. „Das ist doch verrückt. Hey, ich kann tatsächlich euer Lachen hören.“ Stolz darauf einen Neuanfang gewagt zu haben, ließ ich mich ins weiche Gras fallen und richtete meinen Blick hinauf zu Pia. Ich war angekommen, meine Insel und auch die Liebe, hatten mich wieder! Nur wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß wie Wolken schmecken! -Novalis-
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort (Jetzt und hier)
Die letzte Runde
Dieser Ort
Frei - ob ich will oder nicht!
Oma Anna
Didi
Auf gar keinen Fall!
Abgesetzt
Schlechtes Gewissen
Und nun?
Auf geht`s
Neumodischer Krimskrams
Mein Blog
Mein schwerer Weg
Ankunft in der Vergangenheit
Getrocknete Tränen
Deine Hände
Der Türgriff
Frische Erde
Im Kräutergarten
Die Zeit
Der erste Tag im „alten“ Leben
Abschied
Drei sind keiner zu viel!
Kaffeeduft
Fiese Männergrippe
Anruf bei Sandra
Träume
Gelber Liebling
Prost
Lebensabschnitt
Nein
Schmetterling(e)
Traum
Heinzelmännchen
Heinzelweibchen
Der Gedanke
Antwort
Nachbarn?
Nur noch eine Nacht!
Laute Schreie!
Nummernspiel
Nicht gefunden
Unendlich
Sylter Strand
1887
Enttäuschung
(K)ein Vollhonk
Geburtsjahrhundert
Schreiben befreit
Du bleibst!
1987
Der Tanz
Epilog (Jonna)
Sylter Schmetterlingslachen
~ Schmetterlinge lachen auch auf Sylt! ~
Ben Bertram
Alle Rechte vorbehalten!
Nachdruck, Vervielfältigung und Veröffentlichung - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors!
Im Buch vorkommende Personen und die Handlung dieser Geschichten sind frei erfunden und jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist zufällig und nicht beabsichtigt.
Text Copyright © Ben Bertram, 2020
Impressum:
Text:
Ben Bertram
Alsterdorfer Straße 514
22337 Hamburg
E-Mail: [email protected]
Covergestaltung:
Ben Bertram
Motivbild:
© Ben Bertram
Korrektorat / Lektorat:
M. Dress / D. Awiszus
Vorwort (Jetzt und hier)
Viel zu lange war ich nicht hier gewesen!
Ich hatte es einfach nicht übers Herz gebracht, dieses, für mich fast magische Fleckchen Erde, zu besuchen. Dieser Ort war besonders und ich wollte nicht zulassen, diese Magie mit negativen Gedanken und Gefühlen zu belasten.
Immerhin war diese, fast etwas verwunschene Stelle, bereits seit meiner frühesten Kindheit mein Lieblingsplatz.
Mein Platz? Nein, er war der Zufluchtsort von meiner Oma und mir. Hier hatten wir unsere Freude geteilt, haben zusammen gelacht und auch gemeinsam so manche Träne verdrückt. Mit einigen Tränen hatten wir den Boden begossen, während wir mit anderen die Alster gefüllt haben. Selbstverständlich waren auch einige Tränen vor Trauer dabei. Zum Glück jedoch, hatten wir die meisten aus Freude vergossen.
„Erinnerst du dich noch daran, als wir mit meinem kleinen Taschenmesser unsere Anfangsbuchstaben in den Baumstamm geschnitzt haben? Nicht einmal meinen Eltern durftest du von unserem Ort erzählen.“ Ein Schmunzeln lag auf meinen Lippen, während ich in den Himmel blickte und leise zu meiner Oma sprach.
Dann setzte ich mich in Bewegung und ging zu dem Baum, an dem sich unser Kunstwerk befand. Um es zu erreichen, musste ich mich auf die Fußspitzen stellen. Immerhin waren seitdem viele Jahre vergangen. Jahre, die der Baum zum Wachsen genutzt hatte. Aber auch Jahre, die unsere Schnitzkunst überdauert hatte. Sanft, fast zärtlich, strich ich über unsere Initialen, die von einem eingeritzten Herzen umsäumt waren.
„Danke, für alles.“ Wieder waren meine Worte an Oma Anna gerichtet, während mein Blick zu dem großen Findling hinüber wanderte. Deutlich erkannte ich den großen Stein, der wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit im Wasser lag und auf dem ich so häufig gesessen hatte.
Ich lächelte. Allerdings nur kurz, da mir meine Gedankenwelt keine Pause gönnte.
Selbst in meiner schlimmsten Zeit, die zum Glück endlich vorüber war, hatte ich mir in meinem Herzen ein Stückchen Frieden bewahrt. Dieser Ort war in meinen Gedanken mein Zufluchtsort geblieben. Er war es selbst in Momenten, in denen ich mich in den tiefsten Löchern befand. Auch dann, wenn ich glaubte, dass alles in meinem Leben sinnlos war, wenn mir jegliche Lebenskraft fehlte.
Ja, in diesen Augenblicken sah ich mich als kleiner Knirps hier sitzen und Steine in den kleinen Flusslauf werfen. Ich sah Oma Anna und mich Hand in Hand hier spazieren gehen. In der anderen Hand hielt ich eine Tüte mit Brotkrumen, die wir an Enten, Gänse und Schwäne verfütterten.
Manchmal war ich in meinen Gedanken auch ohne meine Oma hier. Ich konnte mich dann auf dem großen Stein dort drüben sitzen sehen. Erkannte, dass ich meine nackten Füße in das kühle Wasser der Alster steckte und sah mich Steine werfen. Wenn ich es schaffte, einige der flachen Steine zum „flitschen“ und springen zu bringen, freute ich mich. Tatsächlich erwischte ich mich in diesen Momenten beim Lachen – oder zumindest beim Grinsen. Ja, ich hatte auch während meiner beschissenen Zeit Momente voller Freude. Es waren nur wenige und sie standen in keinem Verhältnis zu den der negativen Zeit, die mich fast komplett gefangen hielt. Die mich quälte und die nicht bereit war, mich loszulassen.
Allerdings war es auch eine Zeit, in der ich gelernt hatte, dass Mut und Stärke wichtige Dinge im Leben sind. Dass man, wenn man sie mit Freundschaft und Liebe vereint, alles schaffen kann.
Gedankenversunken hatten mich meine Füße längst zum schmalen Flusslauf hinuntergeführt. Ich stand am naturbelassenen Alsterufer und konnte jetzt einfach nicht anders. Ich musste meinen Tränen freien Lauf lassen und erst, als sie langsam etwas weniger wurden, tat ich, was ich tun musste. Ich zog meine Schuhe und Strümpfe aus, stellte sie am Ufer ab und watete durch das flache Wasser der Alster. Ich brauchte nur wenige Schritte, um den Findling zu erreichen. Nachdem ich mich gesetzt hatte und meine Füße im Wasser baumelten, schloss ich die Augen.
Es war dunkel. Falsch! In mir gab es diese Dunkelheit, die ich leider viel zu gut kannte. Trotzdem spürte ich mit geschlossenen Augen die Wärme der Sonne und sah kleine Lichter hinter meinen Lidern tanzen. Ich hatte keine Angst mehr vor der Dunkelheit. Nein, ich hatte gelernt mit ihr umzugehen und mochte sie inzwischen sogar in einigen Augenblicken.
Als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich Schmetterlinge am Alsterufer tanzen. Doch ich sah sie nicht nur tanzen, sondern konnte sie dabei sogar lachen hören.
Auch wenn dieser Augenblick nicht dafür geschaffen war, konnte ich nicht anders, als nach meinem Handy zu greifen. Ich kam nicht umhin und ich wusste auch, was Oma Anna in diesem Moment gesagt hätte.
„Watt mutt, dat mutt.“ Ich lächelte, während ich die Worte leise aussprach.
Ich wählte mich durch das Handymenü und erreichte schnell die App, über die ich meinen Blog bedienen konnte. Nach einem kurzen Blick zur Sonne, die nicht nur schien, sondern die ich auch wieder in meinem Herzen hatte, tippte ich los. Nein, ich tippte nicht einfach, ich flog mit meinen Daumen über die Handytastatur.
Nur mit dir
... kann ich Schmetterlinge lachen hören.
Warum gibt es dieses Phänomen? Oder ist es vielleicht gar keins? Wenn es aber kein Phänomen ist, was ist es denn dann?
Ist es vielleicht die Liebe, die uns von unserem ersten Augenblick an erfasst hat?
Findest du nicht auch, dass die Lösung auf der Hand liegt? Dass sie direkt greifbar für uns ist und wir manchmal nur nicht den Mut haben, nach dieser Antwort zu greifen?
Wenn ich mit dir spazieren gehe. Vielleicht am Meer und mit nackten Füßen im flachen Wasser. Meine Nase halte ich dabei in die Sonne und spüre mein schneller schlagendes Herz.
In diesen Augenblicken kann es mir passieren, dass ich die Schmetterlinge lachen höre. Ich höre sie sogar am Meer, dort wo es eigentlich gar keine Schmetterlinge gibt.
Es kann mir passieren, dass ich in den Himmel hinaufsehe und Wolken erkenne. Nein, keine dunklen und bedrohlichen Wolken. Ich sehe Wolken, die zu diesem wunderschönen sonnigen Tag passen. Helle Wolken, vielleicht Schäfchenwolken. Aber auch Wolken, aus deren Form ich mir das bilde, was ich mir wünsche. Was ich aus ihnen sehen möchte.
Die Wolken am Himmel sind greifbar für mich. Sie sind greifbar, obwohl sie doch unendlich weit von mir entfernt sind.
Warum es so ist?
Weil ich dich -meinen Lieblingsmenschen- neben mir habe. Weil ich mit dir die Schmetterlinge lachen hören kann und weil ich in diesen Momenten auch wieder probieren möchte, wie die Wolken schmecken!
Es gibt Menschen in unserem Leben, mit denen man sich nichts Sehnlicheres wünscht, als gemeinsam die Wolken zu schmecken. Doch was bedeutet dieser Satz eigentlich?
Meine Antwort ist, dass wir in diesem Moment glauben, dass wir alles gemeinsam schaffen können.
Nicht nur schaffen. Auch erschaffen, wünschen und träumen.
Träumen!? Die Träume, die wir in diesem Moment haben, fühlen sich großartig an. Sie sind großartig und wenn der Mensch, mit dem wir in diesem Augenblick am Strand spazieren gehen, ebenso fühlt, kann aus diesem du und ich das große WIR werden.
Wenn man gemeinsam an Dinge glaubt, gemeinsam Träume lebt und gemeinsam an seinen Wünschen arbeitet, können wir alles erreichen.
Es muss kein Strand sein. Das Meer kann ruhig hunderte von Kilometern entfernt sein. Wir benötigen auch kein wunderschönes Tal oder eine besondere Bergspitze. Der romantische See hat zwar seine Reize, aber auch dieses Gewässer ist nicht notwendig.
Wenn es einen Menschen in unserem Leben gibt, mit dem wir Schmetterlinge lachen hören, dann können wir uns an JEDEM Ort befinden. Dann genügt das eigene Sofa, der triste Fußweg vor dem Wohnhaus oder ein Einkaufszentrum. Wenn dieses Gefühl da ist, dann erreicht es uns überall.
Ja, wenn dieses Gefühl da ist, kann man sogar ein Dach über dem Kopf haben während man dabei ist, gemeinsam die Wolken zu schmecken.
Ich hatte das Glück, die Wolken schmecken zu dürfen und werde Pia, Hasi und meiner Oma Anna, immer dankbar dafür sein.
Genau, wie ich inzwischen gelernt habe, dass die Schmetterlinge für uns lachen. Nein, dass sie mit uns zusammen lachen.
Danke dafür, mein kleiner Schmetterling, meine Jonna!
Als ich mit meinem Blogeintrag fertig war, stellte ich ihn direkt online. Ich musste meine geschriebenen Worte nicht nochmals lesen, da sie direkt aus meinem Herzen geflossen waren.
Dann schloss ich die App und ließ mein Handy in die Tasche meines Kapuzenpullis gleiten.
„Manche Wege sind einfach nur Scheiße und einige Zeiten sind so hart, dass man glaubt, an ihnen zu zerbrechen. Zum Glück habe ich nicht aufgegeben.“ Dann schloss ich die App, steckte das Handy in die Tasche meines Kapuzenpullis und ließ meinen Blick vom Wasser zum Ufer schweifen. Ein wunderschöner Schmetterling saß dort auf einer Wildblume und streckte seine Flügel der Sonne entgegen.
„Hey, wer bist denn du? Wie wunderschön und selten du doch bist. Ich habe einen wie dich noch nie gesehen.“ Erneut machte ich eine kurze Pause. Dieses Mal jedoch, da ich vor Glück lächeln musste.
„Dieser wunderschöne Schmetterling ist wie du“, sage ich leise zu mir selbst, während ich verträumt auf dem Findling saß und an unsere erste Begegnung denken musste.
„Wir kennen uns noch gar nicht so wirklich lange und doch habe ich das Gefühl, als hätte es dich schon immer in meinem Leben gegeben. Wahrscheinlich hast du mich bereits seit meiner Kindheit begleitet.
Bestimmt hast du es. Allerdings in Form eines Schmetterlings.“ Ich musste über meine Worte schmunzeln und mir wurde warm um Herz. Dann fiel mein Blick zurück auf das Wasser der Alster und ich konnte mein Spiegelbild deutlich im Flusslauf erkennen.
Erst, als ich meine großen Zehen etwas bewegte, verschwamm meine Silhouette. Genau, wie es meine Gedanken taten und ich aus dem Jetzt dorthin gebracht wurde, wo vor gar nicht langer Zeit mein neues Leben begann.
Die letzte Runde
Sehr früh war ich heute wach geworden, lag allerdings noch eine ganze Weile mit geschlossenen Augen da. Gedanken um den heutigen Tag kreisten durch meinen Kopf. War ich wirklich vorbereitet? Konnte ich diesen Ort, der für einige Wochen zu meinem Zuhause geworden war, wirklich ohne Angst verlassen? War ich tatsächlich in der Lage, im normalen Leben zu bestehen? Ich wusste es noch immer nicht.
Nachdem ich meine Augen geöffnet hatte, konnte ich mein Gepäck im dunklen Zimmer stehen sehen. Es war an der Zeit zu gehen. Ich hatte keine andere Wahl, da der Tag gekommen war, hier meine Zelte abzubrechen. Nein, ich ging nicht freiwillig und doch musste es sein, da es keine Möglichkeit für ein Bleiben gab.
Gepackt hatte ich bereits gestern Abend, und so lagen jetzt noch einige Stunden vor mir, die ich auf irgendeine Art und Weise überbrücken musste.
Da an Schlaf nicht mehr zu denken war und ich keinen Bock mehr hatte Löcher in meine Zimmerdecke zu starren, setzte ich mich auf. Leider half diese aufrechte Position auch nicht, um die gefühlten tausend verschiedenen Gedanken, aus meinem Kopf zu vertreiben. Zu viele Dinge ratterten durch meinen Kopf und so sehr ich mich auch bemühte, ich wurde sie einfach nicht los. Vielleicht wollte ich sie aber auch gar nicht loswerden. Immerhin gehörten diese Gedanken zu mir und eigentlich war es sogar wichtig, dass sich all diese Dinge in meinem Kopf festsetzten. Sie forderten von mir, dass ich sie lösen sollte und ich wusste sogar, dass ich es auch tun musste. Doch selbst nach den letzten sieben Wochen, nach der Zeit hier in dieser teilweise obskuren, nein vielleicht sogar skurrilen Umgebung, war ich nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nein, ich konnte keine Lösungen finden, und alle Fragen blieben somit auch am heutigen Morgen unbeantwortet.
Wie immer, schob ich sie auch jetzt einfach weg. Ich verdrängte sie. Ich tat genau das, was ich am besten konnte und fühlte mich gut dabei. Gut, obwohl ich wusste, dass es falsch war.
Als ich meine Vorhänge aufzog und auf den, im Dunkeln liegenden Wald blickte, hatte ich eine Idee. Ich wollte raus. Hinaus in die Freiheit. Dorthin, wo ich in den letzten Wochen sehr viel Zeit verbracht hatte. Dass wir erst fünf Uhr morgens hatten, war mir egal. Egal? Nein, ich freute mich darüber, da ich so nicht befürchten musste, andere Menschen in den Fluren des riesigen Gebäudes zu begegnen.
Fünf Minuten später war ich zu einem Teil des Waldes geworden und ging die Wege, die ich auch in den letzten Wochen gefühlte tausende Male gelaufen war.
Meistens war ich dabei alleine unterwegs, da ich häufig nicht in der Lage war, die Gesellschaft anderer Menschen zu ertragen. Ich wollte keine Gespräche führen, und meine Ausrede dafür hatte ich mir selbstverständlich auch zurechtgebastelt. Der Wald und die Stille gehörten zusammen und wir Menschen hatten keinesfalls das Recht, den Wald seiner Stille zu berauben.
Doch es gab auch Tage, an denen ich mich besser fühlte und mir nach Gesellschaft war. In diesen Momenten ging ich meine Wege gemeinsam mit Christian oder Tommy.
Allerdings gab es tatsächlich eine Person, mit der ich auch, wenn ich nicht gut drauf war, Spaziergänge unternahm. Mit Charly fühlte ich mich stärker und es tat mir gut, diesen besonderen Menschen an meiner Seite zu haben.
Charly, Tommy und Christian. Alle drei waren auf ihre Art ganz außergewöhnliche Menschen und ich war sehr froh darüber, sie hier kennengelernt zu haben. Ich empfand es als angenehm, dass sie in mein Leben getreten waren und ich fühlte mich in ihrer Gegenwart häufig wohl.
Als ich dreißig Minuten später wieder auf dem Klinikgelände angekommen war, hatte der Frühstücksraum bereits geöffnet. Doch Essen konnte ich jetzt nichts. Ich wari9 viel zu aufgewühlt und hatte auch keine Lust, alleine im Speisesaal zwischen den vielen unbekannten Menschen zu sitzen. Ich war der letzte unserer „Gang“, da Charly, Tommy und Christian die Klinik bereits in den letzten Tagen verlassen hatten.
Trotzdem ging ich in den Saal hinein. Allerdings nur, um ihn wieder eilig, dafür aber mit einem gefüllten Kaffeebecher in der Hand, zu verlassen. Schnurstracks machte mich auf den Weg zur Terrasse, wo sich zu dieser Uhrzeit meistens noch niemand aufhielt. Auch heute war keiner da und so konnte ich, alleine mit mir und meinen Gedanken, den ersten Kaffee des Tages genießen.
Leider musste ich doch noch einmal zurück in den Speisesaal. Ehe ich mich versah, war der Becher schon wieder leer. Ich war wohl so in Gedanken, dass ich das Koffein förmlich inhaliert hatte und brauchte nun dringend Nachschub.
Als ich den Raum betrat blieb ich stehen und sah zunächst grinsend zu dem Tisch, an dem ich oft mit Christian und Tommy gegessen hatte. Ja, wir hatten einige lustige Momente zusammen dazu noch und das große Glück gehabt, nahezu gleichzeitig hier gelandet zu sein.
Mein Blick ging weiter und blieb erst wieder an dem Tisch hängen, an dem ich häufig mit Charly gesessen hatte. Es fiel mir nicht schwer, meine negativen Gedanken beiseite zu schieben, um sie durch viele positive Erinnerungen an Charly und mich zu ersetzen. Wir hatten tolle Gespräche geführt, einmalige Augenblicke erlebt, und gemeinsamen Spaß hatten wir sowieso im Tagesangebot. Leider verstand ich noch immer nicht, was genau der Grund für den Keil war, der irgendwann und wie aus dem Nichts, von Charly zwischen uns platziert wurde. Dieser Keil war ohne Vorwarnung eingeschlagen und hatte dafür gesorgt, dass von einem Moment auf den anderen alles anders zwischen uns war.
Ich hätte Charly dafür hassen können. Entschied mich aber stattdessen dafür, keine negativen Gefühle zuzulassen, da ich unsere schönen Momente behalten wollte. Zumindest in meinem Kopf, mein Herz hätten sie gerne verlassen können, da sie an dieser Stelle unbeschreiblich wehtaten.
Dann spürte ich das, was ich gehofft hatte, nie wieder spüren zu müssen. Das, was mir genommen werden sollte. Ich hatte Angst!
Angst vor allem. Ganz plötzlich und wie so häufig ohne ersichtlichen Grund, war diese scheiß Angst wieder bei mir und hatte Besitz von mir ergriffen.
Würde sie tatsächlich mein ständiger Begleiter bleiben?
War sie mein Feind, der mich beherrschte und gegen den ich tatsächlich nichts unternehmen konnte? War ich die letzten Wochen ohne Erfolg behandelt worden?
Ich fühlte mich hilflos und verließ mit schnellen Schritten und ohne Kaffee, die Kantine.
Dieser Ort
Sieben lange Wochen hatte ich an einem Ort verbracht, der unheimlich und unreal zugleich war. Sieben Wochen, die mir wie eine Ewigkeit erschienen und die trotzdem wie im Fluge vergingen.
Es war eine Zeit, auf die ich in diesem Moment mit gemischten Gefühlen zurückblickte und obwohl ich froh war, diesen Lebensabschnitt endlich hinter mir lassen zu können, hatte ich auch Angst davor, von hier weg zu gehen. Ja, ich hatte Schiss, diesen manchmal wohligen und doch zugleich auch obskuren Ort zu verlassen. Immerhin war er fast zwei Monate lang meine Heimat, zumindest mein vorrübergehendes Zuhause, gewesen.
„Ich habe keine Heimat mehr. Weder hier, noch irgendwo anders!“ Ich sagte diesen Satz zu mir selbst und musste in diesem Moment an den Friedhof der Heimatlosen denken. An diese kleine Begräbnisstätte auf Sylt, der sich fast im Herzen von Westerland befand. Häufig hatte ich ihn besucht und mir die Kreuze angesehen, auf denen sich das Datum befand, an dem die Menschen damals auf Sylt angespült wurden.
Trotz allem wunderte es mich, dass ich ein solch beklemmendes Gefühl in mir trug. Inzwischen befand ich mich vor der großen Tür der Klinik und saß auf meinem Koffer. Auf dem Gepäckstück, in dem irgendwie die letzten sieben Wochen meines Lebens verstaut waren.
Dann musste ich lachen. Ja, ich lachte kurz auf. Immerhin hatte ich in den letzten Wochen einige Personen genau an diesem Platz hier verabschiedet und allen das Selbe mit auf den Weg gegeben. Was ich gesagt hatte? Ich hatte die Worte auch jetzt in meinem Kopf:
Sei froh, dass du hier weg bist. Endlich kannst du wieder atmen wie du möchtest und nicht so, wie es dir vorgegeben wird. Freue dich auf die Freiheit und darüber, dass du hier raus bist.
Tja, anderen Menschen Tipps zu geben war nicht wirklich schwer. Allerdings war es umso schwieriger, seinen, in diesem Fall meinen eigenen Weg zu finden und erst recht auch zu gehen.
Doch apropos gehen. Wie würde es bei mir weitergehen? Was hatte das Leben mit mir vor? Wohin sollte ich geführt werden? Und vor allem, welches war der Weg, der jetzt der Richtige für mich war?
Meine Schuldgefühle, diese beschissenen Ängste und meine negative Einstellung zum Leben waren besser geworden. Hier, an diesem Ort waren sie besser geworden. Allerdings fühlte ich mich hier auch sicher.
Ob ich aber auch im realen Leben mit meinen Ängsten klarkommen würde, wusste ich leider nicht. Blöderweise hatte ich aber auch mega Angst davor, es auszuprobieren.
Während ich diese Gedanken hatte, war sie wieder da. Diese scheiß Angst vor der Zukunft. Vor meiner Zukunft, auf die gerne verzichtet hätte. Ebenso, wie ich auf die Gegenwart verzichten konnte. Verzichten? Nein, ich hätte auf sie scheißen können!
Ich wollte zurück in die Vergangenheit. In meine Vergangenheit. Ich wollte in den Moment zurück, in dem mein Leben noch in Ordnung war. Zurück in die Zeit, als ich ein glückliches und nahezu perfektes, Leben geführt hatte.
Dass es nicht möglich war, hatte ich gelernt. Nein, ich hatte es nicht nur gelernt, sondern in den letzten Wochen auch begriffen und verinnerlicht. Zumindest verhielt es sich meistens so.
Doch jetzt, wo ich hier stand und wieder zurück in das normale Leben starten sollte, hätte ich mein gelerntes Wissen am liebsten sofort verdrängt. Was erwartete mich in der Realität? Konnte ich mich auch in der „freien Wildbahn“ zurechtfinden?
Mächtige Zweifel stiegen in mir auf.
Ich beobachtete mich selbst in der großen Glasscheibe der gewaltigen Eingangsfront. Meine Hose hing etwas, da ich in der Zeit hier viel Sport gemacht hatte. Joggen war zu meiner Leidenschaft geworden. Leider war ich inzwischen an einem Punkt angekommen, der mir nicht guttat. Es war so weit gekommen, dass ich mich selbst verachtete, wenn ich an einem Tag keine Runde gedreht hatte. Genau deshalb brachte ich, trotz meiner 185 Zentimetern, nur 75 Kilogramm auf die Waage.
Meine dunkelblonden, leicht gewellten Haare, waren, genau wie mein Bart, inzwischen viel zu lang geworden. Doch ich mochte es so. Ja, ich mochte es, obwohl die meisten Menschen der Meinung waren, dass es ungepflegt aussah. Irgendwie fühlte sich dieses Aussehen wie eine Maske an. Wie eine Verkleidung, unter der mich niemand erkennen konnte und die etwas mehr mir Sicherheit gab.
Außerdem, was wussten die anderen Menschen schon? Sie kannten weder meine Gedanken, noch den Grund für meine Typveränderung. Allerdings ging es sie auch nichts an. Während ich mir noch vor einigen Wochen immer die Mühe gemacht hatte mich zu erklären, hatte ich dies inzwischen abgelegt. Ich quittierte Fragen und Äußerungen zu meinem Aussehen lediglich mit einem müden Lächeln. Wenn überhaupt!
Noch eine ganze Weile war ich aufgestanden und sah mich in der Glasscheibe an. Nein, ich sah mich nicht einfach nur an! Ich musterte mich förmlich in dieser Fensterfront, die mir einen Freund, und doch zugleich auch eine fremde Person präsentierte.
Wie lange ich es tat? Ich weiß es nicht. Allerdings schaffte ich es irgendwann, meinen Blick von der Scheibe abzuwenden. Nein, ich hatte es nicht alleine geschafft. Ein kleiner Schmetterling hatte mir dabei geholfen. Er flog direkt an meiner Nasenspitze vorbei und meine Augen folgten ihm.
Andere Patienten gingen an mir vorbei und sahen mich an. Ob sie mich bereits die letzten Minuten beobachtet hatten? Woher sollte ich das wissen? Ich war in meiner eigenen Welt verschwunden. War in meiner Gedankenwelt, die zwar einem Nichts glich, in die ich allerdings trotzdem versunken war.
Wahrscheinlich beneidet ihr Trottel mich auch noch darum, dass ich heute abreisen darf! Dass ich dieses Gefängnis verlassen darf. Ihr seid so blöd! Da draußen spielt das Leben. Allerdings genau das Leben, für das wir zu dämlich sind. Da draußen wartet die Zukunft auf uns, die wir nicht in der Lage sind, für uns zu gestalten. Zum wievielten Male ich heute nun schon höhnisch über mich selbst lachte? Ich hatte nicht mitgezählt und egal war es mir obendrein auch noch.
Trotz allem waren die anderen Patienten und ich uns auch auf eine Art ähnlich. Genauso wie sie mich beneideten, verhielt es sich auch andersrum. Ja, ich war neidisch auf die Menschen, die mit ihren Behandlungsplänen in der Hand, auf dem Weg zu ihrer nächsten Anwendung waren.
Sie hatten hier einen geregelten Tagesablauf. Genau diese Routine hatte mir gutgetan und dabei geholfen, dass ich mein Leben wieder einigermaßen hinbekommen hatte. Ja, es tat mir gut. Selbst dann, wenn morgens um sechs Uhr mein Wecker geklingelt hatte und ich zur Kneipanwendung musste. Klar hatte ich mir häufig die Frage nach dem Sinn gestellt. Trotzdem stand ich immer pünktlich in der Schlange und wartete darauf, dass mir mit einem Schlauch die Beine abgespült wurden. Natürlich mit eiskaltem Wasser. Es war so kalt, dass es wehtat und meine Beine auch eine halbe Stunde später noch brannten, während ich im Speisesaal mein Müsli aß und einen Kaffee trank.
Warum ich gerade jetzt daran dachte? Ich hatte keinen Schimmer.
Aber irgendwie wusste ich gerade gar nichts und so wunderte ich mich auch nicht darüber, dass meine Gedanken nun plötzlich bei dem Tag landeten, an dem ich hier vor sieben Wochen aufschlagen durfte.
Ich war erneut in der Vergangenheit. In meiner Vergangenheit, und das, obwohl ich hier stand, um in die Zukunft aufzubrechen.
Gekommen war ich damals mit Burn Out, Depressionen und Ängsten. Ein gemeines Gemisch aus mir bis dato unbekannten Faktoren. Aus Krankheiten, die ich lediglich vom Hörensagen kannte und von denen ich, bis zu dem Tag, als ich von meinem Arzt die Diagnose erhalten hatte, auch nichts wusste.
Ich hatte mich in den Monaten zuvor allerdings häufig über mich selbst gewundert. Darüber, was aus mir geworden war und wie hilflos ich durch die Weltgeschichte lief. Ich bekam nichts mehr hin, fühlte mich ständig überfordert und hatte vor mir selbst, und vor allem anderen auch, Angst.
Ob es daran lag, dass sich mein Leben so extrem gewandelt hatte oder ob mein Leben sich durch die Krankheit verändert hatte? Auch heute konnte ich mir diese verkackte Frage nicht beantworten.
Aber ich hatte mir vorgenommen, an mir zu arbeiten. Ich wollte versuchen, die Tipps der Ärzte und Psychologen umzusetzen.
Auch wenn ich einige nicht wirklich für umsetzbar hielt!
Wie ich es am besten anstellen sollte? Was ich machen musste? Leider hatte ich keine Ahnung. Aber ich nahm mir vor zu kämpfen und es herauszufinden. Doch ob ich den Kampf gegen mich selbst gewinnen würde, ob ich eine reelle Chance hatte?
Logischerweise kannte ich auch diese Antwort nicht. Allerdings hatte ich damals bei meiner Ankunft in der Klinik die Hoffnung darauf, genau diese Antwort zu finden.
Frei - ob ich will oder nicht!
Als direkt neben mir ein Auto zum Stehen kam, zuckte ich kurz zusammen. Klar hatte ich es bemerkt, richtig wahrgenommen allerdings nicht, da ich mit viel zu vielen anderen Dingen beschäftigt war. Zum Beispiel mit der großen Glasscheibe am Eingangsbereich, die mir noch immer den mir bekannten Fremdling präsentierte.
Erst in dem Moment als ich eine Umarmung spürte, war ich in der Lage, mich aus meiner Gedankenwelt zu befreien und mich von meinem Spiegelbild zu lösen. Von dem Spiegelbild, das ebenfalls umarmt wurde und bei dem ich eine leichte Abwehrbewegung erkannt hatte.
Ich drehte mich in die Richtung, von der aus die Umarmung gestartet wurde. Zögerlich tat ich es, fast wie in Zeitlupe war meine Reaktion und es dauerte etwas, bis ich meinen Freund erkannte. Didi war es, der jetzt neben mir stand und mich zur Begrüßung in den Arm genommen hatte.
Stumm hielten wir uns fest und erst, als ein anderer Autofahrer auf die Hupe drückte, da Didi mit seinem Fahrzeug die Zufahrt versperrte, lösten wir uns wieder von einander.
Schnell landete mein Gepäck im Kofferraum und nachdem ich, über meine Schulter hinweg einen letzten Blick zur Klinik geworfen hatte, stieg auch ich ein. Meine Gefühle zu beschreiben war nicht möglich. Einerseits, da mir keineswegs nach Reden war, andererseits jedoch auch, da ich nicht Herr über mein Gefühlchaos war.
Der schnurrende Motor untermalte meine Abschiedsbilder. Über den Spiegel auf der Beifahrerseite nahm ich Abschied von dem Ort, der sieben Wochen lang mein Zuhause gewesen war. Die Klinik, die mir über einen langen Zeitraum hinweg Sicherheit gegeben hatte, wurde mit jedem gefahrenen Meter kleiner. Irgendwann verschwamm sie im Spiegelbild mit der Landschaft, bevor sie direkt im Anschluss komplett verschwand.
Sie war fort. Jedoch nur aus meinen Augen verschwunden, da sie in meinem Kopf präsenter war denn je.
Schweigend saßen mein Freund Didi und ich nebeneinander und obwohl ich merkte, dass Didi einige Fragen auf der Seele brannten, blieb er stumm. Wir fuhren durch die vielen kleinen Orte, die sich um die Klinik herum befanden, während ich versuchte, mich von meinem Leben der letzten sieben Wochen zu verabschieden.
Als wir uns bereits einige Zeit auf der Autobahn nach Hamburg befanden merkte ich, dass sich meine innere Spannung etwas löste und mir rutschten tatsächlich einige Worte über die Lippen.
„Danke fürs Abholen. Echt nett von dir.“ Mein Blick war nicht auf meinen Freund, sondern weiterhin aus dem Fenster gerichtet.
„Das ist doch wohl klar, Ben. Das mache ich doch gerne.“ Anschließend schwiegen wir wieder.
Der Weg nach Hamburg war nicht lang und schon einige Kilometer vor meiner ehemaligen Heimatstadt bemerkte ich, wie eine Beklemmung in mir aufstieg. Ich fühlte mich nicht wohl, bekam Angst und wäre am liebsten einfach wieder umgedreht. Tatsächlich war es mein Wunsch, mich von Didi wieder zurück in die Klinik bringen zu lassen.
Dort war ich sicher, da kannte ich mich aus und das Angenehme war außerdem, dass in der Klinik niemand Wunderdinge von mir erwartete.
„Du kannst bei mir wohnen.“ Wie aus dem Nichts drangen Didis Worte in meinen Gehörgang.
„Danke.“ Mehr sagte ich nicht, da ich mir über meine Zukunft bisher keine großen Gedanken gemacht hatte.
„Oder willst Du wieder bei deinen Eltern einziehen?“ Didi sah mich fragend an.
„Ich glaube nicht, dass es gut für mich wäre.“ Dort hatte ich die Zeit vor meinem Klinikaufenthalt gelebt. Ich war bei ihnen eingezogen, nachdem ich damals fluchtartig Sylt verlassen hatte. Nein, verlassen musste, da ich auf dieser Insel nichts mehr verloren hatte. Mich nichts mehr mit ihr verband und ich sie niemals wieder betreten wollte.
„Das habe ich mir auch gedacht. Deine Klamotten habe ich schon zu mir rüber geholt. Ich hoffe, es ist okay für dich.“
„Ja, alles gut!“ Didi war ein toller Freund und ich ärgerte mich darüber, dass ich nicht in der Lage war, mehr Gefühle zu zeigen und nettere Worte zu finden.
Durch die Tiefgarage gingen wir in Didis Reich. Nachdem wir uns einen Kaffee gekocht hatten, setzten wir uns auf den Balkon und schwiegen. Allerdings nicht lange, da ich mich mit den Worten,
„Sei nicht böse, aber ich muss kurz zu meinen Eltern und anschließend noch zu Oma Anna gehen“, verabschiedete.
„Warte kurz.“ Didi rief mir nach.
Erst als ich bereits an der Wohnungstür stand blieb ich stehen und drehte ich mich um. Ich fand mein Verhalten selber dämlich, aber ich hatte etwas zu erledigen und musste daher jetzt los.
„Hier, den wirst du vielleicht brauchen.“ Anstatt eines strafenden Blickes bekam ich einen Wohnungsschlüssel in die Hand gedrückt.
„Danke.“ Nachdem ich den Schlüssel in meine Hosentasche gleiten ließ, nahm ich Didi kurz in die Arme. Anschließend machte ich mich wortlos auf den Weg zu meinen Eltern.
Da sie höchstens dreihundert Meter von Didi entfernt wohnten, hatte ich mein erstes Ziel schnell erreicht.
Leider verließ ich es auch ebenso schnell wieder. Ich hielt es dort einfach nicht aus, mochte nichts erzählen, und meine Eltern sagten ebenfalls nur wenig bis nichts. Da ich mit meinen Eltern nicht schweigen konnte und ein beklemmendes Gefühl in mir aufstieg, dass sich mitten in meiner Brust festsetzte, hatte es keinen Sinn länger zu bleiben.
Ich war ihnen zwar unendlich Dankbar dafür, dass sie mich vor meinem Klinikaufenthalt fast ein halbes Jahr bei sich aufgenommen hatten. Als ich mit meinem Leben nicht mehr klargekommen war, tat es gut einen Unterschlupf zu finden. Doch ich hatte damals schnell bemerkt, dass es in meinem Alter keinen Nährwert hatte, in einem zwölf Quadratmeter großen Zimmer bei seinen Eltern zu leben. Ich liebe sie zwar sehr, konnte allerdings über schwierige Themen nur schlecht mit ihnen reden. Sie waren leider keine große Hilfe, und so hatte ich bereits damals häufig bei Didi übernachtet.
Damals! Immer wieder holte mich dieses Wort ein. Ich hasste dieses Damals inzwischen und doch hatte ich keine Wahl, ich musste mit diesem Damals klarkommen, musste mit ihm leben. Ein Leben lang würde es mich begleiten. Leider!
Ich hatte damals keine andere Wahl. Ich musste Sylt verlassen. Sylt und das Anwesen, auf dem ich viele Jahre so glücklich gewesen war und in das ich mein gesamtes Herzblut investiert hatte. Meine Pension, die ich so sehr geliebt hatte und die zu meinem Ort geworden war. Nein, nicht nur zu meinem Ort, sondern zu meiner Heimat.
„Schwachsinn! Zu unserer Heimat!“ Laut rief ich diese Worte und es war mir egal, ob es jemand mitbekam.
Die Pension und das dazugehörige Anwesen waren alles für mich gewesen. Trotzdem war dieser Ort zu einem Platz geworden, an dem ich nicht länger bleiben konnte, da einfach zu viele Erinnerungen an ihm und an dieser Zeit, hingen. An einer Zeit, die nie wieder zu mir zurückkehren würde.
Nicht, weil ich es nicht wollte. Es ging einfach nicht. Es war zu viel geschehen, was nicht hätte passieren dürfen. Und was nicht möglich war, wieder rückgängig zu machen.
Leider hatte ich es auch nicht hinbekommen, in den letzten Monaten Oma Anna zu besuchen. Zunächst war ich nicht in der Lage, dann kam meine ätzende Krankheit und zuletzt musste ich in meinem „Gefängnis“ weilen. Doch heute galt es, diesen Umstand zu ändern.
Immerhin hatte ich es Oma Anna zu verdanken, dass ich die schönste Zeit meines Lebens auf Sylt verbringen durfte. Sie hatte mir mit ihrem Testament die Möglichkeit gegeben, ein Anwesen auf Sylt zu besitzen. Ein altes Anwesen, das ich mit meinem besten Freund Hasi zu einer Pension umgebaut hatte, und das mit der Hilfe von vielen weiteren Freunden zu einem traumhaften Fleckchen Erde geworden war. Zu einer Wohlfühloase, auf der ich mit meiner großen Liebe leben durfte.
Doch dann war ich plötzlich allein. Alles war anders und ich hielt es dort nicht länger aus. Das Leben konnte schon gemein sein. Das Gemeinste allerdings war, dass ich keine Antworten auf das Warum bekam.
Ohne zu wissen, weshalb etwas passierte und ohne Antworten auf ungeklärte Fragen zu bekommen, konnte man ganz schnell an diesem ungerechten Leben zerbrechen – so wie ich!
Nachdem mir bewusst war, dass alles keinen Sinn mehr hatte, packte ich meine Sachen. Ich verließ mein geliebtes Sylt, meine Wohlfühloase, die für mich längst keine Oase mehr war und ging zurück nach Hamburg.
Ich verließ meinen Traum, der unser Traum gewesen war, und den ich nicht alleine weiter träumen wollte. Mein Abschied galt nicht einfach nur der Insel. Man konnte sagen, dass ich mich gleichzeitig auch aus meinem eigenen Leben verabschiedet hatte.
Ich wusste nur zu gut, dass es eine feige Flucht war. Leider hatte ich keine Alternative zu ihr gefunden. Außerdem schien mein Entschluss damals eine vernünftige Entscheidung zu sein.
Nein, es fühlte sich nicht gut an. Jedoch allemal besser, als dort zu bleiben und an meiner Trauer und Einsamkeit zu zerbrechen.
Oma Anna
Als ich nach einem schönen Fußmarsch zunächst den Ohlsdorfer Friedhof erreicht und anschließend am Grabstein von Oma Anna angekommen war, konnte ich diesen kaum wiedererkennen. Nein, ich konnte ihn sogar tatsächlich kaum erkennen, da er vollkommen zugewachsen und alles um ihn herum verwildert war. Allem Anschein nach war ich der einzige Mensch, der hier zu Besuch kam, oder zumindest die einzige Person, die ein Interesse daran hatte, das Grab zu pflegen.
Warum waren die Menschen so? Oma Anna hatte, als sie noch am Leben war, für jeden ein offenes Ohr gehabt. Sie war für alle da gewesen und hatte geholfen, wo sie nur konnte. Ständig hatte sie Besuch von Freunden gehabt, die ihren Rat gebraucht hatten. Die auf die Empfehlungen und Tipps meiner Oma gehört hatten und so ein ruhigeres Leben führen konnten.
„Freunde? Pah, solche Menschen sind keine Freunde. Ist das hier die Belohnung dafür? Warum ist es in der heutigen Gesellschaft nur so, dass dieser alte Satz - Aus den Augen, aus dem Sinn! - eine immer größere Bedeutung einnimmt?“ Wütend sprach ich meine Gedanken aus und ließ meinen Blick dabei über das verwilderte Grab gleiten.
Da sich einige Gewohnheiten der Menschen niemals änderten, suchte ich hinter anderen Grabsteinen nach einer Rasenschere, einer Harke und natürlich auch nach einer Gießkanne. Viele Friedhofsbesucher lagerten diese Utensilien hinter den Grabsteinen, da sie so nicht ständig alle Gerätschaften hin und her schleppen mussten.
Schnell wurde ich fündig und richtet das Grab wieder her. Während ich fleißig am Werkeln war, erzählte ich Oma Anna dabei von meinem Aufenthalt in der Klinik.
Fast gleichzeitig war ich mit meiner Erzählung und dem Herrichten fertig und machte mich auf den Weg zu einer der vielen Wasserstellen, um die Gießkanne zu befüllen. Mit eben dieser und einem Kopf, der ebenso voll mit Gedanken war, stand ich nun wieder vor dem Grabstein und überlegte, wie ich meiner Oma die Sache mit dem Anwesen am besten erklären konnte.
Ja, ich hatte Angst davor meiner Oma zu erzählen, dass ich meinen Traum aufgegeben hatte. Hingeworfen war wahrscheinlich das bessere Wort dafür und ich spürte deutlich, wie ich zu zittern begann.
Während ich die Pflanzen goss, kamen auch die ersten Worte über meine Lippen.
Oma Anna erfuhr jetzt die Geschichte, die mich völlig aus der Bahn geworfen hatte.
Unsere Pension lief richtig gut und ich war glücklich darüber, zusammen mit meinem besten Freund Hasi auf Sylt zu leben. Wir lebten im wahrsten Sinne unseren Traum, und als dann auch noch meine große Liebe Pia in mein Leben trat, konnte es gar nicht besser sein. Ja, ich war glücklich. Richtig glücklich sogar und wahnsinnig stolz darauf, mein Leben mit meinem besten Freund und meiner Traumfrau auf Sylt führen zu dürfen.
Wir hatten noch unendlich viele Pläne und genossen trotzdem ein Leben im Jetzt, wie man es sich schöner nicht hätte wünschen können. Wir hatten Freude an jedem gemeinsamen Augenblick und starteten jeden unserer Tage mit einem Lächeln auf den Lippen.
Lachen ist etwas Tolles. Wenn man aber zusammen mit seinen Liebsten lachen darf, ist dies ein Gefühl, das durch nichts zu überbieten ist.
Doch dann kam dieser Tag. Ein Tag, den ich in jeder verfluchten Minute meines Lebens gerne rückgängig machen würde. Es war ein Tag, der einfach nicht hätte kommen dürfen und für den ich mein Leben opfern würde, um ihn anders ablaufen zu lassen.
Es mussten in Hamburg einige Dinge geklärt werden, die unsere Pension betrafen. Da ich an diesem Tag für die anreisenden Gäste verantwortlich war, fuhren Hasi, seine Freundin Johanna und Pia nach Hamburg. Sie hatten sich gleich am frühen Morgen auf den Weg gemacht, damit sie noch am selben Tag wieder zurück auf der Insel sein konnten.
Auf eine Bahnfahrt hatte keiner von ihnen Lust, da sie dann auch in Hamburg die Öffentlichen Verkehrsmittel hätten nutzen müssen.
Mit meinem Jeep waren sie on Tour gewesen und als ich, wie bei einem Telefonat am frühen Nachmittag besprochen, um 18 Uhr im Restaurant Diavolo saß und bei einem Kaffee auf sie wartete, war nichts von ihnen zu sehen.
Auf meine WhatsApp mit der Frage, ob sie den angepeilten Autozug verpasst hätten, bekam ich keine Antwort und auch meine Anrufe landeten zunächst im Nichts, bevor einige Minuten später, plötzlich die Telefone meiner Freunde gar nicht mehr zu erreichen waren.
Zunächst amüsierte ich mich noch darüber, da ich davon ausging, dass die drei Helden bestimmt mal wieder vergessen hatten ihre Akkus vor der Fahrt komplett aufzuladen. Ja, ich war mir sicher, dass ihre Handys einfach leer und ausgelutscht waren.
Fast zwei Stunden wartete ich, dann machte ich mich auf den Weg zur Pension. Eventuell hatten die Chaoten unsere Abmachung einfach vergessen und saßen bereits auf der Terrasse im Strandkorb und gönnten sich ein wohlverdientes Feierabendbier.
Doch niemand war da.
Längst hatte sich ein mächtiger Kloß in meinem Hals breitgemacht. Während sich meine Kehle immer mehr zuschnürte, wurde mein Kopf immer leerer. Zum Denken war ich nicht mehr in Lage. Alles was ich spürte und fühlte, waren Schauer, die sich wie Flutwellen über meinen Körper legten.
Zum bestimmt zweihundertsten Mal wählte ich die Handynummern meiner Freunde. Doch die Leitungen waren tot. Langsam und doch stetig, kroch Angst durch meinen Körper. Angst, die sich inzwischen auch in meinem Kopf festgesetzt hatte.
Unruhig tigerte ich durch die Zimmer.