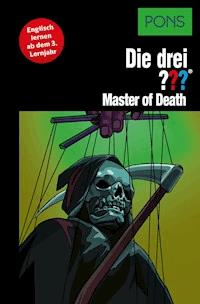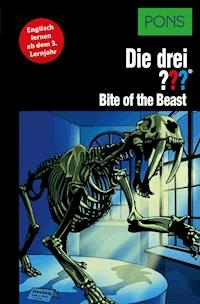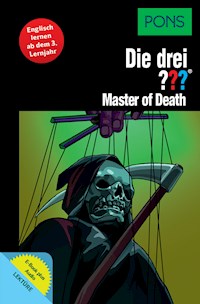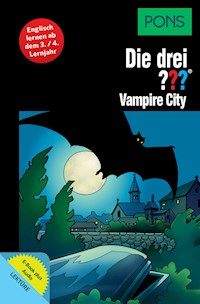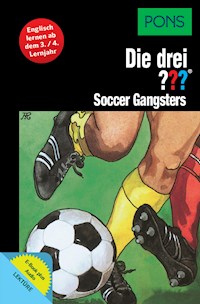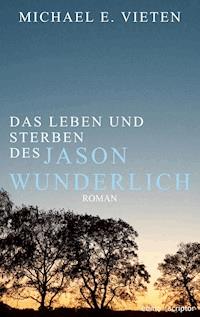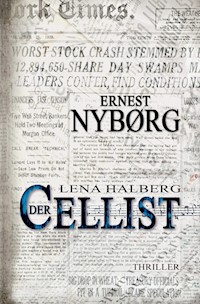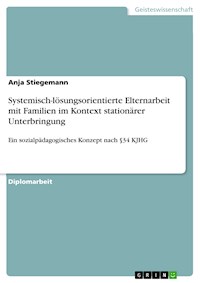
Systemisch-lösungsorientierte Elternarbeit mit Familien im Kontext stationärer Unterbringung E-Book
Anja Stiegemann
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Note: 1,3, Fachhochschule Potsdam (FB Sozialpädagogik), Sprache: Deutsch, Abstract: - Durch die Vielzahl der Einrichtungen und Unterschiedlichkeit der Formen heutiger Heimerziehung gibt es keine einheitlichen Standards und Qualitätskriterien für Elternarbeit; - Elternarbeit scheitert an herkömmlichen Sichtweisen und Erklärungsmodellen; - Es gibt einen Widerspruch zwischen dem fachlichen Anspruch an Elternarbeit und der tatsächlich geleisteten Arbeit der freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe; - Es herrscht ein Mangel an einheitlichen Definitionen und Konzeptionen. Die Begriffe ‘Konzept’ und ‘Konzeption’ werden in der sozialpädagogischen Praxis oft synonym und austauschbar benutzt. Für mich bedeutet die Entwicklung einer sozialpädagogischen Konzeption den Weg, von einem Ist- Stand zu einem Soll- Ziel zu beschreiten. Ausgangspunkt ist die momentane Situation, wobei das Augenmerk auf die Dinge gerichtet ist, die sich in der Auswertung und Interpretation der Bestandsaufnahme als Probleme, Konflikte und Änderungswünsche herausstellen. Gemäß dieser Annahmen ist die Arbeit in zwei Hauptteile untergliedert. Im ersten Teil meiner Arbeit überprüfe ich die genannten Vermutungen, skizziere ein Bild über den aktuellen Stand von Elternarbeit im Heim und entwickle Anforderungen und Begründungen für die konzeptionelle Umsetzung der Elternarbeit. Es geht mir darum, eine Definition für Elternarbeit zu entwickeln, die als Grundlage für eine Konzeption dient und den Erfordernissen heutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse entspricht. Im zweiten Teil folgt als logischer Schluß eine Konzeption für eine mögliche Form von Elternarbeit im Kontext stationärer Unterbringung. Das Thema wurde durch folgende Methoden bearbeitet: Literaturrecherche, Expertengespräche, Prozessbeobachtung, Auswertung pädagogischer Tagebücher und Gesprächsnotizen und die Reflexion meiner aktiven Helferrolle im Arbeitsprozess durch Supervision. Ich weise darauf hin, dass ich die im Titel der Arbeit gebrauchten Termini - ‘Elternarbeit’ und ‘Arbeit mit Familien’ - synonym verwende. Die Begriffsklärung erfolgt ausführlicher im Punkt 2.1.1.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
1. STATIONÄRE UNTERBRINGUNG
1.1 DEFINITION
1.2 RECHTLICHE GRUNDLAGE
1.3 KONTEXT
1.3.1 Individuumsbezogene Sichtweise
1.3.2 Systemische Sichtweise
1.3.3 Lösungsorientierte Sichtweise
2. ELTERNARBEIT IM HEIM
2.1 THEORETISCHE ANFORDERUNGEN AN ELTERNARBEIT
2.1.1 Begriffsklärung
2.1.2 Historischer Anspruch
2.2 ELTERNARBEIT IN DER PRAXIS
2.2.1 Aktueller Stellenwert
2.2.2 Rahmenbedingungen
2.2.3 Modelle
2.2.4 Praktische Formen
2.2.5 Rolle der Mitarbeiter
3. SYSTEMISCH- LÖSUNGSORIENTIERTE ELTERNARBEIT
3.1 THEORETISCHE GRUNDANNAHMEN
3.1.1 Symptome und Probleme
3.1.2 Rollen
3.1.3 Loyalitätsbindungen
3.1.4 Übertragungskonflikte
3.2 DAS AUFNAHMEVERFAHREN
3.2.1 Bedeutung, Funktion
3.2.2 Aspekte der Beziehungsproblematik
4. KONZEPTION
Für die systemisch- lösungsorientierte Arbeit mit Familien im Kontext stationärer Unterbringung nach §34 SGB VIII (KJHG)
4.1 ALLGEMEINE BEMERKUNGEN
4.2 NOTWENDIGKEIT SYSTEMISCH-LÖSUNGSORIENTIERTER ELTERNARBEIT
4.3 GRUNDHALTUNGEN, RAHMEN
4.4 ZIELGRUPPEN, ZIELE DER ARBEIT
4.4.1 Eltern
4.4.2 Kinder
4.4.3 Andere Helfer
4.5 FORMEN DER SYSTEMISCH- LÖSUNGSORIENTIERTEN ARBEIT
4.5.1 Elternbeziehungsarbeit
4.5.2 Arbeit mit dem Kind
4.5.3 Arbeit mit der Heimgruppe
4.5.4 Kooperation und Vernetzung
4.6 RAHMENBEDINGUNGEN
4.6.1 Lage und Ausstattung der Einrichtung
4.6.2 Gruppengröße
4.6.3 Personal
4.6.3.1 QUALIFIKATION UND AUFGABENBEREICHE DER PÄDAGOGISCHEN MITARBEITER
4.6.3.2 QUALIFIKATION UND AUFGABENBEREICHE DER THERAPEUTISCHEN FACHKRAFT
4.6.3.3 DIENSTPLÄNE UND ARBEITSZEIT
4.6.3.4 TEAMARBEIT
4.6.4 Finanzierung
4.7 PHASEN DER UNTERBRINGUNG
4.7.1 Das Aufnahmeverfahren
4.7.1.2.1 Erstkontakt und Beziehungsklärung
4.7.1.2.2 Problem- und Zieldefinition
4.7.1.2.3 Auftragsklärung, Kooperation mit anderen Helfern
4.7.1.2.5 Die Aufnahme als Ritual
4.7.2 Die Aufenthaltsphase
4.7.2.1 ALLGEMEINES, ZIELE
4.7.2.2 INHALTE UND METHODEN
4.7.2.2.1 Elternarbeit
4.7.2.2.2 Arbeit mit dem Kind im , pädagogischen Alltag
4.7.2.2.3 Gruppenarbeit im Heim
4.7.2.2.4 Kooperation mit anderen Helfern
4.7.3 Reintegrationsphase
4.7.3.1 ALLGEMEINES, ZIELE
4.7.3.2 INHALTE UND METHODEN
4.7.4 Abschluß/ Entlassung
4.7.4.1 ALLGEMEINES, ZIELE
4.7.4.2 INHALTE UND METHODEN
4.7.5 Nachbetreuung
4.7.5.1 ALLGEMEINES, ZIELE
4.7.5.2 INHALTE UND METHODEN
5. FAZIT
Anhang
FALLDARSTELLUNGSRASTER
Literaturverzeichnis
EINLEITUNG
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich - auf einen kurzen Nenner gebracht - mit Elternarbeit im Heim.
Die Motivation, dieses Thema zu wählen, entstand aus meiner Tätigkeit als Erzieherin in einer Wohngruppe (nach §34 KJHG). Zunächst beschäftigte ich mich sehr pragmatisch mit dem Thema Elternarbeit. Um die Situation der von mir betreuten Kinder und Jugendlichen besser zu verstehen, war es für mich wichtig, auch die Lebensumstände der Herkunftsfamilien zu kennen.
In einem Zertifikatskurs beim SPFW in Brandenburg erhielt ich unter Leitung von Frau Dr. Marie- Luise Conen einen ersten Einblick in die „Systemische Arbeit mit Familien“ und die Anregung zu einer anderen, komplexeren Sichtweise auf Herkunftsfamilien von Heimkindern.
Das Erkennen von familiären Zusammenhängen im Kontext der Systemtheorie war für mich von entscheidender Bedeutung im Verstehen und Deuten von Problemen und des Verhaltens des Klientel und zunächst ungewöhnlich in der Sichtweise.
In der Vergangenheit erfuhr ich durch meine praktische Tätigkeit und durch das Studium von Literatur, dass die Auffassungen über die Ausgestaltung der Arbeit mit Herkunftsfamilien unter den Mitarbeitern, bei den Angestellten freier Träger insgesamt und unter den zuständigen Jugendämtern und anderen Arbeitspartnern sehr geteilt sind. Dem konzeptionell beschriebenen Anspruch - Elternarbeit zu leisten - wird unterschiedlich entsprochen. Ich habe in meiner Arbeit erfahren, dass Eltern- und Familienarbeit oft sehr stiefmütterlich behandelt und nicht ernst genommen wird. Meine Vermutungen über Ursachen dieses Umstandes möchte ich in dieser Arbeit überprüfen.
Hypothesen sind:
■ Elternarbeit wird von Mitarbeitern als störend, belastend empfunden und von freien Trägern als nicht finanzierbar;
■ Mitarbeiter sind unzureichend qualifiziert, um Elternarbeit durchzuführen;
■ Durch die Vielzahl der Einrichtungen und Unterschiedlichkeit der Formen heutiger Heimerziehung gibt es keine einheitlichen Standards und Qualitätskriterien für Elternarbeit;
■ Elternarbeit scheitert an herkömmlichen Sichtweisen und Erklärungsmodellen;
■ Es gibt einen Widerspruch zwischen dem fachlichen Anspruch an Elternarbeit und der tatsächlich geleisteten Arbeit der freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe;
■ Es herrscht ein Mangel an einheitlichen Definitionen und Konzeptionen.
Die Begriffe ‘Konzept' und ‘Konzeption' werden in der sozialpädagogischen Praxis oft synonym und austauschbar benutzt. 1 Für mich bedeutet die Entwicklung einer sozialpädagogischen Konzeption den Weg, von einem Ist- Stand zu einem Soll- Ziel zu beschreiten. Ausgangspunkt ist die momentane Situation, wobei das Augenmerk auf die Dinge gerichtet ist, die sich in der Auswertung und Interpretation der Bestandsaufnahme als Probleme, Konflikte und Änderungswünsche herausstellen.
Gemäß dieser Annahmen ist die Arbeit in zwei Hauptteile untergliedert. Im ersten Teil meiner Arbeit überprüfe ich die genannten Vermutungen, skizziere ein Bild über den aktuellen Stand von Elternarbeit im Heim und entwickle Anforderungen und Begründungen für die konzeptionelle Umsetzung der Elternarbeit. Es geht mir darum, eine Definition für Elternarbeit zu entwickeln, die als Grundlage für eine Konzeption dient und den Erfordernissen heutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse entspricht.
Im zweiten Teil folgt als logischer Schluß eine Konzeption für eine mögliche Form von Elternarbeit im Kontext stationärer Unterbringung.
Das Thema wurde durch folgende Methoden bearbeitet: Literaturrecherche, Expertengespräche, Prozessbeobachtung, Auswertung pädagogischer Tagebücher und Gesprächsnotizen und die Reflexion meiner aktiven Helferrolle im Arbeitsprozess durch Supervision.
Ich weise darauf hin, dass ich die im Titel der Arbeit gebrauchten Termini - ‘Elternarbeit' und ‘Arbeit mit Familien' - synonym verwende. Die Begriffsklärung erfolgt ausführlicher im Punkt 2.1.1.
Die in dieser Arbeit verwendeten männlichen und weiblichen Bezeichnungen von abstrakten Personen bzw. Personengruppen schließen jeweils die andere Geschlechtsform mit ein.
1. STATIONÄRE UNTERBRINGUNG
Der Begriff stationäre Unterbringung wird in der Kinder- und Jugendhilfe vielfältig verwendet. Ich nehme in diesem Abschnitt eine Begriffsklärung vor und stelle den Begriff in einen Rahmen (Kontext), der als Grundlage meiner Arbeit dient. Alle Aussagen sind im Zusammenhang mit dem Thema Arbeit mit Familien/ Elternarbeit im Kontext stationärer Unterbringung zu interpretieren. Die Beschreibung des Kontextes stationärer Unterbringung dient der Hinführung zum Thema und wird in den darauffolgenden Punkten vertieft.
1.1 DEFINITION
(Un)- Heimliches Heim?!2
Im Titel meiner Arbeit wähle ich den Terminus „Stationäre Unterbringung“, um Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen nach § 34 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) zu beschreiben.
Unter Formen stationärer Unterbringung werden Hilfen verstanden, bei denen Kinder und Jugendliche entweder nur vorübergehend oder langfristig untergebracht werden.[5] Der Terminus stationäre Unterbringung wird auch für andere Unterbringungsformen außer Heimerziehung, wie Pflegestellen, Pflegefamilien oder Adoptionen verwendet. Sicher wird im Verlauf meiner Arbeit deutlich, dass bestimmte Aussagen über den Umgang und die Zusammenarbeit mit Eltern auch für diese Bereiche zutreffend oder überdenkenswert sind. Dennoch grenze ich mich von diesen genannten Formen der stationären Unterbringung ab.
Im §34 KJHG „Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen“ unterscheidet der Gesetzgeber die sogenannten sonstigen betreuten Wohnformen von der Heimerziehung, versieht sie aber in der Folge mit gleichen Aufgabenstellungen und Zielen. Es entsteht der Eindruck, dass der Begriff Heimerziehung eher vermieden wird. Das kann auf die Stigmatisierung durch den Begriff in der Vergangenheit zurückzuführen, aber auch Antwort auf die vielen, alternativen Wohnformen (innewohnende Gruppen, Kleinsteinrichtungen in familienähnlicher Zusammensetzung, Außenwohngruppen, betreutes Einzelwohnen...) sein, die sich im Zuge der Heimreform gebildet haben und kaum noch als Heim bezeichnet werden können.3 [6]
Der Begriff „Heimerziehung“ wird in seiner ursprünglichen Bedeutung als eine Form der institutionellen Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen verwendet. In der aktuellen Diskussion wird Heimerziehung „stärker als ein Konzept der Betreuung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen [...] verstanden, das nach Dauer, Intensität, Organisation und Struktur sehr differenziert ist.“ [7]
Die zu entstehende Konzeption in meiner Diplomarbeit wird sich an den Rahmenbedingungen der Heimgruppe[8] orientieren. Wenn allgemein von Unterbringung nach §34 KJHG die Rede ist, werde ich die Begriffe ‘Stationäre Unterbringung' und ‘Heim' synonym verwenden, weil sie im Sprachgebrauch der Kinder- und Jugendhilfe üblich sind, wenn von Heimerziehung und sonstigen Betreuten Wohnformen die Rede ist.
1.2 RECHTLICHE GRUNDLAGE
KJHG verankert grundsätzlich Elternrecht
Die Geschichte der gesetzlich geregelten Jugendhilfe im deutschen Raum ist durch über 100 Jahre Zwangserziehung geprägt. Heime und Anstalten hatten mit ihrer Erziehung einen staatlichen Auftrag zu erfüllen. Alle Zwangserziehungsgesetze waren Armengesetze, die sich hauptsächlich gegen die unteren Bevölkerungsschichten richteten. [9] Heimerziehung stand immer im Zusammenhang mit Begriffen wie Freiheitsentzug, Eingriff, Verwahrlosung, Strafe oder Züchtigung.[10] Das KJHG löste 1991 das bis dahin geltende Jugendwohlfahrtgesetz (JWG) ab, das nach dem obrigkeitsstaatlichen Prinzip des Eingriffs und der Reglementierung aufgebaut war.[11]
Mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz wurden gravierende Änderungen in der Sichtweise auf Kinder, Jugendliche und Familien gesetzlich reglementiert. Ein wesentliches Ziel bei der Einführung des KJHG war es „entsprechend dem leistungsrechtlichen Charakter die Beteiligung und Mitwirkung der Eltern (Personensorgeberechtigten) und, soweit rechtlich möglich, der Kinder- und Jugendlichen zu garantieren.“[12] Der Gesetzgeber geht nicht mehr von Erziehungseingriffen aus, sondern betont die Freiwilligkeit der Hilfen zur Erziehung.[13]
Im § 27 (Hilfe zur Erziehung) KJHG werden als Anspruchsberechtigte die Inhaber der persönlichen Sorge (in diesem Fall Eltern) benannt.
Das heißt, Eltern entscheiden darüber, ob und welche Hilfe sie bei der Erziehung ihres Kindes in Anspruch nehmen. Sie werden vom Gesetz als gleichberechtigte und kompetente Partner angesehen. Wenn Hilfe zur Erziehung gewährt wird, ist das Kind im Kontext seiner Familie zu sehen und es „soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.“ (§27 (2) KJHG)
Das KJHG verankert also grundsätzlich nicht Kinderrecht, sondern Elternrecht.
Zentraler Punkt in der Mitbestimmung von Eltern ist der § 36 KJHG. In der Gestaltung des Hilfeplans ist gemeinsam mit den Eltern, den Kindern und den an der Hilfe beteiligten Fachkräfte über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten.
Ziel der Unterbringung nach §34 KJHG ist zunächst
■ die Rückkehr des Kindes in die Familie zu erreichen oder, wenn dies nicht möglich ist
■ die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder
■ eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und es auf ein selbständiges Leben vorzubereiten.
Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Heim soll durch eine Verbindung von Alltagsleben und pädagogischen und therapeutischen Angeboten gewährleistet werden (§34 KJHG).
Zusammenfassend kann man sagen, dass „für die Hilfe zur Erziehung im Heim [...] die Würdigung des Elternrechts inhaltlich elementar [ ist].“12 Eltern und Familien sind an allen wesentlichen Entscheidungen des Unterb ringungsprozesses zu beteiligen; ihren Wünschen ist zu entsprechen. „Durch Beratung und Unterstützung sollen die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines [...] vertretbaren Zeitraumes so weit verbessert werden, daß sie das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann“ (§ 37 (1) KJHG). Alle Leistungen und Entscheidungen müssen durch einen Aushandlungsprozess hervorgebracht werden, der „einen hohen Anspruch an die kommunikative, fachliche und soziale Kompetenz, an die Bereitschaft zum Sich- Einlassen, an die Reflexionsfähigkeit der Professionellen wie der Hilfesuchenden stellt.“[14]
In der geschichtlichen Entwicklung des Rechts ist nachvollziehbar, dass Elternarbeit nicht mehr nur familienersetzende Arbeit erfordert, sondern dass „Adressat von Erziehungshilfe [demnach] nicht allein das auffällige Kind, sondern seine Familie im ganzen [ ist].“13 [15]
1.3 KONTEXT
Neben den geschilderten rechtlichen Grundlagen spielt der Zusammenhang, der Kontext und der Rahmen durch den stationäre Unterbringung definiert wird eine wesentliche Rolle. Ich werde drei Sichtweisen beschreiben, die Ausdruck von grundsätzlichen Haltungen und Ansichten von Mitarbeitern und Institutionen zum Thema Elternarbeit in der stationären Unterbringung sind.
1.3.1 Individuumsbezogene Sichtweise
„Eltern behandeln das Kind schlecht- deshalb stiehlt es“[16]
Bei Mitarbeitern in vielen stationären Bereichen wird eine individuumsbezogene Sichtweise praktiziert. Das betrifft nach meinen Erfahrungen nicht nur Heimunterbringung in der Kinder- und Jugendhilfe, sondern auch Settings wie Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Jugendstrafanstalten u.ä.
In der individuumsbezogenen Sichtweise werden Auffälligkeiten, abweichendes Verhalten und Beziehungen in Familien linear betrachtet. Dieser linearen Betrachtung liegt eine Denkweise in einem Ursache- Wirkungsmodell zu Grunde. Störungen in kindlichem oder jugendlichem Verhalten werden oft im medizinischen Sinne interpretiert und im Individuum selbst begründet. Das Kind hat pathologische Eigenschaften oder es ist kriminell, delinquent oder Schulschwänzer. Eltern werden im traditionellen Ursache- Wirkung- Denken als Verursacher der Störungen gesehen. Das Kind muss somit aus dem oftmals schädlichen angesehenen Milieu entfernt werden; es kommt zur Heimunterbringung weit weg vom Elternhaus. Durch den Aufbau von anderen, positiveren Beziehungsstrukturen, pädagogischen Angeboten, Belohnung oder Bestrafung wird versucht, die Defizite wieder auszugleichen.[17] Es existieren Akten, Berichte und Diagnosen. In diesen Berichten werden Kinder meist defizitär, gestört und auffällig beschrieben. Einweisende Instanzen beschreiben das Verhalten aufzunehmender Kinder wie folgt:
„Verhaltensstörungen, Verhaltensauffälligkeiten in Familie, Schule, aggressi- ve/depressive Verhaltensmuster, gestörte frühkindliche Entwicklung, Deprivationsschäden, defizitäre Sozialisationsbedingungen [...], neurotische Fehlentwicklung, emotionale Störungen, psychomotorische Störungen, Diebstähle, beginnende Devianz“.[18]
Heimkinder werden als auffällig beze ichnet durch:
„Probleme bei der Kontrolle aggressiver Handlungsimpulse sowie bei der Verarbeitung frustrierender Bedingungen und Erlebnisse, Reserviertheit und Unsicherheit in sozialen Kontaktverhalten, Überschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit und ‘übertriebener’ Ehrgeiz [...], [und] kompensatorische Selbstaufwertungstendenzen auf dem Hintergrund eines erhöhten Minderwertigkeitserlebens.“[19]
Die Rolle des Mitarbeiters im Heim ist durch eine parteiliche Kind- Orientierung geprägt.
Nach meiner Erfahrung wirken sich diese Sichtweisen im Heim eher hinderlich auf den Erfolg und die Beziehungen der Beteiligten aus. Kinder fühlen sich oft Schuld an den Problemen in der Familie und der Heimeinweisung. Ihre Bindung an die Eltern wird nicht beachtet. Das hat zur Folge, dass Kinder sich nur scheinbar und oberflächlich an das Heim mit seinen Regeln anpassen, sich im Innern verweigern oder ihre Symptome und Auffälligkeiten um so mehr in die Einrichtung einbringen. Eltern erleben sich als inkompetent und werden gegen das Heim in Konkurrenz gehen. Wenn es unter diesen Vorzeichen trotzdem gelingen sollte, die Eltern zur Zusammenarbeit zu gewinnen ist das noch kein Garant für die Veränderungen von Strukturen im Familiensystem, die auch von Dauer sind.[20]
Mitarbeiter, die dieses Denkmodell (Sichtweise) bevorzugen und ungenügende Möglichkeiten zur Reflexion und Supervision haben, sind in Gefahr, immer wieder in Muster zu verfallen, die mit ihren eigenen Herkunftserfahrungen oder Erwartungen an Beruf und Klientel in Zusammenhang stehen. (Warum reagiert das Kind nur so? Ich wollte doch nur sein bestes; es ist undankbar. Wie kann es so an seinen Elternhängen,die ihm doch nur schaden? Aus dem wird doch sowie so nichts, der kommt nach seinem Vater...)
Die Ursachen für diese individuumsbezogene Sichtweise sind in verschiedenen Erklärungsansätzen zu suchen. Zum einen in der - nach wie vor - ungenügenden konzeptionellen Arbeit von Hilfeeinrichtungen, einem überholten Rollenverständnis von Helfern (Pflege, Familienersatz, Fürsorge...) und der ungenügenden Qualifikation von Mitarbeitern. [21] Zum anderen erwächst aus meinem Verständnis eine individuumszentrierte Sichtweise aus der „Theorielosigkeit“[22] in der Heimerziehung, die das Fehlen von einheitlichen Konzepten und Verfahrensweisen verursacht.
In der Nähe der Heimerziehung - als Teilgebiet der Sozialpädagogik - zu Professionen wie Soziologie, Humanmedizin oder Psychologie ist ebenfalls eine Ursache für die Übernahme entsprechender individuumsbezogener Erklärungsmodelle zu suchen.[23] So gleicht die unreflektierte Anwendung von Arbeitsformen dieser Professionen (z. Bsp. Anamnese, Diagnose und Intervention) durch Mitarbeiter der Heimerziehung eher der Vorgehensweise des Allgemeinmediziners als der des Pädagogen oder Erziehers.