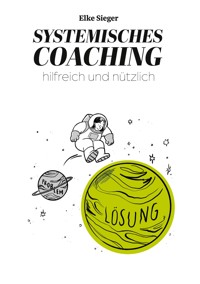
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Eine wertschätzende systemische Grundhaltung, ein klares Coaching-Konzept sowie eine Auswahl wirkungsvoller Coaching-Methoden, dies sind die wichtigsten drei Faktoren, welche die Arbeit eines systemisch arbeitenden Coaches zum Erfolg führen. Die systemische Beraterin und Ausbilderin Elke Sieger weckt mit ihrem Buch die Neugier und Begeisterung für das systemische Arbeiten und die damit untrennbar verbundene systemische Haltung. Dafür greift sie in ihre große Methodenschatzkiste aus über 20 Jahren Erfahrung und bietet eine Fülle an fachlichem Input, praktischen Tipps und wertvollen Materials, sowohl für angehende Coaches als auch für diejenigen, die schon länger als Coach tätig sind und ihr Wissen dazu vertiefen möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein besonderer Dank gilt meiner Familie, die mich immer wieder bestärkt und ermuntert hat, mein Buchprojekt umzusetzen und dranzubleiben.
Ihnen – Thorsten, Hannah und Robin – widme ich dieses Buch.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
KAPITEL 1
Die Grundlagen Systemischen Coachings
1. Was ist Systemisches Coaching?
2. Abgrenzung zu Training, Supervision und Psychotherapie
3. Was bedeutet „systemisch“?
4. Kompetenzen Systemischer Coaches
5. Ethik im Coaching
6. Die systemische Haltung als Coach
KAPITEL 2
Der Coaching-Prozess
1. Die wichtige Auftragsklärung und der Dreiecksvertrag
2. Das rahmengebende Erstgespräch
3. Das vierphasige Coaching-Gespräch
4. Die gute Zielklärung
5. Der klare Coaching-Abschluss
6. Der formale Coaching-Vertrag
7. Die unterschiedlichen Kundentypen
KAPITEL 3
Die Coaching-Methoden
1. Das Herzstück – die systemischen Fragen
2. Der bewegungsfreudige Skalierungslauf
3. Die klärende Systemvisualisierung
4. Die anschauliche Konflikt-Landkarte
5. Das wertschätzende Reframing
6. Der dynamische Regelkreis
7. Das intensive Einflussrad
8. Das flexible Tetralemma
9. Das bunte Innere Team
KAPITEL 4
Das Coaching-Gespräch
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Internetlinks
„Nicht an uns zu arbeiten heißt, den anderen keine Gelegenheit zu geben, eine bessere Version von uns kennen zu lernen – und das wäre bedauerlich.“
Matthias Varga von Kibéd und Insa Sparrer aus Ganz im Gegenteil. Heidelberg: Carl-Auer, S. 247
Vorwort
Möglicherweise werden Sie sich fragen: Wozu ein weiteres Buch über Systemisches Coaching? Es gibt doch bereits viele und auch gute Bücher über dieses Thema. Diese Frage habe ich mir selbst lange gestellt und damit das Entstehen des Buches erfolgreich verhindert. Mein Herzenswunsch, über meine langjährige Tätigkeit als Coach und Ausbilderin für Coaches und die damit verbundene Begeisterung für das systemische Arbeiten ein Buch zu verfassen, wurde im Laufe der Jahre jedoch immer stärker.
Zudem haben mich die unzähligen, zuversichtlichen Ermunterungen meiner Ausbildungsabsolventen motiviert, meine Gedanken und Erfahrungen in Sachen „Coaching“ zu Papier zu bringen. Ohne all diese Menschen, die die Coaching-Ausbildung zu dem gemacht haben, was sie heute ist, wäre ich nicht in der Lage gewesen, dieses Buch zu schreiben. Mein größter Dank gilt von ganzem Herzen ihnen, die mir ihr Vertrauen in meine Kompetenz als Coach und Ausbilderin geschenkt haben.
Meine große Begeisterung für das Systemische Coaching und die damit verbundene systemische Haltung hat in all den Jahren eher zugenommen als nachgelassen. Das macht mein berufliches Tun so freudvoll und ich bin zutiefst dankbar, eine so sinnstiftende, erfüllende Aufgabe machen zu dürfen. Genau dieses Gefühl wünsche ich auch allen tätigen und zukünftig tätigen Coaches bei ihrer Arbeit.
Mein Wunsch ist es, mit diesem kleinen – hoffentlich hilfreichen und nützlichen – Praxisbegleiter den Funken meiner eigenen Begeisterung für das Systemische Coaching auf möglichst viele andere (künftige) Coaches überspringen zu lassen. Insofern ist es weniger meine Absicht, mit diesem Buch reines, fundiertes Wissen über Coaching zu vermitteln. Vielmehr möchte ich Menschen für systemisches Denken und Handeln und damit für das Systemische Coaching begeistern. Meine kühnste Hoffnung ist, möglichst viele Leserinnen und Leser mit dem systemischen Gedankengut anzustecken!
Im ersten Kapitel beschäftige ich mich mit den Grundlagen des Systemischen Coachings, den Definitionen und Begriffsabgrenzungen. Im Anschluss daran werde ich die systemische Grundhaltung mithilfe anschaulicher Metaphern beschreiben und greife dabei insbesondere auch auf meine langjährige Erfahrung als Coach und Ausbilderin zurück.
Im zweiten Kapitel beschreibe ich einen kompletten Coaching-Prozess von der Auftragsklärung über das Erstgespräch bis hin zum Coaching-Abschluss. Weiterhin werde ich die vier Phasen eines Coaching-Gespräches von Prof. Eckard König und Dr. Gerda Volmer1 vorstellen. Dieses Modell eines vierphasigen Coaching-Prozesses dient als gute Gesprächsstruktur für die im nächsten Kapitel dargestellten Methoden. Darüber hinaus werde ich auf einige „Kundentypen“ eingehen, durch die Coaches „in die Falle gelockt“ werden können sowie auf Strategien, als Coach erfolgreich damit umzugehen.
Im dritten Kapitel stelle ich in strukturierter Form eine Auswahl wirkungsvoller Methoden vor, die auch im Rahmen meiner systemischen Coaching-Ausbildung vermittelt werden. Zu Beginn des Kapitels werde ich dabei das Herzstück systemischen Arbeitens darstellen – die systemischen Fragen.
Im vierten Kapitel möchte ich Ihnen zum Abschluss anhand eines realen Fallbeispiels die vier Phasen eines Coaching-Gespräches noch einmal praxisnah und lebendig veranschaulichen.
Liebe Leserinnen und Leser, aus Gründen der besseren Lesbarkeit habe ich auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen weiblich, männlich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten aber selbstverständlich gleichermaßen für alle Geschlechter.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen sowie Erfolg und Begeisterung beim Ausprobieren der systemischen Haltung und der systemischen Coaching-Methoden.
Ihre Elke Sieger
KAPITEL 1
DIE GRUNDLAGEN
SYSTEMISCHEN COACHINGS
In diesem Kapitel werden die Grundlagen des Systemischen Coachings wie Definitionen und Begriffsabgrenzungen dargestellt. Darüber hinaus wird die Bedeutung der systemischen Haltung im Coaching vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrungen als Coach und Ausbilderin anschaulich beschrieben.
1. Was ist Systemisches Coaching?
In der Fachliteratur gibt es unzählige Definitionen über Coaching und Systemisches Coaching. Derzeit gibt es noch kein gemeinsames, einheitliches Verständnis darüber, was Systemisches Coaching genau ist. Zudem sind die Begriffe Coach und Coaching rechtlich nicht geschützt und wissenschaftlich nicht geklärt. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass es derzeit in der Literatur eher einen Wildwuchs an Definitionsversuchen hierzu gibt. Dennoch ist es die Aufgabe jedes systemisch arbeitenden Coaches, seinem (potenziellen) Kunden Orientierung darüber zu geben, was Systemisches Coaching bedeutet, was es leisten kann und wo die Grenzen liegen. Viele Coaching-Definitionen betonen zum Beispiel den Aspekt der „Hilfe zur Selbsthilfe“, womit gemeint ist, dass der Coach den Kunden dabei unterstützt, seine Lösungen aus sich selbst heraus zu entwickeln. Andere begrenzen Coaching auf berufsbezogene Inhalte aus der Arbeitswelt, die sich aus dem Spannungsfeld Person, Rolle und Organisation ergeben. Wieder andere Definitionsversuche stellen die hohe Bedeutsamkeit der positiven Beziehungsgestaltung im Coaching in den Vordergrund und/oder die Betrachtung der Wechselwirkungen bzw. Interaktionen mit dem sozialen System des Kunden. Häufig findet man auch eine – eher historisch bedingte – Abgrenzung in Bezug auf die Zielgruppe: In dieser Definition sind es meist Führungskräfte, Manager und Personen in Leitungsfunktionen, auf die Coaching als Personalentwicklungsinstrument abzielt.2
Die nun im Folgenden genannten Aspekte sollen den angehenden Coaches eine erste Orientierung geben, welche Faktoren im Systemischen Coaching grundsätzlich wichtig sind. Die von mir ausgewählten Merkmale erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ließen sich um weitere, wesentliche Punkte erweitern:
Positive Beziehungsgestaltung
Systemisches Coaching zeichnet sich durch eine vertrauensvolle, partnerschaftliche und wertschätzende Beziehung auf Augenhöhe zwischen Coach und Kunde aus. Dieser gute Kontakt ist eine notwendige Voraussetzung für ein wirkungsvolles Coaching.
Lösungen entwickeln die Kunden
Der Systemische Coach gibt keine Lösungen vor und hält sich mit subjektiv und biografisch geprägten Bewertungen zurück. Vielmehr unterstützt er die Kunden dabei, für sich selbst passende und nützliche Lösungen zu entwickeln.
Erweiterung der Wahl- und Handlungsmöglichkeiten
Der Systemische Coach gestaltet einen Rahmen, in dem es Kunden möglich ist, andere Perspektiven einzunehmen, neue Denk-, Fühl- und Handlungsmuster zu etablieren und damit die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten zu erweitern sowie die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Fokus auf Ressourcen und Kompetenzen
Der Systemische Coach nimmt seinen Kunden stets in seinen Potenzialen, Ressourcen und Kompetenzen wahr und fokussiert auf Ziele in der Zukunft. Dadurch entfällt der Blick auf Probleme, Hindernisse und Defizitäres. Das Motto lautet vielmehr: „Erwischen beim Gutmachen!“
Kunden sind Experten
Kunden werden vom Systemischen Coach als kompetent und autonom und damit als Experten für die eigene Lebensgestaltung angesehen. Der Coach unterstützt den Kunden dabei, indem er Anregungen und Impulse gibt, um die „Lösungsreife“3 des Kunden zu fördern. Welche Lösungen der Kunde letztlich für sich als hilfreich und nützlich empfindet, bleibt in der Verantwortung des Kunden. Damit ist der Kunde stets Experte für seine Inhalte und Lösungen, während der Coach für die Prozess-Gestaltung und Prozess-Steuerung verantwortlich ist. Hier drückt sich sehr deutlich das Prinzip der Partnerschaftlichkeit und der Zusammenarbeit auf Augenhöhe aus.
Kunden sind eingebunden in einem sozialen System
Systemische Coaches betrachten ihren Kunden nicht isoliert als Person, sondern stets eingebunden in sein gesamtes soziales System. Sie denken sozusagen „zirkulär“, d. h. das gesamte Umfeld des Kunden steht in Wechselwirkung zueinander und wird in die Betrachtungen mit einbezogen. Es gibt keine eindeutigen Ursachen oder gar Schuldige für eine bestimmte Situation, ein bestimmtes Verhalten. Vielmehr geht es darum zu prüfen, inwiefern das soziale Umfeld des Kunden dessen Verhalten beeinflusst und welche Möglichkeiten der Kunde hat, dies zu verändern.
Der Versuch einer Definition
Systemisches Coaching ist eine prozessorientierte Begleitung sowie eine professionelle Reflexionshilfe. Dabei stellt der Coach einen Rahmen zur Verfügung, durch den Kunden für sich passende, hilfreiche und nützliche Lösungen entwickeln können, um ihre Wahl- und Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Das Coaching findet stets in einem partnerschaftlichen, vertrauensvollen Dialog unter Experten statt: Der Kunde ist Experte für seine Inhalte und Lösungen, während der Coach Experte für die Steuerung und Gestaltung des Coaching-Prozesses ist.
3 Als Lösungsreife kann man den inneren Zustand des Kunden bezeichnen, durch den dieser zunehmend leichter Zugang zu seinen eigenen Lösungsideen bekommt und sich von seinem Problemerleben löst.
2. Abgrenzung zu Training, Supervision und Psychotherapie
Coaching in Abgrenzung zum Training
Das Training dient dem gezielten Auf- und Ausbau bestimmter Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug auf einen zuvor festgelegten Themenbereich. Es handelt sich dabei um das Erlernen neuer Kompetenzen und Verhaltensweisen für bestimmte Situationen wie beispielsweise ein Training für Führungskräfte, in dem die Teilnehmer verschiedene Arten von Mitarbeitergesprächen erlernen. Weitere typische Beispiele für derartige Trainingsmaßnahmen sind Kommunikations-Trainings, Moderations-Trainings, Trainings zum Erlernen von Verhandlungstechniken oder auch Präsentations-Trainings. Der Trainer ist Experte und vermittelt mithilfe unterschiedlicher Methoden sein Wissen, er leitet an und gibt konstruktives Feedback. Wenngleich der Fokus im Wesentlichen auf dem Trainieren und Üben neuer Verhaltensweisen liegt, wie etwa das Führen eines Mitarbeitergesprächs, werden auch in Trainingsmaßnahmen – analog zum Coaching – Haltungen und Werte reflektiert. Der Trainer gibt in der Regel die Zielsetzung, den Inhalt und den methodischen Ablauf des Seminars vor (zum Teil auch in Absprache mit den jeweiligen Auftraggebern), wobei grundsätzlich auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Teilnehmer eingegangen wird. Die positive Beziehungsgestaltung zwischen Trainer und Gruppe ist wichtig, um gemeinsames Lernen zu ermöglichen.
Im Vergleich dazu ist Coaching ein individueller Prozess, den der Coach methodisch begleitet und in dem Inhalte sowie Ziele gemeinsam erarbeitet werden und stark in der Verantwortung des Kunden liegen. Der Coach schafft vor allem den Rahmen, in dem der Coaching-Kunde seine eigenen Lösungen entwickeln kann. Dabei ist eine vertrauensvolle, wertschätzende Beziehung auf Augenhöhe im Coaching sehr wichtig. Es ist ein co-kreativer Prozess, in dem neue Sichtweisen und Handlungsoptionen möglich werden.4
Coaching in Abgrenzung zur Supervision
Die Abgrenzung zwischen Coaching und Supervision ist nicht leicht. Möglicherweise liegt es daran, dass die Gemeinsamkeiten überwiegen. Die Bedeutung der positiven Beziehungsgestaltung zwischen den Gesprächspartnern, das Arbeiten auf Augenhöhe sowie der Einsatz reflektierender Methoden sind beispielsweise im Coaching und in der Supervision identisch.
Worin bestehen nun die Unterschiede?
Supervision meint ganz generell die Betrachtung und (Meta-)Reflexion des eigenen beruflichen Handelns mit dem Ziel, dieses fortlaufend zu professionalisieren. Die Inhalte der Supervision beziehen sich demnach vorwiegend auf konkrete Fragestellungen oder Probleme, die sich aus der beruflichen Interaktion ergeben. Dabei kann es auch zu einer Bearbeitung/Betrachtung persönlicher, biografischer Themen kommen, falls diese für das berufliche Handeln von Bedeutung sind. Supervision hat für den Kunden bzw. Supervisanden somit auch die Funktion, die eigene psychische und geistige Gesundheit zu erhalten („Psychohygiene“) sowie durch die Reflexion des beruflichen Handelns auch den Zweck, die eigene beraterische Professionalität aufrechtzuerhalten.
In der ursprünglichen Betrachtung bezeichnete die Supervision eine Beratung für Berater, die der Reflexion der eigenen beruflichen Tätigkeit als Therapeut, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge oder Coach diente. Coaching dagegen richtete sich in dieser historisch bedingten Anschauung ausschließlich an Personen in Management- und Führungsfunktionen. Diese zielgruppenspezifische Unterscheidung scheint allerdings zunehmend keine Rolle mehr zu spielen. Zum einen ist Coaching längst kein Beratungsformat mehr ausschließlich für Manager und Führungskräfte und zum anderen findet Einzel- und Gruppensupervision nicht nur in sozialen Einrichtungen und Organisationen statt, sondern auch zunehmend in Wirtschaftsunternehmen.
Ein vielleicht hilfreicheres Kriterium zur Unterscheidung beider Formate könnte deren unterschiedliche Zielsetzung sein: Coaching ist ziel- und lösungsorientiert. Es geht darum, Ziele zu formulieren, den Kunden dabei zu unterstützen, dass er Lösungen und Erkenntnisse für sich entwickeln kann; damit ist der Blick überwiegend zukunftsgerichtet. Supervision hingegen ist eine Art Metareflexion über das eigene berufliche Handeln (man spricht auch von „Fallsupervision“), welches in der Vergangenheit liegt. Es geht hier stärker um die Frage, wie der Supervisand (Berater/Coach) mit konkreten beruflichen Herausforderungen umgehen sowie neue Impulse und Sichtweisen im Umgang damit entwickeln kann. Ferner stellt sich der Supervisand (Berater/ Coach) die Frage, wie er die Sitzungen mit seinen Klienten erlebt hat, welche eigenen persönlichen Themen bei ihm angesprochen wurden und wie professionell er damit umgegangen ist. Wichtig ist dabei auch die Erkenntnis, wie es ihm künftig gelingen kann, in seiner beraterischen Kraft und Professionalität zu bleiben. Der Blick in die Vergangenheit generiert damit – ebenso wie beim Coaching – auch bei der Supervision Erkenntnisse und Lösungen für die Zukunft.5
Coaching in Abgrenzung zur Psychotherapie6
Die Abgrenzung von Coaching gegenüber der Psychotherapie ist am anspruchsvollsten und wird daher im Folgenden ausführlicher dargestellt. Zudem ist es dabei unerlässlich, auch die rechtlichen Aspekte zu berücksichtigen.
Rechtliche Aspekte
Der Begriff „Coach“ (und übrigens auch der Begriff „Psychologischer Berater“) ist in Deutschland rechtlich nicht geschützt, d. h. er ist an keine gesetzliche Anforderung an die Führung dieser Bezeichnung geknüpft. Es handelt sich um eine Tätigkeit, die im Grunde jeder ohne rechtliche und fachliche Vorbedingung anbieten könnte. Unternehmen und Coaching-Kunden ist daher zu empfehlen, Coaches auszuwählen, die neben anderen wichtigen fachlichen und persönlichen Kompetenzen eine fundierte, durch einen Coachingverband zertifizierte Coaching-Ausbildung nachweisen können. Coachingverbände wie zum Beispiel der Deutsche Coaching Verband e.V. (DCV)7 arbeiten aktiv an der Durchsetzung von Qualitätsstandards für die Aus- und Weiterbildung von Coaches, um so eine gewisse Transparenz am Markt herzustellen und vor allem auch, um Ausbildungs-Interessenten eine Orientierung auf dem wachsenden Coaching-Ausbildungsmarkt zu geben. Damit möchten sie letztlich den Unternehmen und (Privat-)Kunden eine Orientierungshilfe bei der Auswahl von Coaches bieten.
Die Psychotherapie hingegen ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Der Funktionsinhaber muss eine staatlich anerkannte Therapieerlaubnis als Facharzt, psychologischer Psychotherapeut (Studium der Psychologie als Grundlage) oder Heilpraktiker vorlegen. Das Psychotherapeutengesetz (PsychThG) wurde 1998 beschlossen. Auszüge daraus lauten wie folgt:
§1 Abs. 3 Satz 1 + 3 PsychThG:
„Psychotherapie im Sinne dieses Gesetzes ist jede mittels wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist. […]. Zur Ausübung von Psychotherapie gehören nicht psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben.“8
Welche Grenzen ergeben sich daraus für Coaches?9
Ein Coach darf aufgrund des Psychotherapeutengesetzes und des Heilpraktikergesetzes keine Leistungen erbringen, um Krankheiten, Störungen oder Leiden zu lindern oder zu heilen. Das betrifft alle Störungsbilder oder Krankheiten, die in der
Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD10)
10
(
englisch:
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Conditions)
der Weltgesundheitsorganisation dargestellt sind.
Ein Coach darf weder eine echte Anamnese durchführen noch darf er Diagnosen stellen.
Ein Coach kann sich nicht auf die in Heilberufen gesetzlich begründete Schweigepflicht (Verschwiegenheitspflicht) berufen.
Ein Coach darf keine „aufdeckenden Verfahren“ einsetzen. Das sind Verfahren, mit denen Unbewusstes bewusst gemacht wird wie beispielsweise in der Arbeit mit Rückführungen zur Reinkarnation. Die Konfrontation mit unverarbeiteten Erlebnissen/Konflikten kann für Menschen mit psychischen Erkrankungen gefährlich sein.
11
Von daher ist es wichtig – und das sollte Grundlage jeder fundierten Coaching-Ausbildung sein – dass Coaches über Symptomatik, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten der häufigsten psychischen Störungsbilder solide Kenntnisse aufweisen. Viele Weiterbildungsinstitute für Coaches bieten hierzu offene Seminare zum Erwerb von Grundlagen der Psychopathologie an. Einerseits dient es dazu, sich als Coach zu schützen, um nicht gegen das Psychotherapiegesetz oder Heilpraktikergesetz zu verstoßen, andererseits hilft es dem Coach, zu erkennen, ob ein Kunde doch besser an einen Psychotherapeuten weitergeleitet werden sollte. Professionalität in diesem Kontext bedeutet, die eigenen Grenzen als Coach im Coaching zu erkennen und das Handeln danach auszurichten. Coaches sollten diese Grenzen im Coaching aber nicht nur erkennen, sondern auch gegenüber dem Kunden artikulieren. Das heißt, wenn ich als Coach das Gefühl einer Überforderung hinsichtlich der Inhalte verspüre, ist es wichtig, diese Grenzen gegenüber dem Kunden im Coaching zu erwähnen. Nur so bleibe ich als Coach professionell, verantwortungsbewusst und damit letztlich in meiner beraterischen Kraft und wirkungsvoll.
Grundsätzlich kann man sagen, je schwerer die persönliche psychosoziale Beeinträchtigung ist und Selbststeuerungsmechanismen zur Problemlösung nicht mehr ausreichen, ist eher Psychotherapie und nicht Coaching indiziert. Ein psychologischer Psychotherapeut kann mithilfe einer Krankheitsanamnese gemäß dem ICD10 eine Diagnose stellen, um Klarheit zu bekommen.
So kann ein Kunde mit der Zielsetzung „Förderung von Selbstmanagement-Strategien“ ins Coaching kommen und mithilfe des Coaches relevante Erkenntnisse sowie handlungswirksame Strategien erarbeiten. Berichtet der Kunde von Symptomen wie Schlafstörungen, Ängsten, sozialem Rückzug, depressiven Episoden, psychosomatischen Symptomen oder Ähnlichem, sollte der Coach dem Kunden die Notwendigkeit einer medizinischen und/oder psychotherapeutischen Behandlung nahebringen.
Dieser rechtliche Orientierungsrahmen hilft aber nicht unbedingt in der Alltagsrealität von Coaches, um Coaching von Psychotherapie gut abzugrenzen. Zu Recht stellen Ausbildungsteilnehmer häufig die Frage: „Wie unterscheidet sich Coaching von Psychotherapie?“ Erfahrungsgemäß steckt hinter dieser Frage oftmals die Befürchtung oder Angst, etwas „falsch“ oder „kaputt“ zu machen oder etwas beim Kunden auszulösen (etwa an Gefühlen, Ängsten, unbewussten Konflikten), was der Coach nicht mehr „handeln“ kann. Umso wichtiger ist es daher, dass ein Coach grundsätzlich die Fähigkeit und Professionalität besitzt, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen, zu akzeptieren und gegenüber dem Kunden transparent zu machen.
Der Versuch Coaching und Psychotherapie einander abzugrenzen
Der Psychologe und Business-Coach Uwe Böning12 sieht die Psychotherapie als eine Kerndisziplin der Psychologie an, in deren Mittelpunkt die Behandlung von psychisch, emotional oder psychosomatisch bedingten Krankheiten, Leidenszuständen oder Verhaltensstörungen steht. Im Gegensatz dazu versteht der Autor Coaching als ein originäres Instrument der Personalentwicklung, das nicht auf die Behandlung psychischer Störungen mit Krankheitswert ausgerichtet ist, wie sie durch den Diagnoseschlüssel ICD10 der Weltgesundheitsorganisation definiert werden. Coaching richtet sich demzufolge an gesunde Personen und hat Probleme zum Gegenstand, die aus der Berufsrolle heraus entstehen.
Gerhard Roth und Alica Ryba führen in ihrem Buch „Coaching, Beratung und Gehirn“13 einige Argumente auf, die typischerweise zur Unterscheidung von Coaching und Psychotherapie in der Literatur genannt werden. Sie machen gleichzeitig deutlich, wie schwierig die Abgrenzung beider Themengebiete voneinander ist. Im Folgenden sind, angelehnt an die Autoren, einige relevante Unterscheidungsmerkmale dargestellt, um angehenden Coaches die Orientierung hinsichtlich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Coaching und Psychotherapie zu erleichtern:
1. „Gesund“ versus „Krank“
Das wohl am häufigsten vorgebrachte Unterscheidungsmerkmal, das auch die Autoren darlegen, ist die Unterscheidung zwischen gesund und krank: Coaching als Beratungsformat für gesunde Menschen mit aktuellen, berufsbezogenen sowie persönlichen Anliegen oder Konflikten; Psychotherapie hingegen als ein Heilverfahren zur Behandlung von psychischen Störungen mit Krankheitswert, wie sie im ICD10 aufgeführt sind. Dazu gehören unter anderem Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen, psychosomatische Erkrankungen, Suchterkrankungen und Essstörungen. Die Herausforderung dabei ist allerdings die Frage, wo genau die scharfe Grenze zwischen gesund und krank gezogen werden soll; d. h. können wir eine derartige Grenze genau festlegen und wenn ja, nach welchen Kriterien? Vermutlich bewegen sich sowohl Coaches als auch Psychotherapeuten hier in Grauzonen, die nicht klar definiert sind oder (noch) nicht klar definiert werden können. Diese Grauzonen zeigen sich vor allem dann, wenn bestimmte Schwierigkeiten maßgeblich in der Person begründet liegen, aber für die Ausübung der beruflichen Rolle relevant sind. Und genau diese Situation kommt im Coaching häufig vor. Klar ist, dass Coaches keine Anamnesen durchführen und keine Diagnosen nach dem ICD10 stellen dürfen. Eine behandlungsbedürftige Erkrankung zu diagnostizieren, gehört zu Recht in die Hände ausgebildeter und erfahrener Psychotherapeuten.
2. „Zukunft“ versus „Vergangenheit“
Eine weitere, häufig vorgebrachte Unterscheidung zwischen Coaching und Psychotherapie, die auch die Autoren Roth und Ryba aufführen, ist der Fokus auf Vergangenheit und Zukunft. Danach ist Psychotherapie eher problem- und ursachenorientiert und der Blick geht zurück in die Vergangenheit, während Coaching als ziel- und lösungsorientiertes Verfahren mit Blick auf die Gegenwart und Zukunft betrachtet wird. Hier wird vermutlich Psychotherapie mit der klassischen Psychoanalyse gleichgesetzt, die tatsächlich zurückschaut und Ursachen analysiert. Viele andere Therapiemethoden wie die Verhaltenstherapie oder die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie nach Steve de Shazer14 schauen nach vorne in die Zukunft. Interessanterweise entspringen ja gerade die meisten im Coaching eingesetzten ziel- und lösungsorientierten Methoden dem psychotherapeutischen Interventions-Repertoire. Insofern ist das Unterscheidungsmerkmal „Vergangenheit versus Zukunft“ auch nicht immer hilfreich und anwendbar.
3. „Kurz“ versus „Lang“
Coaching ist ein zeitlich begrenztes Beratungsformat, das im Mittel drei bis sechs Einzelsitzungen in einem Zeitraum von vier bis sechs Monaten umspannt. Im Idealfall führt das Coaching dazu, den Kunden in die Lage zu versetzen, einen guten Zugang zu seinen eigenen Kompetenzen, Ressourcen und Lösungsstrategien zu erlangen, so dass Coaching am Ende überflüssig wird. Psychotherapie benötigt in der Regel wesentlich mehr Zeit. Dabei geht es um eine tiefgreifende Persönlichkeitsentwicklung vor dem Hintergrund der gesamten Lebensgeschichte und/oder um die Linderung bzw. Heilung von psychischen Störungen. In der Regel dauert eine Therapie ca. 20 bis 100 Sitzungen, die in einem Zeitraum von ungefähr ein bis zwei Jahren erfolgen. Die Dauer der jeweiligen Therapie hängt in hohem Maße von der Art des therapeutischen Verfahrens ab. Eine lösungsfokussierte Kurzzeittherapie kann etwa der Dauer eines Coaching-Prozesses ähneln, während eine psychoanalytische Therapie mehrere Jahre dauert. Coaching greift weniger tief in die Persönlichkeitsstruktur des Klienten ein und fokussiert auf aktuelle berufsbezogene Themen, die stets mit persönlichen und privaten Aspekten einhergehen, aber in der Regel eine leichte bis mittlere emotionale Tiefe aufweisen. Damit wird deutlich, dass die unterschiedliche Zeitdauer beider Beratungsverfahren eng verknüpft ist mit den zu bearbeitenden Themen und Zielen der Beratung und somit als wesentliches Unterscheidungsmerkmal ebenfalls nicht in Betracht kommt.
4. Beziehungsgestaltung als wichtige Voraussetzung
Die Beziehung zwischen Coaches und Klienten sowie zwischen Therapeuten und Patienten ist laut Roth und Ryba eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der jeweiligen Beratungsform.15 In zahlreichen empirischen Studien konnte ein Zusammenhang zwischen therapeutischer Beziehung und dem Therapieerfolg nachgewiesen werden. Im Coaching gibt es hierzu vergleichsweise noch wenige Studien, dennoch wird wohl jeder erfahrene Coach bestätigen, dass die Qualität der Beziehung zwischen Coach und Klient von großer Bedeutung ist und einen wichtigen Erfolgsfaktor im Coaching darstellt. Empirische Untersuchungen hierzu wurden erst in den letzten Jahren begonnen. In einer metaanalytischen Untersuchung konnten Graßmann und Kollegen16 zeigen, dass die Beziehungsqualität zwischen Coach und Klient deutlich mit den erzielten Coaching-Ergebnissen zusammenhängt. Weiter wurden in einer repräsentativen Fragebogenstudie von Prof. Eric De Haan und Kollegen17 retrospektiv 1895 Coaches-Klienten-Beziehungen untersucht. Auch sie konnten zeigen, dass der Coaching-Erfolg von der Coaching-Beziehung abhängt. Im Gegensatz zu therapeutischen Studien hat der Bindungsaspekt allerdings einen geringeren Einfluss auf das Coaching-Ergebnis als der Aufgaben- und Zielaspekt der sogenannten Arbeitsallianz.18 Darüber hinaus konnten Shirley C. Sonesh et al. in ihrer Studie ebenfalls einen signifikanten Einfluss der Coach-Klienten-Beziehung auf den Coaching-Erfolg nachweisen. Allerdings ist einschränkend zu sagen, dass der Metaanalyse lediglich zwei Primärstudien zugrunde gelegt werden konnten.19 Zusammenfassend kann man festhalten, dass eine gute Beziehung zwischen Coach und Kunde eine kaum verzichtbare Grundlage dafür bietet, gute Ergebnisse in der gemeinsamen Arbeit zu erzielen. Diesem Aspekt sollte sowohl in der Praxis als auch in Coaching-Ausbildungen viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Was genau diese gute Beziehung zwischen den Beteiligten ausmacht, ist heute noch nicht vollends geklärt. Carl Rogers, der Begründer der klientenzentrierten Gesprächstherapie, hatte bereits in den 50er-Jahren erkannt, dass eine positive, wertschätzende und bejahende Haltung den Klienten gegenüber maßgeblich für einen Therapieerfolg ist.20





























