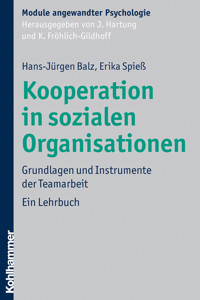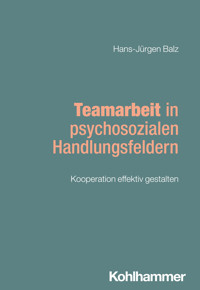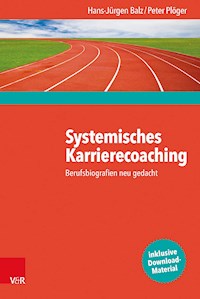
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die moderne Arbeitswelt ist durch eine Zunahme beruflicher Veränderungen und Übergänge gekennzeichnet. Die damit zusammenhängenden Selbstmanagementanforderungen an den Einzelnen und die vielfältige Fragen der Harmonisierung von Beruf, Familie und individueller Selbstverwirklichung machen das Karrierecoaching zu einem Entwicklungsmarkt mit gestiegenen Anforderungen an die Berater.Bei der traditionellen Berufsberatung bleiben die familiären Bindungen bei berufsbiographischen Entscheidungen und die vom sozialen Kontext abhängigen Handlungsmöglichkeiten zumeist unberücksichtigt. Sie zu erkennen und systematisch zu analysieren ist jedoch notwendig, um Verhaltensweisen besser zu verstehen, sie in Karriereüberlegungen zu integrieren, als Ressource in Veränderungsprozessen zu nutzen und damit zu dauerhaft tragfähigen Entscheidungen zu gelangen.Die systemischen Beratungsmethoden unterstützen eine ganzheitliche Wahrnehmung der Lebenslage der Klienten. Berater können mit ihnen den Coachingprozess zielgerichteter planen und gestalten, mit den Klienten eine kooperative Arbeitsbeziehung schaffen und dadurch auch schwierige Beratungssituationen sicherer bewältigen. Die systemischen Methoden führen den Klienten zu seinen Ressourcen und helfen ihm, berufliche Konfliktsituationen zu bearbeiten.22 Übungen im Anhang geben Anregungen für die Beratungsarbeit. Sie werden auch als kostenloses Download-Material zur Verfügung gestellt.Zu diesem Titel gibt es digitales Zusatzmaterial:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Jürgen Balz/Peter Plöger
SystemischesKarrierecoaching
Berufsbiografien neu gedacht
Mit einem Beitrag von Kirsten Dierolf
Vandenhoeck & Ruprecht
Mit 15 Abbildungen und 7 Tabellen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99719-3
Umschlagabbildung: sippakorn/shutterstock.com
© 2015, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, 37073 Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.deAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällenbedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
Inhalt
Vorwort von Jürgen Hargens
Berufslaufbahn als Lifestyle-Thema(Hans-Jürgen Balz und Peter Plöger)
Die W-Fragen des Karrierecoachings(Hans-Jürgen Balz und Peter Plöger)
Wandel der Arbeitswelt(Peter Plöger)
Neue Laufbahnorientierungen(Peter Plöger)
Berufliche Selbstmanagementanforderungen(Peter Plöger)
Ziel und Inhalt des Karrierecoachings(Hans-Jürgen Balz)
Organisationsexterner und -interner Zugang des Coaches im Karrierecoaching(Hans-Jürgen Balz)
Fazit(Hans-Jürgen Balz und Peter Plöger)
Gesellschaftliche und individuelle Antworten auf Berufswahl- und Karrierefragen(Hans-Jürgen Balz)
Wie alles beginnt – vom Traumberuf zur Berufsorientierung
Risikominimierung oder Systeme laden zum Übergang ein
Wissenschaftliche Zugänge zu Laufbahnfragen
Fazit
Menschenbild und Haltung im systemischen Karrierecoaching(Peter Plöger)
Wie ein Systemiker die Welt sieht
Die Praxis der systemischen Haltung
Fazit
Systemische Methoden im Karrierecoaching(Hans-Jürgen Balz und Peter Plöger)
Prozessstruktur im Karrierecoaching(Hans-Jürgen Balz)
Methodisches Vorgehen im Karrierecoaching(Peter Plöger)
Fazit(Hans-Jürgen Balz und Peter Plöger)
Führungskräftecoaching(Kirsten Dierolf)
Die Katze beißt sich in den Schwanz
Klare Karriereplanung
Einbindung der Organisationsentwicklung
Abstieg – Umstieg – Aufstieg?
Abschluss: Sind Führungskräfte wirklich anders? Antwort: nicht wirklich
Anwendungsfragen im Karrierecoaching(Hans-Jürgen Balz und Peter Plöger)
Umgang mit Entscheidungsalternativen(Hans-Jürgen Balz)
Umgang mit Begrenzungen(Hans-Jürgen Balz)
Exkurs: Diagnostische Methoden im Kontext von systemischem Karrierecoaching(Hans-Jürgen Balz)
Reflexion von Sinnbezügen in der Berufstätigkeit(Hans-Jürgen Balz)
Begleiten von Realisierungsschritten und Übergängen(Hans-Jürgen Balz)
Interviews mit Karrierecoaches(Peter Plöger)
Fazit(Hans-Jürgen Balz und Peter Plöger)
Ein Ende ohne Schlussstrich(Hans-Jürgen Balz und Peter Plöger)
Was wir leisten wollten und was offen bleiben musste
Der Karrierecoach als Unterstützer in existenziellen Fragen
Ein Schritt zu einem systemischen Trainingsprogramm zur Karriereentwicklung
Anhang: Instrumente für das Karrierecoaching und Materialien zur Selbstanalyse
Literatur
Index
Code für Download-Material
Vorwort
Es geht ums Positive, und das ist durchaus nicht ganz einfach.
Wenn Sie diese Zeilen des Vorworts lesen, denken Sie vermutlich, dass Sie ein Buch in der Hand halten. Dem möchte ich gleich zu Beginn eine andere Möglichkeit hinzufügen: Ich glaube, Sie halten mehrere Bücher in der Hand. Hans-Jürgen Balz und Peter Plöger haben sich nicht nur mit der Idee des Karrierecoachings auseinandergesetzt, sondern sie leisten viel mehr.
Bereits mit der Unterscheidung von Laufbahn und Karriere vollziehen die Autoren eine grandiose Wende – sie machen deutlich, dass es in der Arbeitswelt eben nicht mehr einfach läuft »wie immer«, sondern dass Veränderungen, Brüche, Neu- und Umorientierungen ablaufen. Und sie nutzen in diesem Buch – gewissermaßen in Buch 1 – Platz und Raum, um diese Änderungen zu beschreiben.
Der gesellschaftliche Rahmen, der ein traditionelles Verständnis von Beruf und Berufsrolle aushebelt, kann als Hintergrund für alles das dienen, was Balz und Plöger hinsichtlich des konkreten Vorgehens im systemischen Karrierecoaching vorstellen.
Coaching ist – daraus machen beide kein Hehl – ein Erfolgsmodell und das macht es umso dringlicher, keine Schnellschüsse oder Kurzausbildungen zu machen, sondern sich fundiert professionell zu orientieren. Genau das wird hier bereits von Beginn an deutlich gemacht.
In breitem Umfang legen Balz und Plöger dann – gewissermaßen in Buch 2 – ihre Auffassung einer systemischen Weltsicht offen. Das erscheint mir besonders erwähnenswert, da in der Darstellung systemischer Vorgehensweisen allzu oft vorausgesetzt wird, es gebe eine oder die systemische Sichtweise. Insofern laden Balz und Plöger dazu ein, sich selbst zu reflektieren, zuzustimmen, abzuwägen, zu anderen Beschreibungen zu kommen – und genau das spiegelt auch das Verständnis der Autoren wider.
Dabei wird nicht übergangen, dass in der Literatur einmal die Rede von systemischer Methode und einmal von systemischer Haltung ist – ein scheinbares Paradoxon, dem man/frau sich kaum entziehen kann. Das hat vor Dekaden Gregory Bateson (1984) überaus anschaulich pointiert: »Aber Erkenntnistheorie ist immer und unausweichlich persönlich. Der Sondierungspunkt liegt immer im Herzen des Forschers: Welches ist meine Antwort auf die Frage nach der Natur der Erkenntnis?« (S. 112).
Das ist nur einer von vielen Aspekten, die dieses Buch von anderen positiv unterscheiden. Ein weiterer bedeutsamer Punkt ist die Bevorzugung (oder sollte ich sagen Liebe?) von Balz und Plöger für lösungsorientierte Ideen als Teil einer systemischen Weltsicht. Darum geht es in Buch 3. Es geht ums Eingemachte, um die Praxis – um die so einfach klingende und schwer zu beantwortende Frage: Wie genau geht denn das nun?
Das, was für Balz und Plöger am bedeutsamsten scheint, (so verstehe ich sie, wenn ich mir bestimmte Äußerungen vergegenwärtige), finde ich in einem Zitat des Beitrages von Kirsten Dierolf ausgedrückt: »Die besten Coachingvoraussetzungen sind gegeben, wenn sowohl Klient oder Klientin als auch die Organisation das Coaching als Anerkennung und Wertschätzung des Klienten oder der Klientin wahrnehmen können.«
Und als Abrundung – gewissermaßen als Sahnehäubchen – kann der Beitrag von Kirsten Dierolf zur Praxis des Führungskräftecoachings und die Beschreibung der befragten Coaches zu ihrer Praxis und ihrem Selbstverständnis (zusammengefasste Interviews mit fünf Coaches) gesehen werden.
Mir bleibt nichts anderes, als Ihnen zu wünschen, die hier vorgetragenen Beschreibungen, Anregungen und Impulse wirken zu lassen und zur Verfeinerung des eigenen Handelns zu nutzen. Denn es geht immer darum, Ressourcen zu erkennen, zu finden und zu nutzen. In Übereinstimmung mit der Weltsicht von Balz und Plöger kann ich daher nur sagen: Sie werden Ihre Ressourcen nutzen.
Jürgen Hargens
Hans-Jürgen Balz und Peter Plöger
Berufslaufbahn als Lifestyle-Thema
»Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten,und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein könnten.«Johann Wolfgang von Goethe
In den Regalen der Buchhandlungen finden sich zahlreiche Bücher, in denen berufliche Erfahrungen und Erlebnisse aufgearbeitet werden. Diese anekdotischen Schilderungen regen häufig zum Schmunzeln an, schildern dabei jedoch auch persönliche Grenzerfahrungen betrieblicher Bedingungen und Arbeitsanforderungen. Hier reflektiert der ehemalige Chefredakteur Matthias Onken seine Erfahrungen auf dem Hintergrund einer zum Erfolg verurteilten Berufskaste (Onken, 2013). Dort kolportiert die Stewardess die Erlebnisse mit den Fluggästen und dem Flugpersonal (Poole u. Brandl, 2012). An anderer Stelle beschreibt die Verkäuferin »Szenenbilder aus der Welt der Supermärkte« (Sam u. Liebl, 2009, Einbandtext). Eine besondere Aufmerksamkeit fand das Buch von Holm Friebe und Sascha Lobo (2006) mit dem Titel »Wir nennen es Arbeit«. Darin beschreiben die Autoren anschaulich die Vision vom selbstbestimmten Arbeiten und zeitgemäßen Lebensstil der Pioniere der Generation Internet.
Die Beschreibungen neuer Berufswelten zwischen globalisierter Wissensgesellschaft, Lifestyle und Internet kontrastieren in zwei Extremen: Einerseits wird eine für den Einzelnen chancenreiche unternehmerische Selbständigkeit und Kreativität bei gleichzeitig maximaler persönlicher Autonomie beschrieben. Werbewirksam findet sich in den Medien und Internetforen das Bild junger Menschen, die in großen Loft-Wohnungen in EDV-Landschaften arbeiten und leben. Genauso gibt es aber andererseits das Bild von komischen, weil drastischen, von empörenden, weil unzumutbaren und von beängstigenden, weil unvorstellbaren Bedingungen, unter denen Menschen Menschen zur Erwerbsarbeit anhalten und dies als mögliches Arrangement zwischen ihnen bzw. ihrer Institution und den Arbeitnehmern1 ansehen. Günter Wallraff (2012) lieferte mit seinen Undercover-Studien hierfür beredte Beispiele.
Traditionelle Vorstellungen einer lebenslangen Bindung einer Person an einen Betrieb – wie sie die Wirtschaftswundergeneration hervorgebracht hat – sind längst Geschichte. Das aus den 1950er und 1960er Jahren stammende Verständnis einer Betriebstreue im Sinne von: einmal Krupp, immer Krupp, veränderte sich zu Gunsten einer freien Entscheidung in Abhängigkeit von lebensbiografischen Entwicklungen. Das Primat der meist männlichen Berufstätigkeit zur ökonomischen Existenzsicherung tritt zusehends zu Gunsten einer gemeinschaftlichen Verantwortung für das Familieneinkommen zurück. Wichtige Themen sind die Ausgestaltung von Arbeit und Privatheit (Work-Life-Balance), Fragen zur Gestaltung des psychologischen Vertrags zwischen Arbeitnehmer und Betrieb und die Weiterentwicklung der individuellen Qualifikation über die Berufsbiografie bei sich rasant wandelnden Arbeitsanforderungen.
Auf der Seite der Unternehmen hat der Kampf um die klugen Köpfe längst begonnen. In Anbetracht des demografischen Wandels wird in den nächsten Jahrzehnten ein zunehmender Fachkräftemangel prognostiziert. In zahlreichen Branchen werden Strategien zur Rekrutierung und zum Halten von Fach- und Führungskräften lebhaft diskutiert. In diesem Zusammenhang tauchen Familienfreundlichkeit, flache Hierarchien, Jahresarbeitskonten und nachhaltiges Wirtschaften als Werbebotschaften für junge Fach- und Führungskräfte auf.
So wie sich für den Einzelnen neue Optionen, aber auch komplexere Entscheidungsfragen in seiner Berufslaufbahn stellen (und so neue Tätigkeitsfelder für beratende Berufe eröffnen), so ist auch die traditionelle Laufbahnberatung gefordert, sich auf neue Fragen und Anforderungen einzustellen. Diese sind insbesondere:
–Wie kann die Integration von betrieblichen Qualifikationsanforderungen mit persönlichen Berufswegfragen, anderen familienbezogenen und individualbiografischen Themen gelingen?
–Wie lässt sich im Karrierecoaching die soziale Perspektive beruflicher Entscheidungsfragen angemessen berücksichtigen, das heißt, der Kraft der unsichtbaren familiären Bindungen einen Raum im Coaching geben (zum Beispiel dem Wunsch, »alte familiäre Zöpfe abzuschneiden«, der Ressourcenhaltigkeit familiärer Beziehungen oder dem Verhinderungspotenzial in den familiären Vermächtnissen)?
–Wie trägt der Karrierecoach in einer zunehmend dynamischen und entstrukturierten Arbeitswelt dem verstärkt bestehenden Orientierungs- und Sicherheitsbedürfnis seiner Klienten Rechnung?
–Wie ist der Tendenz zur Individualisierung der Berufs- und Karriereentscheidungen zu widerstehen, das heißt weder Allmacht-Phantasien Vorschub zu leisten (Tellerwäscher-Mythos) noch der gänzlichen Verantwortungslosigkeit (die Bedingungen sind so schlecht, dass ich keine Arbeitsstelle bekomme) im Sinne des Opfer-Mythos zu erliegen?
–Wie lässt sich die Wertschätzung gegenüber den Eigenbemühungen der Klienten in einem typischerweise informationsgeprägten und eher rationalen Dialog über Qualifikations- und Karrierewege transportieren?
Warum ein Buch zum systemischen Karrierecoaching?
Die Wirksamkeit systemischer Methoden ist für die Psychotherapie von Erwachsenen wie auch für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie nachgewiesen (Sydow, Beher, Retzlaff u. Schweitzer, 2007). Ihre vielfältige Anwendbarkeit und Kreativität ließ den systemischen Ansatz in weitere Praxisfelder ausstrahlen (Kinder- und Jugendhilfe, Sozialarbeit, Suchthilfe und andere). Dies führte zu zahlreichen Weiterentwicklungen der systemischen Interventionsmethoden, beispielsweise in der Supervision, im Mentoring, in der Organisationsberatung und im Coaching. Für das Coaching sind inzwischen mehrere systemische Bücher erschienen (Backhausen u. Thommen, 2006; Hargens, 2010; König u. Volmer, 2012; Radatz, 2010; Theuretzbacher u. Nemetschek, 2009; Tomaschek, 2009).
Das vorliegende Buch wählt den Schwerpunkt Berufslaufbahn und Karriere und trägt den Titel »Systemisches Karrierecoaching«: Karriere, weil die traditionelle Idee einer Laufbahn – sprachlich assoziiert mit der Beamtenlaufbahn – ein Zuviel an Planbarkeit, Kontinuität und Verlässlichkeit suggeriert. Auch wenn die Grenze zwischen Beratung und Coaching in der Literatur oft recht unscharf gezogen wird, entschieden wir uns für den Begriff Coaching, da es sich bei der unseren Ausführungen zugrunde liegenden methodischen Ausrichtung um eine zielorientierte und themenzentrierte Begleitung in einem berufsbiografischen Lern- und Selbstklärungsprozess handelt (zur Begriffsabgrenzung siehe »Ziele und Inhalte des Karrierecoachings«, S. 42 ff.).
Die Autoren stehen für eine enge Verbindung von systemischen und lösungsfokussierten Methoden. In diesem Schnittfeld finden wir für unsere Coachingpraxis eine produktive Methodenkombination, um den Beratungsprozess zukunftsorientiert und kooperativ zu gestalten. Hier bringen wir unsere Erfahrung und Expertise im Coaching, Training und in der Weiterbildung ein. Wir haben unsere Beiträge bei der Entstehung des Buches jeweils im Inhaltsverzeichnis kenntlich gemacht.
Warum ist systemisches Denken für das Karrierecoaching zeitgemäß und unverzichtbar?
Bei Fragen zur eigenen Berufsentwicklung begegnen sich mehrere oft konkurrierende soziale Systeme: Beruf und Familie, Berufsarbeit und Freizeitaktivitäten (zum Beispiel Hobbysport, Verein, politische Partei), Beruf und Öffentlichkeit (zum Beispiel Nachbarschaft, Freundeskreis) und Beruf, Volkswirtschaft und Arbeitsmarkt. Es stellt sich für den Einzelnen die Frage: Wie gehe ich mit den zwischen den verschiedenen Rollen und Systemen zum Teil widerstreitenden Zielen und Anforderungen um und wie integriere ich diese in einen kohärenten Lebensweg? Ähnliche Fragen mit strukturell vergleichbaren Widersprüchen und Dilemmata stehen im Mittelpunkt des systemischen Denkens bei der Arbeit mit Familiengenerationen, verschiedenen Helfersystemen und biografischen Übergängen.
Fragen der Ressourcenanalyse und -aktivierung bilden für die Berufswegentscheidung eine zentrale Aufgabe. Nur im Bewusstsein der individuellen und sozialen Ressourcen lässt sich eine tragfähige Entscheidung treffen. Systemische Praktiker zollen ihren Klienten tiefen Respekt für ihre Lebens- und (Problem-)Erfahrungswelt und interessieren sich intensiv für die in ihnen schlummernden Ziele, Ressourcen, Entwicklungen und Lösungsansätze. Eine methodische Basiskompetenz in systemisch-lösungsfokussierter Arbeit bietet Beratern die nötige Grundsicherheit effektiv und kompetent in einer Vielzahl von Beratungssituationen zu handeln.
Klienten zu ihren Ressourcen zu führen ist meist leichter gesagt als getan. Insbesondere gilt dies für Klienten mit geringen Veränderungserwartungen (zum Beispiel langzeiterwerbslose Menschen). Wirksame Methodenelemente stellen hier wertschätzende Kommentare zu den Beiträgen der Beteiligten, die Suche nach einem Rahmen, in dem das Verhalten der Einzelnen verstehbar ist (Methode der Umdeutung), und die Anregung von Kommunikation über die Beziehungen im System (Methode der zirkulären Fragen) dar.
Biografiearbeit: Ein weiterer Schwerpunkt im systemischen Ansatz liegt in der Beschäftigung mit dem biografischen Kontext und der Selbstbeschreibung der Klienten. Zur Analyse familiärer Wurzeln dient das Genogramm, eine Darstellungsform der Familienbeziehungen ähnlich einem Familienstammbaum. Dies ist besonders hilfreich zur Reflexion biografischer Fragen und lässt sich als berufliches Genogramm einsetzen, indem es mit Fragen der Verbindung zu bzw. Abgrenzung gegenüber familiären Berufsmustern verknüpft wird.
Aufstellungsarbeit und Beziehungsbrett: Zur Analyse bestehender und zur Anregung der (Neu-)Gestaltung von Familien-, Team- und anderen sozialen Strukturen tragen darstellende Verfahren bei. Sie geben oft einen klareren und erweiterten Blick auf Beziehungskonstellationen. Aufstellungs- und Skulpturarbeit sowie das Beziehungsbrett (abgewandelt von dem durch Kurt Ludewig entwickelten Familienbrett) erweisen sich bei der vertiefenden Analyse komplexer Beratungssituationen als hilfreich.
Erlebnisaktivierende Methoden: Selbstverstehen ist häufig auf andere als rein sprachliche Ausdruckswege angewiesen. Die Arbeit mit Metaphern (Bildern, Analogien und Symbolen) und mit Materialien fördert das ganzheitliche Verstehen und die Integration verschiedener Sinnesmodalitäten. Dadurch lassen sich ein tieferes Verstehen und eine Nachhaltigkeit der Veränderung fördern. Es gilt auch im Berufscoaching Kopf, Bauch und Hände zu integrieren.
Abschlussintervention: Am Ende einer Beratungsstunde gilt es, die Beiträge der Gesprächsteilnehmer zu würdigen, die Besprechungsergebnisse zu sichern und Anregungen für die Zeit bis zur nächsten Beratung mitzugeben. Dieser Abschlusskommentar – auf das Mailänder Team um Mara Selvini Palazzoli zurückgehend – kann im Karrierecoaching den Klienten zum Beobachten der eigenen Arbeitssituation, zum Nachdenken über eigene Anschauungen oder zum Ausprobieren neuer Verhaltensweisen anregen. Und dies frei nach dem Motto: Das Wesentliche findet zwischen den Coachingsitzungen statt.
Zur Struktur des Buches
Das Buch bietet zunächst einen grundlagen- und einen methodenorientierten Teil: In den nachfolgenden zwei Kapiteln »Die W-Fragen des Karrierecoachings« und »Gesellschaftliche und individuelle Antworten auf Berufswahl- und Karrierefragen« werden begriffliche und konzeptuelle Grundlagen von Coaching in Abgrenzung zu Supervision, Mentoring, Training und Psychotherapie behandelt. Auch umreißen wir die Zielsetzung und die methodische Ausrichtung des systemischen Karrierecoachings. Spezieller soll dann auf die beruflich-biografischen Übergangsprozesse, für die Karrierecoaching ein Unterstützungsangebot darstellt, eingegangen werden. Dies betrifft insbesondere den Übergang Schule-Beruf, das Outplacement (besser als Newplacement bezeichnet) und die Selbstorganisationsanforderungen im Karriereverlauf. Auch gilt es, sich mit traditionellen Berufswahltheorien auseinanderzusetzen und damit kontrastierend theoretische Grundsätze systemischer Arbeit abzuleiten. Das Kapitel »Menschenbild und Haltung im systemischen Karrierecoaching« schlägt die Brücke vom Konstruktivismus und von den systemtheoretischen Grundannahmen zu Fragen der Haltung des Coaches und zu Fragen des methodischen Arbeitens im Karrierecoaching.
Das Kapitel »Systemische Methoden im Karrierecoaching« führt komprimiert in systemische Methoden und deren Einbeziehung in die Gestaltung des Coachinggesprächs ein. Hier werden methodische Fragen der Ressourcenarbeit, des Einsatzes von Kommentaren, der Biografiearbeit und der Einbeziehung des sozialen Kontextes behandelt.
Im Kapitel »Führungskräftecoaching« stellt Kirsten Dierolf ihre lösungsfokussierte Arbeit im Führungskräftecoaching dar. Wir freuen uns darüber, dass wir sie für diesen Gastbeitrag gewinnen konnten und begrüßen ihre an konkreten Fallstudien veranschaulichten Ausführungen.
Mit dem Kapitel »Anwendungsfragen im Karrierecoaching« wollen wir im Anschluss in spezielle Teilfragen des Karrierecoaching eintauchen und unsere systemisch fundierten Antworten auf methodischer und konzeptioneller Ebene geben. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende drei Grundfragen: Wie ist beim Karrierecoaching mit Entscheidungsalternativen umzugehen? Wie ist hinsichtlich der Auseinandersetzung mit Begrenzungen, Sinnbezügen und dem Verhältnis von Beruf und Privatheit zu verfahren? Wie lässt sich die Begleitung in beruflichen Übergängen gestalten? Abschließend wollen wir noch systemische Coaches zu Wort kommen lassen. Sie werden zu ihren Erfahrungen mit systemischer Arbeit und zu ihren Lieblingsmethoden in der Coachingarbeit Stellung nehmen.
Das letzte Kapitel mit dem Titel »Ein Ende ohne Schlussstrich« verbindet einige thematische Fäden, gibt ein Resümee unserer Reise durch das Thema und stellt weiterführende Fragen.
Das im Anhang zusammengestellte Material »Coachinginstrumente und Materialien zur Selbstanalyse« steht zusätzlich als kostenloses Download-Material zur Verfügung. Den dafür benötigten Link und Zugangscode finden Sie auf S. 309 am Ende dieses Buchs.
Folgende Piktogramme am Rand erleichtern dem Leser die Orientierung. Sie ermöglichen es, die zugehörigen Textstellen, so zum Beispiel wichtige Definitionen, Fallbeispiele, Übungen oder Literaturhinweise, schnell aufzufinden:
Achtung. Markiert wichtige Merksätze.
Definition. Hier werden grundlegende Begriffe und theoretische Ansätze und Zugänge erläutert.
Methodenbeschreibung. Markiert Beschreibungen von Methoden, Techniken und Anwendungsmodellen, die für das systemische Karrierecoaching wichtig sind. Ein Teil der Markierungen verweist auf Methodenbeschreibungen des Anhangs.
Fallbeispiel. Macht die theoretischen Ausführungen veranschaulichende und unterstützende Fallbeispiele, die zum einen aus unserer eigenen Praxis, zum anderen aus der Praxis befreundeter Kollegen stammen, kenntlich. Die markierten Fallbeispiele enthalten zum Teil bereits Kommentierungen von uns im Hinblick auf das, was sie veranschaulichen.
Übung. Markiert Vorschläge für Übungen, die zum einen der Schulung des Coaches dienen und zum anderen für den Einsatz im konkreten Karrierecoaching mit dem Klienten gedacht sind. Ein Teil der Markierungen verweist auf die im Anhang zusammengestellten Instrumente und Übungen.
Literatur. Empfehlungen zu weiterführender Literatur zu den wesentlichen Themen der einzelnen Hauptkapitel, auf die jeweils am Ende jedes Kapitels hingewiesen wird.
An wen richtet sich das Buch?
Das Buch ist für Kollegen in der Berufs- und Laufbahnberatung, in Personalverantwortung wie auch in der Arbeit mit Erwerbslosen und im Outplacement geschrieben. Zielgruppe sind insbesondere Berufs- und Karriereberater, Ausbilder, Berufsbegleiter, Outplacement-Berater und Personalentwickler. Daneben sprechen wir Studierende von betriebswirtschaftlichen, wirtschaftspädagogischen und arbeitspsychologischen Bachelor- und Master-Studiengängen an sowie Weiterbildungsteilnehmer in ihrem Interesse an systemischen Methoden für die Karriereberatung und Personalentwicklung.
Abschließendes und Nicht-Abschließendes
Wir möchten nicht auf den Hinweis verzichten, dass dieses Buch von vielfältigen Anregungen und Inspirationen befruchtet ist. Wir versuchen im Sinne der wissenschaftlichen Redlichkeit alle Quellen zu nennen. Dennoch können wir nicht verhindern, dass einzelne Ideen sich nicht mehr bis zu ihren Wurzeln zurückverfolgen lassen und ihre Ursprünge von uns ungenannt bleiben. In diesem Sinne möchten wir uns bei den vielen Kollegen, Weiterbildungsteilnehmern, Coachees, Supervisanden sowie Freunden herzlich bedanken, aber gleichzeitig um Nachsicht bitten, wenn sie sich hier wiederfinden, ohne genannt zu werden. Nur in einer großen Vielfalt der Ansichten, Arbeitsweisen und der langjährigen eigenen Praxis konnte dieses Buch entstehen.
Für die Mitarbeit an der Entstehung des Buches möchten wir herzlich danken: Günter Presting, Bereichsleiter Psychologie, und Imke Heuer vom Verlag Vandenhoeck & Ruprecht für ihre Geduld und fachliche Begleitung, Silke Strupat für die sorgfältige Korrektur des endgültigen Manuskripts, Frederic Linßen vom Institut für Lösungsfokussierte Kommunikation (ILK-Bielefeld) und Manfred Froböse (Arbeitsagentur Herford) für ihre Anregungen zum Manuskript, den Karrierecoaches, die sich für die Interviews bereit erklärten, Hanna Tuchowski und Tabea von Küngelen für die Unterstützung bei der Manuskripterstellung.
1Im Weiteren wird zum Zweck der leichteren Lesbarkeit zumeist die männliche Form (Coach, Berater, Klient usw.) gewählt. In jedem Fall sind dabei beide Geschlechter gemeint.
Hans-Jürgen Balz und Peter Plöger
Die W-Fragen des Karrierecoachings
»Wenn du immer an die Hand genommen wirst,hast du nur noch eine Hand frei.«Volkmar Frank
Arbeit hat sich verändert. Arbeit verändert sich laufend, sie ist wie alles andere auch Teil des historischen Wandels. In den zurückliegenden Jahrzehnten hat sie sich aber auf eine Art und Weise gewandelt, die auffällig ist und zu öffentlichen Diskussionen herausfordert (Kaudelka u. Kilger, 2010). Der Arbeitsmarkt hat in den vergangenen zwanzig Jahren ein Auf und Ab erlebt. Die Hartz-Reformen fallen in diese Zeit, von denen einige sagen, sie stünden für einen Abbau des Sozialstaates (Lessenich, 2008). Das Stichwort der prekären Arbeit kam auf (siehe exemplarisch Götz u. Lemberger, 2009). Seither sind Leiharbeit oder Transfergesellschaft in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Arbeit ist unsicherer geworden, aber auch offener. Die klaren Perspektiven von einst (nach der Lehre der Job bis zur Rente) sind seltener geworden, die neuen Ideen, wie eine erfolgreiche Berufslaufbahn zu gestalten sei, haben sich vermehrt (Plöger, 2010a). Der aktuelle Wandel hat zu manchen Klagen geführt, zu sozialen Verschiebungen, hier und da sogar zu neuer Not, aber auch zu neuen Chancen und zu einem konstruktiven Hinterfragen dessen, was Arbeit eigentlich ist und für uns sein soll.
Dieser Wandel kann demgemäß auch Berater nicht kalt lassen, die sich mit Arbeit, Berufslaufbahnen und Karrieren befassen. Heute muss, wer Karrierecoaching betreibt, hinterfragen: seinen Begriff von guter Arbeit, seine Vorstellungen einer Berufslaufbahn, letztlich sich selbst und sein Bild der Arbeitswelt. Unser Buch will dabei helfen, dies auf konstruktive Weise zu tun. Die Aufgabe des Beratens soll erleichtert und Orientierung für diejenigen geschaffen werden, die anderen Orientierung geben sollen – was nicht leichter geworden ist in der aktuellen Arbeitswelt.
Aus unserer Sicht ist es für die Orientierung der Coaches (Orientierer) wichtig, vier W-Fragen des Karrierecoachings im Auge zu behalten:
–Worin bestehen die neuen Herausforderungen an das Karrierecoaching? Was ist ihr Hintergrund? Dazu ist es wichtig, sich den aktuellen Wandel der Arbeitswelt und seine Folgen für die berufliche und lebensgestalterische Orientierung der Arbeitenden differenziert anzusehen (siehe die Unterkapitel »Neue Laufbahnorientierungen« S. 35 ff. und »Berufliche Selbstmanagementanforderungen« S. 38 ff.). Hier geht es um den historischen und gesellschaftlichen Rahmen des Karrierecoachings.
–Was ist mit Karriere eigentlich gemeint, was mit Beratung und Coaching? Vor welchen Aufgaben stehen Berater und Coaches mit ihrer Ausrichtung auf die berufliche Beratung (siehe die Unterkapitel »Ziele und Inhalte des Karrierecoachings« S. 42 ff., »Organisationsexterner und -interner Zugang des Coaches im Karrierecoaching« S. 56 ff. sowie das diesem nachfolgende Kapitel »Gesellschaftliche und individuelle Antworten auf Berufswahl- und Karrierefragen« S. 64 ff.)? Hier geht es um das Setting des Karrierecoachings.
–Wozu machen Berater Karrierecoaching? Was kann Karrierecoaching bei seinen Klienten erreichen (wollen)? Diese Frage ist für uns eng verknüpft mit der grundsätzlichen Haltung der Berater zu ihren Klienten. Die systemische Beratung zeichnet eine sehr spezifische, menschenfreundliche Idee von Menschen aus, die sich in der Einstellung gegenüber den Klienten niederschlägt. Wir behandeln die Frage nach dem Wozu im Kapitel »Menschenbild und Haltung im systemischen Karrierecoaching« (S. 105 ff.), wo es um die Grundhaltung des systemischen Karrierecoachings geht.
–Wie sieht ein systemisches Karrierecoaching aus? Was tut ein systemischer Berater im Feld der beruflichen Beratung praktisch anderes als seine (nicht-systemisch beratenden) Kollegen? Dieser Frage wenden wir uns in den Kapiteln, »Systemische Methoden im Karrierecoaching« (S. 127 ff.), »Führungskräftecoaching« (S. 173 ff.) und »Anwendungsfragen im Karrierecoaching« (S. 188 ff.) zu, in denen es um die Methoden und Praxis des systemischen Karrierecoachings geht, und die einen wesentlichen Teil des Buches ausmachen.
Diese vier W-Fragen werden nicht nur durch das Buch leiten, sie sollen darüber hinaus Eckpfeiler auf dem Weg sein, das systemische Karrierecoaching von seinen Hintergründen über seine gedanklichen Grundlagen bis hin zu seiner Praxis kennenzulernen.
Peter Plöger
Wandel der Arbeitswelt
Um den Wandel der Arbeitswelt nachzuvollziehen, wollen wir den Blick auf die wichtigsten Akteure lenken, die diesen Wandel beeinflussen und von ihm beeinflusst werden. Sicher steht für den Berater das arbeitende Individuum im Vordergrund. Die Arbeitswelt lässt sich jedoch nicht ohne die Beteiligung der Unternehmen und des Staates verstehen. Deshalb gehen wir im Folgenden zuerst sehr knapp auf deren Rolle ein, bevor wir uns ausführlicher der Perspektive des Einzelnen zuwenden. Zusammengenommen bündeln alle drei Perspektiven ein erstes Bild der für das Karrierecoaching wichtigen Momente des Wandels der Arbeitswelt.
Die Perspektive der Unternehmen
Der globale Wandel hat auch die Unternehmen verändert. Die Vielfalt der Unternehmen, ihrer internen Organisation, ihrer Personalstrategien und ihres Verhältnisses zu den Arbeitnehmern ist nach wie vor viel zu groß für generalisierende Aussagen. Es lassen sich jedoch einige Hauptströmungen der Veränderungen ausmachen, die als Hintergrund des Karrierecoachings von Bedeutung sind.
Galt früher die langfristige Bindung der Arbeitskräfte an ihre Unternehmen als Standard, sind die Modelle der Arbeitskräftebindung inzwischen durchlässiger geworden. Arbeitgeber, die an einem anpassungsfähigen Personalstamm interessiert sind, greifen nunmehr häufiger auf ein Zwiebelschalenmodell (Plöger, 2010a, S. 137 ff.) zurück: Ein harter Kern gelernter Arbeitskräfte bildet den langfristig gebundenen Personalgrundstock. Eine innere Hülle rundherum ergänzt diesen, sie besteht aus flexibler gebundenen Kräften (Arbeitnehmer mit Teilzeit- oder befristeten Verträgen). Eine nur noch locker aufgelegte, äußere Hülle aus beispielsweise Leiharbeitern, Teilzeit- oder Honorarkräften dient zur Abdeckung von Bedarfsspitzen oder speziellen, inhaltlich begrenzten Aufgaben.
Dieses Zwiebelschalenmodell ist aus Unternehmenssicht höchst plausibel, da es einen merkbaren Flexibilitätszuwachs bedeutet (Gottschall u. Henninger, 2005, S. 164; Reichwald et al., 2004, S. 2 f.). Für die Arbeitnehmer zieht es jedoch die subjektiv wahrgenommene Gefahr nach sich, in die volatile Randzone abgedrängt zu werden – was zum Teil auch real passiert, wie die zeitweise Zunahme der Leiharbeit und anderer sogenannter untypischer Arbeitsverhältnisse zeigt. Die Bindung zum Arbeitgeber ist aus Sicht der Arbeitenden weniger zuverlässig geworden. Das ist im Vergleich zu der langen wirtschaftlichen Aufschwung- und Wachstumsphase innerhalb des letzten Jahrhunderts, die noch den meisten im Gedächtnis verblieben ist, deutlich zu spüren. Damals verbanden die Mitarbeiter insbesondere großer Unternehmen ihre beruflichen (Laufbahn-)Planungen lebenslang mit ihrem Betrieb (Weinert, 1998, S. 24 ff.). Dieses Modell stellte einen beiderseitig vorteilhaften Tausch dar. Im Zwiebelschalenmodell werden diese Bindungen nun unverbindlicher, die berufliche Zukunft für die Werktätigen daher unberechenbarer. Es gilt ein anderer psychologischer Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Greenhaus, Callanan u. Godshalk, 2010, S. 6; Lang-von Wins u. Triebel, 2012, S. 18 f.). Der Arbeitnehmer wird damit immer mehr zu einem Vertragspartner, das Verhältnis zu einem kontraktuellen mit wenig gegenseitiger Loyalität im Sinne einer gemeinsamen Identität (Wir sind alle Opelaner).
Für den Arbeitnehmer bedeutet das: Er muss sich mehr und mehr mit der Rolle des Organisators seiner eigenen Arbeit anfreunden. Er muss nicht nur eine vereinbarte Arbeitsleistung erbringen, sondern auch (von Zeit zu Zeit) neue Erwerbsmöglichkeiten akquirieren, für die Erhaltung seiner Arbeitskraft sorgen (sich weiterbilden zum Beispiel) und sich als potenzieller Vertragspartner attraktiv halten. Er rückt dem immer näher, was die beiden Soziologen Günter Voß und Hans Pongratz (1998) treffend »Arbeitskraftunternehmer« nennen. Das bedeutet: Er ist genötigt, Risiken und Chancen in der eigenen Berufsbiografie in einem fortlaufenden Prozess zu managen und muss wahrnehmungsfähig für sich bietende berufliche Perspektiven sein. »Als kennzeichnend für den neuen Arbeitskräftetypus gelten der Abbau der Fremdkontrolle zugunsten der Betonung der Selbstkontrolle, verbunden mit erweitertem Handlungsspielraum und größerer Eigenverantwortung« (Georg u. Sattler, 2006, S. 146). Als Karrierecoach ist diese neue, tendenziell unternehmerische Rolle der Berufstätigen besonders zu beachten.
Eine weitere wichtige Veränderung des Arbeitskräfteangebots ergibt sich aus dem demografischen Wandel, das heißt, dass den in den Ruhestand übergehenden Personen nicht die gleiche Anzahl von Jugendlichen, die in das Arbeitsleben übergehen, gegenüberstehen. In den Jahren 2012 bis 2025 scheiden nach einer Prognose des Bundesinstituts für Berufliche Bildung und des Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 10,5 Millionen Personen mit Berufsausbildung aus dem Erwerbsleben aus. Dem stehen nur 7,5 Millionen Zugänge gegenüber (Maier, Zika, Wolter, Kalinowski u. Helmrich, 2014). Hier schlussfolgern wir, dass die Einbeziehung weiterer Personengruppen in das duale Ausbildungssystem (zum Beispiel die Einbeziehung von benachteiligten Jugendlichen oder Studienabbrechern) dringend geboten ist, um dem drohenden Fachkräftemangel zu begegnen.
In der öffentlichen Diskussion finden wir häufig die Schlagwörter »Flexibilisierung der Marktstrategien«, »Internationalisierung der Geschäftsbeziehungen«, »Innovationsdruck« und »Gewinnorientierung«. Diese unternehmerischen Erfordernisse sind jedoch in einigen Feldern besonders stark vertreten (zum Beispiel in der EDV der Elektronischen Industrie und den informationstechnologischen Unternehmen). Im traditionellen Handwerk sind in einigen Feldern (zum Beispiel bei der Haustechnik) starke Innovationsschübe zu finden, andere Felder sind jedoch weiterhin stark von tradierter Handwerkstechnik geprägt und auf regionale Märkte konzentriert. Im Sozialsektor wiederum zeichnet sich zum einen ein verschärfter Wettbewerb zwischen den Anbietern und zum anderen eine fortschreitende Ökonomisierung der Arbeitsprinzipien (zum Beispiel in Dienstleistungsverträgen) ab. All diese Dinge haben Einfluss auf die Arbeitsfelder und die Anliegen der Klientel von Karrierecoaches.
Die Perspektive von Gesellschaft und Staat
Der Gesetzgeber hat in der jüngsten Zeit zum Wandel der Arbeitswelt entscheidend beigetragen. Auf europäischer Ebene ist die Freizügigkeit des Arbeitsplatzes erweitert worden, sodass die Möglichkeit zur Jobmobilität erheblich größer ist. Die Berufsausbildung auf akademischem Niveau wurde durch die sogenannten Bologna-Reformen vereinheitlicht, beschleunigt und internationalen Standards angenähert (ob zum Vor- oder Nachteil für die Studierenden, sei dahingestellt).
Die spürbarsten Veränderungen traten in Deutschland jedoch mit den Arbeitsmarkt- und Sozialreformen Anfang der 2000er Jahre mit den sogenannten Hartz-Reformen ein. Sie setzten nicht nur neue Instrumente der Arbeitsvermittlung ein (Jobcenter, private Vermittler, Umstrukturierung der Arbeits- und Sozialämter), sie brachten im Endergebnis auch einen neuen Geist und einen veränderten Auftrag in die staatliche Sozialfürsorge ein. Das neue Motto hieß nun »Fördern und Fordern« und wurde von vielen als das heimliche Zugeständnis kritisiert, der Staat wolle sich von seiner Rolle als Versorger zurückziehen. Stephan Lessenich (2008) etwa spricht von einer »aktivierenden Wende« in der Sozialpolitik, die beinhalte, dass jeder Einzelne nun verstärkt in die erweiterte Übernahme von Eigenverantwortung bewegt werden solle, während der Staat sich von bis dato noch bestehenden Verantwortungen der sozialen Sicherung frei mache (S. 77).
Im englischen Sprachgebrauch hat sich für diese Wende zur Selbstverantwortung das Schlagwort des »turn from welfare to workfare« eingebürgert. Sie verändert die Lebenschancen der auf Lohneinkommen Angewiesenen nachhaltig. »Gesellschaftliche Teilhabe ist mithin nicht länger von außen, durch ›die umstandslose Sicherung von Einkommen‹ (Schulze-Böing, 2000, S. 55), zu gewährleisten, sondern hat vermittelt über die eigenverantwortliche, aktive Bemühung um Teilnahme am Erwerbsleben zu erfolgen« (S. 89). Es gibt folglich keine staatliche Sicherung des privaten Status quo mehr (wie sie faktisch für die meisten Erwerbstätigen einmal bestanden hat). Mit den Reformen wurde »vom Prinzip der Statussicherung auf das der totalen Mobilisierung umgestellt« (Bude, 2008, S. 27 f.).
Der Staat reagiert damit auf eine schleichende Krise der kapitalistischen Ordnung. Ein ausreichendes Einkommen durch Lohnarbeit kann auf dem in Deutschland gewohnten Niveau offenbar nicht länger sichergestellt werden. Darauf weisen unter anderem die steigenden Zahlen in den Statistiken über untypische Arbeitsverhältnisse hin. Typisch ist ihnen gegenüber das sogenannte Normalarbeitsverhältnis: »Als Normalarbeitsverhältnis gilt ein Beschäftigungsverhältnis dann, wenn es auf einem auf Dauer angelegten Arbeitsvertrag, einem festen, an Vollzeitbeschäftigung orientierten Arbeitszeitmuster, einem tariflich normierten Lohn und Gehalt, der Sozialversicherungspflicht sowie der persönlichen Abhängigkeit und Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber basiert« (Bellmann et al., 2006, S. 26).
Das Normalarbeitsverhältnis ist allerdings immer weniger geeignet, die Realität der Erwerbstätigen zu beschreiben. Das zeigt sich bereits vor Eintritt in die Berufstätigkeit. Die Normalbiografie von Jugendlichen ließ sich ursprünglich in einem »Zwei-Schwellen-Modell« (Mertens u. Parmentier, 1982) abbilden. Dabei stellte die erste Schwelle den Übergang von der Schule in eine berufliche Qualifizierung (in Betrieb, Fach- oder Hochschule) und die zweite Schwelle den Übergang nach der Ausbildung oder dem Studium in ein Beschäftigungsverhältnis dar. Der langjährige Mangel an Lehrstellen hat zur Entstehung eines Übergangssystems an der ersten Schwelle geführt, das die zahlreichen und vielfältigen Lehrgänge und Maßnahmen umfasst, die zur Verbesserung der persönlichen Voraussetzungen und der Arbeitsmarktchancen beitragen sollen. Auch die zweite Schwelle des Übergangs in eine dauerhafte Beschäftigung stellt für junge Erwachsene branchenspezifisch und in Abhängigkeit vom Schul- bzw. Ausbildungsniveau ein zusätzliches Arbeitsmarktrisiko dar. Dies betrifft insbesondere den Bereich der klein- und mittelständigen Dienstleistungsbetrieben, in denen über die Hälfte der Ausbildungsabsolventen wegen fehlender Übernahme durch den Betrieb mit der Suche eines neuen Arbeitgebers konfrontiert werden (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2014, S. 114). Der Weg aus der Schule in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis hat sich für zahlreiche Jugendliche zeitlich verlängert und ist durch verschiedenartige Hürden und Zwischenstationen gekennzeichnet.
Komplexer ist darüber hinaus die Situation auf dem Arbeitsmarkt geworden – dank der erwähnten untypischen Arbeitsverhältnisse. Dazu zählen in erster Linie alle Arten der befristeten Beschäftigung, so unter anderem Teilzeitbeschäftigung, Leiharbeit und Kleinselbständigkeit. Diese haben in den Jahren nach den Reformen eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. »So nehmen Formen von freier Mitarbeit, Subunternehmertum, Tele- und Heimarbeit oder auch von Nebenerwerbsselbständigkeit zu« (Leicht u. Philipp, 2005, S. 135). Zwar bleibt das Normalarbeitsverhältnis die häufigste Form, die untypischen Arbeitsverhältnisse haben jedoch an Bedeutung gewonnen (Bellmann et al., 2006; Bude, 2000, S. 125 f.). Dass sie in vielerlei Hinsicht gegenüber dem Normalarbeitsverhältnis für Erwerbstätige Nachteile bereithalten, veranschaulicht Tabelle 1.
Tabelle 1: Vergleich untypischer Arbeitsverhältnisse mit dem Normalarbeitsverhältnis (NAV) (aus: Plöger, 2010a, S. 126)
In Tabelle 1 nicht enthalten sind die Klein- bzw. Soloselbständigen, also alle Selbständigen, die keine weiteren Mitarbeiter haben. Ihre Zahl ist insbesondere zwischen 2000 und 2005 stark angewachsen und steigt weiter – nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, was für einen allgemeinen Trend der Neuentwicklung und Verschiebung von Erwerbsmodellen von der abhängigen Beschäftigung hin zur Selbständigkeit spricht (Plöger, 2010a, S. 118 ff.; Schulze Buschoff, 2007). Inzwischen sind in Deutschland etwa 2,6 Millionen Personen soloselbständig, was einem Anteil an allen Selbständigen von 57,1 % entspricht (EU: 71,1 %). In Deutschland sind darunter auffällig viele Akademiker und andere Hochqualifizierte zu finden (Zahlen nach DIW-Studie: Brenke, 2013).
Gerade die Soloselbständigen stehen exemplarisch für den Typus von Erwerbstätigen, der einesteils gemäß der staatlichen Reformprogramme nachgerade gewünscht ist, andererseits die von den Mahnern kritisierte Prekarität der Arbeit wie kein anderer widerspiegelt, drittens für den Einzelnen die meisten Chancen bereithält – sofern er oder sie die notwendigen persönlichen Voraussetzungen dafür bereithält. Es ist ein Typus, der absehbar auch die Karriereberater in Zukunft am meisten beschäftigt halten wird.
Die Perspektive des Individuums
Sind Berufe noch Berufe? ‒ Für den einzelnen Erwerbstätigen hat sich in der Arbeitswelt innerhalb einer recht kurzen Zeit vieles verändert. Der allgemeine gesellschaftliche Wandel, die veränderten Strategien der Unternehmen und die Reformen durch den Gesetzgeber haben spürbare Konsequenzen für die individuellen Berufsperspektiven. Für manch einen ist Arbeit unsicher geworden, es fehlt an Perspektiven und an Orientierung. Andere sehen zwar ebenfalls das Wegfallen alter Sicherheiten, begrüßen jedoch einen Zugewinn an Selbständigkeit und Offenheit in der Gestaltung ihrer eigenen Berufswege. Die Veränderungen sind vielfältig – ihre Deutungen sind es auch.
Es ist aufgrund dieser Vielfalt nicht einfach, allgemeine Hinweise darauf zu geben, auf welche Neuerungen Berater besonders Acht geben sollten, wenn sie ein zeitgemäßes Karrierecoaching anbieten wollen. Ein bemerkenswerter Punkt ist zugleich der pauschalste: Es ist eben der, dass Berufsorientierungen sich vervielfältigt haben. Das klassische Normalarbeitsverhältnis, an dem sich einmal vieles ausgerichtet hat, ist nicht länger das Nonplusultra des Jobcoachings. Einen massentauglichen Standard, wie es der gelernte Arbeiter bzw. Angestellte mit unbefristetem Vertrag (wenn möglich in einem einzigen Unternehmen) und moderaten Aufstiegschancen war, kann man heute nur noch schwerlich in Anschlag bringen, um das Verhalten der Berufstätigen zu beschreiben. Der »Organization Man« – wie der Journalist William H. Whyte (1956) ihn nannte – wird allmählich durch einen anderen Typus von Erwerbstätigem abgelöst, einen mit mehr Eigenverantwortung und weniger Bindung an einen Ort oder Arbeitgeber.
Kaum auf der Bühne der Sozialtypen angelangt, wird der selbstbestimmte Erwerbstätige auch schon als leuchtendes Vorbild gefeiert. Die USA sind bereits zur »Free agent nation« erhoben worden (Pink, 2001). Und in Deutschland sehen einzelne Autoren die »Meconomy« im Kommen (Albers, 2009). Demnach heißt das neue Motto nun: »Tu, was du liebst, […] dann wirst du keinen Tag deines Lebens arbeiten« und das Leben »wird zu einem Baukasten der Möglichkeiten«, in dem »wir uns genau jene Teile zusammensetzen, die zu uns passen« (S. 13). Die Wirtschaftskrise von 2008/2009 befeuerte die Hoffnungen darauf, dass sich dieses Wunschbild in Wirklichkeit verwandeln würde. Ob dies jemals eintritt – oder überhaupt wünschenswert ist – sei dahingestellt. Bemerkenswert ist allemal, dass die Visionen in einer Klarheit formuliert sind, die suggeriert, dass die Gestalt der neuen Arbeitswelt bereits feststünde und nur noch von den Erwerbstätigen mit Leben gefüllt werden müsste. Das ist irreführend. Die Arbeitswelt ist im Wandel, und niemand weiß genau, wohin sie sich schließlich bewegen wird. Richtungen kann man erkennen, gesicherte zukünftige Realitäten nicht.
Sogar das grundlegende Vokabular ist in Bewegung geraten. Es ist inzwischen beispielsweise nicht mehr ganz klar, was überhaupt ein Beruf ist. Welche Kriterien soll man ansetzen, wenn man die Frage gestellt bekommt, welchen Beruf man hat? Eine einschlägige Ausbildung? Anerkennung per Zertifikat? Regelmäßige Entlohnung für die betreffende Tätigkeit? Langjährige Erfahrung? Oder alles zusammen? Was ist dann mit den Multijobbern, den Arbeitssammlern oder den Umgeschulten?
Einer von uns, Peter Plöger, ist selbst auf mehreren Feldern beruflich tätig: Er ist Autor mehrerer Sachbücher in einem renommierten Verlag. Daneben ist er freiberuflich als Coach tätig und arbeitet – ebenfalls freiberuflich – für Organisationen, Bildungsträger und Unternehmen als Trainer. Alle drei Tätigkeiten sind anerkannte Berufe. Welcher aber ist Plögers Beruf? Um die Sache noch komplexer zu machen: Zweimal im Jahr arbeitet er für einen öffentlichen Träger in theaterpädagogischen Projekten mit Kindern. Ist das ein vierter Beruf? Plöger hat seit 15 Jahren Erfahrung mit theaterpädagogischen Projekten für Kinder, aber keine formale Ausbildung dafür. Er ist nur einen Bruchteil des Jahres in diesem Bereich tätig, in diesen Wochen aber Vollzeit mit der entsprechenden Bezahlung. Sein Auftraggeber ist ein großer deutscher Wohlfahrtsverband. Kurzum: Zu einem Beruf im traditionellen Sinne fehlen einige Merkmale, andere sind vorhanden. Es ist nicht einfach zu sagen, um was es sich bei der Tätigkeit handelt, wenn man einen strengen Kriterienkatalog anlegen wollte. Plöger behilft sich damit, eigene Kriterien anzusetzen, und spricht tatsächlich von einem Nebenberuf.
Die (vorläufige) Offenheit selbst grundlegender Begriffe kennzeichnet die augenblickliche Situation der Arbeitswelt. Sie ist typisch für Zeiten des Übergangs. So sind auch die übergreifenden Schlagworte, mit denen der Übergang global beschrieben werden soll, eher bildlich zu verstehen. Whytes »Organization Man« muss man als eine Annäherung an die Realität der Vielen verstehen, als einen Archetypen, der etwas abstrahiert, was ansonsten zu unübersichtlich für eine Beschreibung wäre. Genauso ist es gemeint, wenn wir hier davon sprechen, der »Organization Man« träte allmählich zurück zu Gunsten des neuen Leitbildes des Selbstunternehmers. Dieses Leitbild entspricht sicher nicht der Lebenswirklichkeit aller Erwerbstätigen, es markiert jedoch ein zeitgemäßes Ideal, das von den Unternehmen zunehmend gewünscht wird, vom Staat teilweise gefördert wird und von einer steigenden Zahl von Erwerbstätigen (aus unterschiedlichen Gründen) faktisch verfolgt wird (Bröckling, 2007; Plöger, 2010a). »Das unternehmerische Selbst«, schreibt der Soziologe Ulrich Bröckling, »bezeichnet […] die Weise, in der Individuen als Personen adressiert werden, und zugleich die Richtung, in der sie verändert werden und sich verändern sollen« (2007, S. 46). Und die Richtung ist klar, sie geht hin zu »gesteigerter Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisierung« (S. 49).
Was zeichnet nun einen Selbstunternehmer aus? Heute werden von einem Arbeitnehmer immer häufiger und immer intensiver Qualitäten erwartet, wie sie erfolgreiche Soloselbständige oder Kleinunternehmer mitbringen (bei den bereits selbständig Tätigen werden diese Qualitäten ohnehin vorausgesetzt). Wie deren berufliche Praxis aussieht, können wir am Fallbeispiel von Christine2 erläutern.
Christine
Christine arbeitet parallel auf drei verschiedenen Tätigkeitsfeldern: als Designerin für Webseiten, als Angestellte in einem öffentlichen Rundfunksender und als Reiseleiterin. Sie tut das in zwei Beschäftigungsarten: angestellt und als Freiberuflerin. Einen formalen Abschluss hat sie lediglich als Webdesignerin. Sie hat Mitte der 1990er Jahre nach einem Lehramtsstudium eine Maßnahme des Arbeitsamtes mitgemacht, in der sie sich zur Webdesignerin umschulen ließ. (Das Arbeitsamt hat seine Fortbildungen und Umschulungen damals häufig im Bereich »Web und neue Medien« angeboten.) Christine nutzte die Neuqualifikation optimal aus. Sie machte sich erfolgreich selbständig in ihrem neuen Arbeitsfeld. Zusätzlich ergatterte sie die Chance, als Grafikerin für einen großen Sender zu arbeiten. Dort wird sie immer wieder in Teilzeit befristet angestellt. Manchmal bekommt sie sogar Verträge für ein ganzes Jahr. Ihre Arbeitswoche teilt sie dann auf zwischen dem Redaktionsbüro und dem eigenen Homeoffice, wo sie die Aufträge ihrer privaten Kunden erledigt. Im Sommer ist sie außerdem für einen ganzen Monat in Italien. Weil sie fließend Italienisch spricht, kann sie dort für deutsche Touristen geleitete Reisetouren anbieten und bringt den Interessierten das regionale Essen, die Weine und die italienische Renaissance nahe.
Christine verfolgt also eine Strategie der Jobdispersion: Sie verteilt ihre Anstrengungen auf drei unterschiedliche Felder, statt sich auf einen fest umrissenen Beruf zu konzentrieren. Selbstredend stellt diese Art des Parallelarbeitens größere Herausforderungen an die Organisation der eigenen Arbeitszeit und an die Logistik der Tätigkeiten. Parallel arbeiten heißt, mehrere zum Teil miteinander konfligierende Anforderungen immer wieder aufs Neue in Balance zu bringen. Christine kann sich außerdem – außer in der Redaktion, wo sie angestellt arbeitet – nie zurücklehnen und darauf warten, dass ihr jemand Arbeit gibt. Sie muss ihre Kunden selbst akquirieren, darf darin auch nicht nachlassen, denn Stammkunden hat sie noch zu wenige. Wenn sie morgen auch noch Kunden haben will, muss sie heute neben ihrer Kerntätigkeit, dem Designen, immer auch Akquise betreiben. Die freiberufliche Auftragstätigkeit muss sie überdies mit den Zeiten vereinbaren, in denen sie Dienst in der Redaktion hat. Wenn der Sommer naht, muss sie sich auf die Reisetouren vorbereiten. Einen guten Teil ihrer Zeit verbringt sie also mit organisatorischen Aufgaben, die neben ihren Kerntätigkeiten herlaufen müssen.
Die Selbstorganisation der Arbeit ist charakteristisch für den Typus des Selbstunternehmers. Dieser Typus beschränkt sich nicht auf die Beschäftigungsform, von der man es am ehesten erwarten würde: die Selbständigkeit. Sie betrifft genau so die angestellten Arbeitnehmer und die wachsende Zahl derjenigen, die sich in einer Grauzone zwischen Anstellung und Selbständigkeit bewegen. Indem er sich dem Selbstunternehmer annähert, hört der Arbeitnehmer auf, Arbeitnehmer zu sein, und ist gleichzeitig Leistungsanbieter und Organisator. Selbständige Leistungen werden zunehmend auch vom Arbeitnehmer gefordert. Die Planung und Strukturierung von Arbeitsprozessen wird ihm überantwortet – zusätzlich zu seiner Kerntätigkeit. Das gilt vermehrt auch für Arbeitnehmer in Unternehmen oder im öffentlichen Dienst: Formal bleiben sie Weisungsempfänger, de facto leisten sie jedoch einen Teil des Managements ihrer Arbeit mit. Voß und Pongratz (1998) sprechen daher von »fremdorganisierter Selbstorganisation«.
Damit ist der Selbstunternehmer permanent selbst verantwortlich für das Gelingen seiner Arbeit, und zwar im doppelten Sinne: Der Arbeitsauftrag muss erfüllt werden; gleichzeitig muss die Arbeit so eingerichtet sein, dass sie dem Erwerbstätigen die Existenzsicherung garantiert, mit der arbeitsfreien Zeit in Balance steht (Work-Life-Balance), ein Familienleben zulässt und so weiter. Mit der Sorge um das Gelingen ist der Selbstunternehmer zudem stetig beschäftigt, er kann sich nicht zurücklehnen und sich auf dem einmal Erreichten ausruhen (siehe das Fallbeispiel Christine: Die Akquise muss laufend fortgesetzt werden). Er ist damit zwar in eine (vermeintlich) größere Freiheit entlassen (Du kannst dir deine Arbeit selbst einrichten.), gleichzeitig steht er jedoch unter höherem Druck (Du musst dir deine Arbeit selbst einrichten!). Das Motto: »Mehr Druck durch mehr Freiheit«, steht über seinem ganzen Arbeitsleben (Glißmann u. Peters, 2001).
Das Leitbild des Selbstunternehmers ist indessen nicht neu. Im Gegenteil: Es ist in manchen Branchen und Arbeitsfeldern ein alter Hut, weil dort beinahe jeder so tätig ist. Unter den Kleinselbständigen ist es ebenso wenig eine Überraschung wie in der Branche, die heute als die »Creative Industries« bezeichnet wird. An anderer Stelle wird sogar – wiederum in pointierender Zuspitzung – von einer tonangebenden »Creative Class« gesprochen (Florida, 2002). Klasse oder nicht: Die Kreativen, also die Künstler, Designerinnen, Werber, Architektinnen, Journalisten und so fort, sind ungewollt zu einem Modell für die Gestaltung von Erwerbsarbeit geworden (Mandel, 2007; Menger, 2006). Sie arbeiten gewohnheitsmäßig flexibel, in wechselnden, bislang als untypisch geltenden Anstellungsformen, mit teils fehlender oder schwacher sozialer Sicherung, unregelmäßigem Einkommen, inhaltlicher Gestaltungsfreiheit und starker intrinsischer Motivation (Haak u. Schmidt, 1999, S. 33). Genau dies wird auch vom unternehmerischen Selbst erwartet.
Das Arrangement, das die Kreativen akzeptieren, passt hervorragend zur neuen Logik des Selbstunternehmertums. Zu sehen ist das zum Beispiel am Phänomen der friktionellen Arbeitslosigkeit. Der Begriff meint die stets auf einem hohen Stand gehaltene Arbeitslosigkeit, die typischerweise in Branchen entsteht, in denen Zeitverträge üblich sind und Aufgaben schnell wechseln (wie in vielen der kreativen Branchen). Große Teile der Erwerbstätigen werden dabei regelmäßig – nach Ablauf eines Vertrages – für eine gewisse Zeit freigesetzt, dann wieder angestellt, und so fort. Die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte »muss zu jedem Zeitpunkt deutlich über der Zahl der tatsächlich Beschäftigten in den laufenden Produktionen liegen« (Menger, 2006, S. 64). Jeder ist demnach tunlichst gehalten, sich ein zusätzliches Einkommen durch Nebenbeschäftigungen zu schaffen. Die Beweglichkeit zwischen Beschäftigungsformen sowie zwischen Anstellung und Erwerbslosigkeit gehört hier mithin zur Norm. Im Modell der Kreativen muss jeder selbst dafür sorgen, das alles unter einen Hut zu kriegen.
Selbstunternehmertum kann demnach zum Teil auch dem Motto »Feiern und fasten« zugeordnet werden, denn die Existenzsicherung geht mit Risiken einher. Je näher man dem Modell Selbstunternehmer rückt, desto wahrscheinlicher wird es, dass auch sie nicht länger nach dem alten, mit Garantien und Absicherungen gepolsterten Muster funktioniert. Sie wird – um ein im Gefolge der Arbeitsmarktreformen in die Mode gekommenes Wort zu gebrauchen – prekärer. Das hängt zum einen damit zusammen, dass, wie wir oben gesehen haben, die Lebensdauer von Arbeitsverhältnissen sinkt und der Job (freiwillig oder unfreiwillig) häufiger gewechselt wird. Zum anderen hängt die Prekarität des Lebenserwerbs mit dem Einkommen zusammen, das auch bei fortschreitender Beschäftigung unter Umständen nicht so stetig ist, dass es für eine zuverlässige Existenzsicherung reicht.
Das Einkommen von Selbstunternehmern schwankt unter Umständen und das teilweise stark. Es ist im Unterschied zur langfristigen Festanstellung oft nicht so leicht kalkulierbar, da es nicht wie dort vertraglich oder tariflich festgelegt ist. Bei Selbständigen hängt es vom Erfolg der Akquise und der Lukrativität der Aufträge ab, bei unbefristet Beschäftigten vom Zeitraum, der zwischen den Beschäftigungsphasen liegt, bei Multijobbern wie Christine aus dem Fallbeispiel von einer geschickten Mischung der einzelnen Jobs.
Dies verdeutlicht ein Schaubild zu drei verschiedenen Einkommensmodellen von Selbstunternehmern (siehe Abbildung 1). Die untere, durchgehende Linie stellt ein angenommenes Ausgabenminimum von 1000 Euro dar, das hier zum Vergleich eingesetzt wurde. Das Normalarbeitsverhältnis (NAV) ist ebenfalls aus Gründen der Vergleichbarkeit dargestellt, hier exemplarisch repräsentiert durch einen Monatsverdienst von 2500 Euro plus der jährlichen Zulagen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld etc.) in Höhe eines Monatsgehaltes. Interessant sind nun die Einkommensverläufe der Selbstunternehmer: Das Modell »Guido«, steht für gut verdienende Selbstunternehmer mit einem Jahreseinkommen über dem Durchschnitt. Man sieht, dass das Einkommen zwar schwankt, aber dauerhaft deutlich über dem Ausgabenminimum liegt. Täler werden durch zeitnahe Verdienstspitzen wieder ausgeglichen. Das Modell »Emily« weist ähnlich starke Schwankungen auf, sie liegen allerdings um das Ausgabenminimum herum. Diese Selbstunternehmer leben von der Hand in den Mund. Längere Verdienstausfälle (zum Beispiel durch Krankheit) bringen das fragile Gleichgewicht schnell ins Wanken, da auch oft kaum Vermögensreserven gebildet werden können. Die Lage ist hier von allen Modellen am prekärsten. Sie ist typisch für Kleinselbständige kurz nach der Gründung oder in Berufsfeldern, in denen hohe Stundenverdienste selten sind. Modell »Adrian« steht für Multijobber, die sich durch einen Brotjob (siehe auch »Neue Erwerbsmodelle« S. 32 ff.) eine gerade ausreichende Existenzgrundlage schaffen können. Sie verdienen durch eine zweite Tätigkeit noch etwas dazu (hier im Februar und August) und füllen die Kasse damit immer wieder über das Minimum hinaus auf.
Abbildung 1: Schaubild zu drei verschiedenen Einkommensmodellen von Selbstunternehmern
Den drei Modellen der Abbildung 1 ließe sich eine Vielzahl weiterer hinzufügen. Als Beispiele dafür, wie vielgestaltig die Einkommensverhältnisse der Selbstunternehmer sind, können jedoch bereits diese drei dienen. Es sollte auch deutlich geworden sein, dass für einige Selbstunternehmer die existenziellen Risiken allein aufgrund ihrer Verdienstsituation groß sind. Dabei changieren die Risiken durchaus, sind mal überschaubar (wenn die Kassen gerade gefüllt sind oder die Auftragslage gut ist), mal bedrohlich (bis hin zur Privatinsolvenz). Das Modell »Emily« macht besonders anschaulich, was es bedeutet, in »feast and famine cycles« zu leben (Leadbeater u. Oakley, 1999): An manchen Tagen reicht es für ein Festmahl, danach muss wieder für eine Zeit gefastet werden.
Die Möglichkeit der Existenzsicherung durch nur einen Beruf ist sicherlich für eine steigende Zahl von Menschen geringer geworden. In der Folge rücken sie vom Ein-Beruf-Modell ab und wählen ein alternatives Jobmodell (siehe »Neue Erwerbsmodelle« S. 32 ff.). Die Risiken werden damit allerdings unter Umständen nicht geringer. Das Gefühl der gesicherten Existenz, das sich viele nach wie vor wünschen, wird nicht erreicht und die Risiken rücken im Bewusstsein weiter in den Vordergrund (Bologna, 2006, S. 24 f.). Auch dies ist ein – psychologisches – Ergebnis des Wandels auf dem Arbeitsmarkt.
Die Verschiebung von existenzieller Sicherung hin zum Befördern existenzieller Risiken wird vom Gesetzgeber mittels der Arbeitsmarktreformen noch mit einem zusätzlichen Momentum verstärkt. Sie betrifft im Übrigen nicht nur niedrig Qualifizierte. Gerade die Hochqualifizierten, die noch am ehesten erwarten können, mit einer unzuverlässigen Existenzgrundlage nichts zu tun zu haben, sind überrascht, wenn ihre Erwartungen nicht eintreffen und sie sich als Arbeitssammler wiederfinden (Plöger, 2010a; Rambach u. Rambach, 2001). Die folgenden zwei Fallbeispiele von Hans und Johanna mögen verdeutlichen, vor welchen Herausforderungen manche Arbeitssammler stehen.
Hans
Hans ist Anfang fünfzig und im öffentlichen Dienst in leitender Funktion angestellt. Er ist verantwortlich für eine kulturelle Einrichtung in einer Kleinstadt. Seine Arbeit bringt eine Menge Verantwortung für die Mitarbeiter und das Kulturangebot seiner Einrichtung mit sich. Sein Gehalt bekommt er nach Tarif, was, wie er es einschätzt, gemessen an seiner Aufgabe ziemlich bescheiden ist. Das gilt auch im Vergleich mit seinen Qualifikationen: Er hat zwei verschiedene Studienfächer mit Diplom abgeschlossen und zuvor noch eine Berufsausbildung gemacht. Seit zehn Jahren ist er in einer Leitungsposition. Wenn Leute von ihm hören, was er verdient, sind sie überrascht, wie wenig es ist angesichts seiner Position und Reputation.
Durch eine Scheidung ist seine finanzielle Situation erst recht schwierig geworden. Er zahlt weiterhin Unterhalt für das gemeinsame Kind, das 250 Kilometer entfernt bei der Mutter wohnt. Das heißt für Hans, zweimal im Monat eine teure Fahrt zu seinem Kind zu unternehmen. Steuerlich ist er als Single zudem jetzt auch schlechter gestellt. Man kann sagen: Was das verfügbare Einkommen angeht, lebt er wieder wie als Student. In manchen Wochen hat er nichts anderes zu sich genommen als Nudeln vom Discounter und Wasser aus dem Hahn – mit Brausetabletten, damit es wenigstens nach etwas schmeckt.
Johanna
Johanna arbeitet freiberuflich als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache und wird recht regelmäßig von Bildungsträgern auf Honorarbasis beschäftigt. Sie kann ihr Einkommen zwar theoretisch selbst regulieren (indem sie mehr oder weniger Aufträge übernimmt). Von Gesetzes wegen sind ihr jedoch Grenzen gesetzt: Sie darf nicht mehr als zwanzig Stunden pro Woche als Deutschlehrerin arbeiten. Bei dem Honorar, das ihr gezahlt wird, rund 20 Euro pro Unterrichtsstunde (die Unterrichtsvorbereitung wird nicht bezahlt), reicht das hinten und vorne nicht. Johanna schätzt ihr Honorar als ungerecht ein, nicht nur wegen der im Vergleich zu anderen selbständigen Beschäftigungen geringen Höhe, sondern auch wegen ihrer Qualifikation: Sie verdient bei den Bildungsträgern das gleiche Gehalt wie ein Student mit wesentlich geringerer Erfahrung und formaler Qualifikation. Die Einkommenssituation ihrer Kollegen ist bereits zu einem kleinen Politikum geworden. Die »Aktion Butterbrot« (Freiberufliche Lehrerinnen und Lehrer, 2007; siehe deutscher Bildungsserver, 2015) organisiert seit mehreren Jahren Proteste und macht mit Schreiben an Politiker auf die Lage der Dozenten für Deutsch als Fremdsprache aufmerksam.
Johanna hadert und bleibt pragmatisch. Einmal hat sie sich nicht anders zu helfen gewusst, als ihrer Krankenversicherung zu verschweigen, dass sie nicht länger einen Status hatte, der es ihr erlaubte, in der Versicherung ihres Mannes familienversichert zu bleiben. Es ging ihr zwar gegen den Strich, nicht ehrlich sein zu können, aber sie konnte die Beiträge, die sie als Selbständige hätte leisten müssen, schlicht nicht aufbringen. Monatelang bewegte sie sich so in der Illegalität. Die Mogelei rächte sich schließlich, am Ende forderte die Versicherung 3000 Euro Nachzahlung.
Neue Erwerbsmodelle
Ihre Einkommenssituation setzt Selbstunternehmern also zum Teil einen engen Rahmen, in dem sie sich bewegen müssen. Er schafft damit allerdings auch eine beständige Motivation, die eigene berufliche Situation zu überdenken und eventuell ein anderes Erwerbsmodell zu suchen. Wer mit seinem Hauptberuf nicht zurechtkommt, sucht sich eine Nebenbeschäftigung oder geht – zuerst probehalber – in die Kleinselbständigkeit. Für die Steigerung des Variantenreichtums der Beschäftigungsarten und Erwerbsmodelle, die wir gegenwärtig erleben, gibt es also durchaus pragmatische Gründe. Es sind jedoch nicht die einzigen Gründe. Der intrinsische Antrieb, Varianten zu suchen, die die Arbeit interessanter machen, ist für einige Berufstätige auch einer. Andere folgen in neuen, unerschlossenen Tätigkeitsfeldern und Erwerbsmodellen ihrem Unternehmergeist. Schließlich wird es auch von einigen Beschäftigten als progressiv oder »hip« empfunden, einer ungewöhnlichen Beschäftigung nachzugehen. Die Gründe sind mithin sehr verschieden, reichen von äußerem Zwang über pragmatische Anpassung oder intrinsische Motivationen hin zu sozialer Positionierung.
Dass der Variantenreichtum in der Arbeitswelt gestiegen ist, steht außer Zweifel. Es scheint die Menschen zunehmend von den althergebrachten Ideen von guter Arbeit, die mit einem jahrzehntelangen Vorherrschen des Normalarbeitsverhältnisses einhergingen, wegzutreiben. Normale Arbeit ist heute für manche eher ein Fluch, weil sie nach Stillstand, Burnout oder Vernachlässigung des privaten Lebens klingt. Das gute Leben, das dämmert immer mehr Erwerbstätigen, dort zu suchen, könnte sie auch in die Irre führen. Deshalb halten sie nach neuen Formen des Broterwerbs Ausschau, nach Formen, in denen sie gleichzeitig andere ihnen wichtige Bestandteile des guten Lebens erfüllt finden: Gemeinschaft, Sorge für andere, Selbstverwirklichung, politische Teilhabe (Biesecker u. Baier, 2011). Die Möglichkeit der steigenden Selbstbestimmung gehört dabei zu einer der wichtigsten Motivationen und gleichsam zu einer der größten Chancen der sich wandelnden Arbeitswelt (Plöger, 2011b).
Diese Suchbewegung nach Alternativen hat begonnen, öffentlich sichtbar zu werden. Sie führt in die Subsistenzwirtschaft oder Gemeinschaftsarbeit (Baier, Müller u. Werner, 2007), in Experimente mit neuen, an Informationsverarbeitungstechnik gebundenen Arbeitsformen (Friebe u. Lobo, 2006), in Versuche mit neuen Unternehmensmodellen (Pflüger, 2009) oder in gemischte Beschäftigungsmodelle, die bisher gar nicht als Arbeit ernst genommen wurden (Sooth, 2008). Dabei werden die Alternativen oft nicht gesucht und gefunden, sondern erfunden. Man kann sagen, dass manche Selbstunternehmer regelrechte Erfinder neuer Erwerbsformen sind (Plöger, 2010b).
Für einen ersten Überblick über die Erwerbsmodelle von Selbstunternehmern schlagen wir folgende einfache Einteilung in fünf Typen vor:
–Der Parallelarbeiter verfolgt mehrere Tätigkeiten nebeneinander, die als in etwa gleichwertig betrachtet werden können. Christine aus dem obigen Fallbeispiel ist eine typische Parallelarbeiterin.
–Die Brotjobberin entspricht dem Modell »Adrian« aus dem Schaubild der Einkommensmodelle (siehe Abbildung 1). Wie beim Parallelarbeiter gibt es mehrere parallele Jobs, einer davon dient jedoch dem Schaffen einer Existenzgrundlage (der Brotjob), alle anderen werden aus intrinsischer Motivation verfolgt, weniger wegen des Einkommenszugewinns.
–Der Wechsler nimmt nacheinander verschiedene Erwerbstätigkeiten auf. Diese können eine formale Qualifikation voraussetzen, müssen es aber nicht. Sie bewegen sich jedoch in einem Bereich, sind sich also inhaltlich ähnlich bzw. bauen inhaltlich aufeinander auf.
–Die Rigorose bleibt konsequent bei einer Tätigkeit, auch wenn diese ein zu geringes Einkommen abwirft. Sie ist dann auf Nebentätigkeiten angewiesen und wird so zeitweise zur Brotjobberin. Der Beruf aus Leidenschaft wird dabei aber nie aufgegeben.
–Der Proteus ist der unberechenbarste Typus, da er immer wieder einmal den Job wechselt, teils sogar die Branche oder das Arbeitsfeld und etwas vollkommen Neues beginnt. Dann wieder bleibt er längere Zeit bei einer Arbeit, wechselt dann erneut und so fort.
Inhaltlich können diese Erwerbstypen mit jeder Tätigkeit gefüllt werden, die vorstellbar ist. Manchmal dehnen die Beschäftigungsideen den Rahmen des Vorstellbaren auch weiter aus, wie das Fallbeispiel von Sascha Kruse, »Golfballtaucher«, zeigt.
Golfballtaucher
Sascha Kruse ist Taucher. Er geht seinem Beruf jedoch nicht im offenen Meer nach, sondern in kleinen Seen und Tümpeln. Kruse ist der deutschlandweit wohl einzige Rettungstaucher für verlorene Golfbälle. Auf Golfplätzen gehören kleine Teiche zu den beliebtesten Hindernissen. In den Teichen findet sich mithin regelmäßig eine Unzahl von Bällen wieder. Kruse holt diese in seinen Tauchgängen zurück an die Oberfläche und verkauft sie anschließend, unter anderem über seinen Onlineshop »Golfballcomeback« (siehe www.golfballcomeback.de). Damit hat er für sich ein Geschäftsmodell gefunden, das zunächst ein wenig abwegig klingt, offenbar aber sehr gut funktioniert: Kruse geht seinem selbsterfundenen Job bereits seit 2003 nach.
Die oben aufgelisteten Erwerbsmodelle weichen alle vom sogenannten Normalarbeitsverhältnis ab. Insofern sie heute nicht nur faktisch häufig unter den Erwerbstätigen zu finden sind, sondern auch ein Leitbild darstellen, kann man sagen, dass sich eine neue Art der Laufbahnorientierung durchsetzt. Diese wiederum ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Arbeit in der Karriereberatung. Wir werden uns deshalb diese neue Laufbahnorientierung im Folgenden genauer ansehen.
Für den Karriereberater heißt das zunächst einmal, dass er in keinem Fall nur ein Informationsvermittler sein kann, in dem Sinne, dass er professionelle Hinweise zur Gestaltung einer erfolgreichen Berufslaufbahn in einem bestimmten Arbeitsfeld gibt. Spezifische Ratschläge zu geben wird für ihn immer schwieriger, da die Erwerbsmodelle und Tätigkeitsfelder für eine direktive Beratung oft zu stark diversifiziert sind. Der Berater muss sich mithin auf individuell sehr unterschiedliche Laufbahnen einstellen. Welches Modell schließlich verfolgt wird, ist zunächst offen. Seine Aufgabe sollte es daher sein, Orientierungshilfen bereitzustellen, die es dem Klienten ermöglichen, eine Passung zwischen sich und seiner Arbeit zu schaffen (siehe weiter unten).
Peter Plöger
Neue Laufbahnorientierungen
Unter den Bedingungen eines vorherrschenden Normalarbeitsverständnisses waren Laufbahnorientierungen üblich, die eine stabile Bindung zu einem Arbeitgeber, eine allmähliche Verbesserung des materiellen Status, moderate bis gute Aufstiegschancen, Bildungschancen für die Kinder und so fort beinhalteten. Diese Orientierungen, die für eine Zeitspanne von Jahrzehnten im Großen und Ganzen stabil geblieben und daher an die Folgegeneration überliefert worden sind, werden in der heutigen Arbeitswelt in Frage gestellt. Die berufsbezogenen Wünsche und Bedürfnisse haben sich bei den Erwerbstätigen (und den jungen, in Zukunft erwerbstätigen Menschen) verändert. Risiken werden stärker wahrgenommen (zum Teil allerdings auch überhöht). Chancen tun sich vor allem mit den diverser gewordenen Erwerbsmodellen auf. Die Wahrnehmung der Erwerbstätigen kehrt sich vermehrt von den überlieferten Modellen ab und hin zu den neuen. Wünsche und Bedürfnisse folgen dieser Umorientierung. Der Wandel ist auch allmählich in der Ratgeber- und Sachliteratur angekommen, wo inzwischen zum Beispiel stärker die Vereinigung von gesellschaftlichem sowie marktwirtschaftlichem Bedarf auf der einen Seite und den individuellen Neigungen und Dispositionen auf der anderen Seite als Ziel der persönlichen Erfüllung im Beruf begriffen wird (Förster u. Kreuz, 2013). Andere Autoren betonen die Offenheit des Findungsprozesses und wollen zu mehr Mut zum Experiment animieren (Krznaric, 2012; Plöger, in Vorbereitung; Williams, 2010).