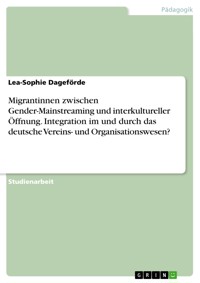Systemsprenger in der Gesellschaft. Wie traumapädagogische Ansätze in der Kinder- und Jugendhilfe zur Prävention beitragen E-Book
Lea-Sophie Dageförde
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn Jugendliche nicht in das bestehende System passen, werden sie gerne als „SystemsprengerInnen“, „VerweigererInnen“ oder „Problemjugendliche“ bezeichnet. In der Diskussion um diese Jugendlichen geht es meistens um die hohen Kosten, die durch deren Betreuung entstehen. Aber mit welchen Maßnahmen kann man ihnen gezielt und effizient helfen? Lea-Sophie Dageförde untersucht, mit welchen professionellen Ansätzen die Soziale Arbeit die Jugendlichen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren kann. In einem ersten Schritt widmet sich die Autorin den SystemsprengerInnen. Sie erörtert, was darunter zu verstehen ist und welche Ursachen zu einer solchen Entwicklung führen können. In diesem Buch wird ein praktischer Leitfaden entwickelt, der effiziente Ansätze zur Sozialarbeit mit den Jugendlichen etabliert. Neben der Verringerung einer derartigen Entwicklung zum/zur SystemsprengerIn leitet die Autorin einen Ansatz ab, der die Entwicklung ganz verhindern kann. Die Arbeit befasst sich mit einem präsenten Problem in der Sozialarbeit und knüpft nahtlos an die Aktualität des Erfolgsfilms „Systemsprenger“ von 2019 an. Aus dem Inhalt: - Trauma; - Hoch-Risiko-Klientel; - Jugendhilfe; - Familienhilfe; - Hilfemaßnahmen; - Intensiv- und individualpädagogische Maßnahmen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 76
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Wer sind die sogenannten „SystemsprengerInnen“?
2.1 Definitionsversuche
2.2 Das Bedürfnis nach Kontrolle
2.3 Begriffsproblematik
2.4 Wissenschaftliche Erkenntnisse – die EVAS-Studie
2.5 Wie werden Kinder und Jugendliche zu sogenannten „SystemsprengerInnen“? – ein Annäherungsversuch
3 Trauma
3.1 Definition
3.2Die Differenzierung von Traumatisierungen
3.3 Wie entstehen Traumata?
3.4 Trauma auf Grund von Gewalt
3.5 Die Bedeutung von Traumatisierungen für die Entwicklung – ein kurzer Anriss
4 Traumapädagogik
4.1 Definition
4.2 Traumapädagogisches Herangehen
4.3 Positive Effekte einer traumapädagogischen Herangehensweise
5 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Differenzierte Effektstärken in der Arbeit mit den sogenannten „SystemsprengerInnen“
Abbildung 2: Hilfedauer und Effekte unterschiedlicher Maßnahme- Arten in der Arbeit mit den sogenannten „SystemsprengerInnen“
1 Einleitung
„SystemsprengerInnen“, „VerweigererInnen“, „GrenzgängerInnen“, „schwierige Jugendliche“, „Hoch-Risiko-Klientel“, „Problemjugendliche“ sind nur einige der Bezeichnungen für eine Gruppe junger Menschen, die die vorhandenen Systeme der Jugendhilfe zu sprengen scheinen. Sie sind ein bedeutender Teil der Diskussion, wenn es um sehr hohe Kosten für pädagogische Maßnahmen geht, in den Medien wird selten positiv über sie berichtet und pädagogische Fachkräfte werden mit ihnen oft an ihre fachlichen und persönlichen Grenzen gebracht. Wer sind also diese sogenannten „SystemsprengerInnen“?
Spätestens seit der Veröffentlichung des Films „Systemsprenger“ im Jahr 2019 von Nora Fingscheidt[1] ist der professionelle Umgang mit „schwierigen Jugendlichen“ nicht nur in den pädagogischen Fachkreisen ein präsentes Thema. Durch den Film ist es gelungen, der Gesellschaft auf eine sehr realitätsnahe Weise zu zeigen, mit welchen Herausforderungen das Hilfesystem konfrontiert ist. Trotz des recht breit aufgestellten Maßnahmenkatalog des Jugendhilfesystems, welcher sich über Beratung, Familienhilfe, ambulante Angebote, Erziehungsbeistandsschaften, stationäre Maßnahmen und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung streckt, scheint es immer noch Jugendliche zu geben, denen dadurch nicht geholfen werden kann, und die von einer Maßnahme zur nächsten Maßnahme wandern. Diese Maßnahmen werden dann im Verlauf immer etwas enger und geografisch entfernter gesteckt, und trotzdem kann dies vielen nicht helfen.
Hinzu kommt ein weiteres Problem: die Verjüngung der Klientel. Waren die sogenannten „SystemsprengerInnen“ früher mit 15-16 Jahren bei einer ausgeprägten Jugendhilfekarriere angelangt, sind die Hilfemaßnahmen heute schon bei einer deutlich jüngeren Klientel, oft schon unter 10 Jahren, ausgeschöpft.[2]
Intensiv- und individualpädagogische Maßnahmen scheinen bislang die wirkungsvollsten Maßnahmen zu sein.[3] Das bedeutet jedoch nicht, dass dies für alle „SystemsprengerInnen“ gilt. Trotzdem scheint es interessant zu sein, näher hinzuschauen: liegt es vielleicht an dem engen Betreuungsschlüssel mit oftmals 1:1-Betreuung oder an einem neuen Lebensraum, teilweise sogar im Ausland? Ich wage die Vermutung aufzustellen, dass dies nicht die entscheidenden Faktoren sind. Vielmehr scheint etwas Anderes ursächlich für den Erfolg mit dieser Klientel zu sein: eine explizite traumapädagogische Herangehensweise oder die „unbewusste“ Verwendung dieser.
Das spezifische Verhalten von „SystemsprengerInnen“ ist u.a. geprägt durch Aggressivität, sexuellen Auffälligkeiten, Weglauf-Tendenzen, Betäubungsmittel-Missbrauch und Straffälligkeiten.[4] Betrachtet man diese Verhaltensweisen als Anpassungsleistungen auf die Missstände in der Entwicklung, und vergleicht diese mit Folgestörungen auf Grund von traumatischen Erlebnissen, eröffnet sich ein völlig neuer Blickwinkel.
Diese Bachelorarbeit soll die Gruppe der sogenannten „SystemsprengerInnen“ in ihrer spezifischen Art beleuchten, aber auch auf die miteinhergehende Problematik der Begriffsverwendung hinweisen. Zusätzlich sollen Annäherungsversuche an die möglichen Ursachen, die zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu den sogenannten „SystemsprengerInnen“ führen, unternommen werden. Dies geschieht auch unter dem Aspekt einer traumapädagogischen Herangehensweise. Aus dieser neuen Sichtweise lassen sich dann Empfehlungen für die Arbeit mit den sogenannten „SystemsprengerInnen“ und auch den „Noch-nicht-SystemsprengerInnen“ ableiten, die für eine Verringerung oder sogar Verhinderung der Entwicklung junger Menschen zu „SystemsprengerInnen“ sorgen könnten.
Die Bachelorarbeit ist inhaltlich, neben der Einleitung und dem Fazit, unterteilt in drei Schwerpunktbereiche. Der erste Schwerpunktbereich beschäftigt sich mit den sogenannten „SystemsprengerInnen“ und ihrem Verhalten. Am Ende dieses Schwerpunktbereiches findet eine Überleitung in den zweiten Bereich zum Thema Trauma statt. Dieser zweite Bereich beschäftigt sich mit der Definition und Unterteilung, den Folgen traumatischer Erlebnisse und den Auswirkungen auf die Entwicklung. Anschließend geht es im dritten Schwerpunktteil um die Traumapädagogik, mit ihren positiven Effekten in der Arbeit mit den sogenannten und zukünftigen „SystemsprengerInnen“.
2 Wer sind die sogenannten „SystemsprengerInnen“?
Dieser Teil soll eine Annäherung an die sogenannten „SystemsprengerInnen“ mit ihrem spezifischen Verhalten erbringen und erste Erklärungsversuche unternehmen, welche Faktoren Kinder und Jugendliche zu den sogenannten „SystemsprengerInnen“ werden lassen. Auf diesem Gebiet führend ist Prof. Dr. Menno Baumann[5]. Viele der folgenden Verknüpfungen sind an seine Erkenntnisse angelehnt. Gleichzeitig soll auch auf die Bedeutung der, für diese Gruppe verwendeten, Begriffe eingegangen werden.
2.1 Definitionsversuche
Die Begriffe „SystemsprengerInnen“, „VerweigererInnen“, „GrenzgängerInnen“, „schwierige Jugendliche“, „Hoch-Risiko-Klientel“, „Problemjugendliche“ beschreiben Jugendliche, die in ihrer Entwicklung massiven Risiken ausgesetzt waren und deswegen gezwungen waren Strategien zu entwickeln, die sich nun schwer oder gar nicht mit dem pädagogischen Hilfesystem vereinbaren lassen. Sie waren folglich nicht pränatal schwierig. Ihr Verhalten erzeugt bei anderen Menschen eine Stigmatisierung und Etikettierung.[6] Zudem bringen sie Fachkräfte an ihre Grenzen, indem sie z.B. Maßnahmen abbrechen, Kooperation, sowie die Beschulung verweigern, Straftaten begehen. Außerdem pendeln sie oft zwischen Jugendhilfe, Psychiatrie, Straße und, die über 14-jährigen, auch Gefängnis, ohne irgendwo anzukommen.
Prof. Dr. Menno Baumann definiert die sogenannten „SystemsprengerInnen“ wie folgt:
„Hoch-Risiko-Klientel, welches sich in einer durch Brüche geprägten negativen Interaktionsspirale mit dem Hilfesystem, den Bildungsinstitutionen und der Gesellschaft befindet und diese durch als schwierig wahrgenommene Verhaltensweisen aktiv mitgestaltet.“[7]
Um dies besser verstehen zu können, lohnt es sich, die Definition in Einzelteile zu zerlegen und diese genauer zu betrachten: „Hoch-Risiko-Klientel“, „durch Brüche geprägte negative Interaktionsspirale“ und „durch als schwierig wahrgenommene Verhaltensweise aktiv mitgestaltet“.[8]
2.1.1 Hoch- Risiko- Klientel
Die sogenannten „SystemsprengerInnen“ vereinen ein spezielles Phänomen in sich: sie können als Hoch – Risiko – Klientel im doppelten Wortsinn beschreiben werden. Erklären kann man dies wie folgt: auf der einen Seite waren sie selbst von extremen Entwicklungsrisiken betroffen, durch die sie Verhaltensweisen entwickelt haben, die ihr Überleben gesichert haben, nun kollidieren diese jedoch mit der Umwelt. Auf der anderen Seite geht von ihnen selbst auch ein Risiko aus. Dieses kann für sie und ggf. auch für andere gefährlich sein. Menno Baumann beschreibt fünf typische Verhaltensweisen der sogenannten „SystemsprengerInnen“ die ein hohes Risiko aufweisen. Diese sind körperliche Gewalt, offener inszenierter Drogenkonsum, Abhängigkeit mit einem selbstgefährdenden Verhalten, sowie Selbstverletzungen mit parasuizidalen Tendenzen und die Neigung zu Brandstiftungen.[9] Aufgrund des Risikos für die eigene Entwicklung und des Risiko, das von ihnen ausgeht, vereinen sie auf besondere Weise die Rolle von Opfer und Täter in sich.[10]
Zu den eben genannten Aspekten gibt die LIFE-Studie[11] einen quantitativen Einblick in die Lebensumstände der Jugendlichen, die einerseits ein großes Entwicklungsrisiko hatten und andererseits ein Risiko für die Umwelt darstellen. Zu diesen Lebensumständen zählen: Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch, Alkohol- und Drogenmissbrauch, gewalttätiges Verhalten, Autoaggressivität, sexuelle Auffälligkeit, Weglauf-Tendenzen und Straffälligkeit.
Zu den Entwicklungsrisiken geht aus der Life-Studie hervor, dass Vernachlässigungen auf 66% der Jugendlichen zutrafen.[12] Misshandlungen hatten 52% erfahren, bei 10% lag die Vermutung nahe, dass sie ebenfalls betroffen waren, dies konnte, anhand der Akten, jedoch nicht zu 100% belegt werden.[13] Bei dem Entwicklungsrisikofaktor des Missbrauchs fiel vor allem auf, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. So konnte bei den weiblichen Klienten eine deutlich höhere Anzahl ausgewertet werden, 50% waren betroffen.[14] Zusammengefasst lagen bei 12% bestätigte Missbrauchsfälle vor, weiterführend wurden bei 21% ein Verdacht auf Missbrauch geäußert.[15]
Von den Jugendlichen selbst gehen ebenfalls Lebensumstände aus, die selbst- und fremdgefährdend sein können. Hierzu gehört unter anderem ein Alkohol- und Drogenkonsum. Dieser konnte bei 67% der Klientel festgemacht werden.[16] Zusätzlich hatten ein entweichendes Verhalten 54%.[17] Auch gewalttätiges Verhalten zeigten 87% der untersuchten Fälle.[18] Bei der Autoaggressivität ließen sich 24% als allgemein autoaggressiv einordnen, 12% zeigten parasuizidale Tendenzen[19] und 4% waren suizidal.[20] Eine allgemeine sexuelle Auffälligkeit zeigte sich bei 37% der Jugendlichen, 12% konnten als Täter festgemacht werden und 9% als Opfer.[21] Besonders sticht die Straffälligkeit heraus, denn 98% der Jungen und Mädchen waren bereits straffällig geworden.[22]
2.1.2 Eine durch Brüche geprägte Interaktionsspirale
Hierzu muss gesagt werden, dass der Lebenslauf der sogenannten „SystemsprengerInnen“ vor allem durch Brüche geprägt ist, z.B. in Form von Beziehungsabbrüchen, häufigen Umzügen oder allgemein einer brüchigen Familienstruktur.[23] Kommt es nun zu Jugendhilfemaßnahmen, zeigt sich ein Paradoxon, denn das Hilfesystem ist ebenfalls durch Brüche gekennzeichnet, vielmehr ist es sogar darauf ausgelegt.[24] Verläuft eine Maßnahme positiv, ist es ganz natürlich, dass diese nach Zielerreichung beendet wird. Speziell bei der Gruppe der „SystemsprengerInnen“ scheinen verlässliche und kontinuierliche Beziehungen essenziell wichtig zu sein. Dieser Grundsatz wird vor allem bei individualpädagogischen und intensivpädagogischen Maßnahmen verfolgt. Doch auch diese sind in ihrer Dauer, oft noch mehr als Regelangebote, wie z.B. ambulante oder stationäre Maßnahmen, klar begrenzt. Folglich sind erneute Beziehungsabbrüche unvermeidlich. Hinzu kommt auch die Tatsache, dass, umso besser eine Entwicklung im Rahmen einer Maßnahme verläuft, umso schneller lässt auch die erhöhte Aufmerksamkeit der Fachkräfte nach.[25]