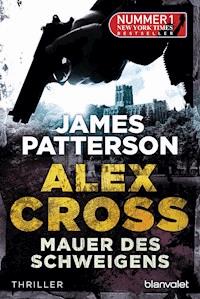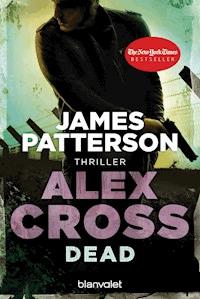8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Billy Harney
- Sprache: Deutsch
Fünf verschwundene Mädchen – und ein unbestechlicher Detective auf der Jagd nach dem Killer ...
Eine Entführungsserie hält Chicago in Atem. Vier Mädchen sind dem skrupellosen Kidnapper bereits zum Opfer gefallen, nun hat er die Tochter eines millionenschweren Bauunternehmers in seine Gewalt gebracht. Detective Billy Harney von der Special Operations Einheit der Polizei soll die Mädchen finden. Eine heiße Spur führt Harney und sein Team zu einem abgelegenen Haus. Doch der Ort entpuppt sich als tödliche Falle. Eine Explosion tötet Harneys Kollegin Carla, der Täter dagegen entkommt. Schockiert und wütend schwört Harney Gerechtigkeit – und gerät dabei immer tiefer in Chicagos dunklen Sumpf des Verbrechens …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Eine Entführungsserie hält Chicago in Atem. Vier verschwundene Mädchen in anderthalb Jahren, und nun hat der skrupellose Kidnapper ein fünftes Mal zugeschlagen. Sein jüngstes Opfer: die fünfzehnjährige Bridget Leone, Tochter eines einflussreichen, millionenschweren Bauunternehmers. Detective Billy Harney und seine Kollegin Carla Griffin von der Special-Operations-Einheit der Chicagoer Polizei sollen Bridget und die anderen Mädchen finden und den Entführer zur Strecke bringen. Eine heiße Spur führt Harney und Carla zu einem abgelegenen Haus im Wald. Doch der Ort entpuppt sich als tödliche Falle. Eine Explosion bringt das Haus zum Einsturz und tötet Carla, dem Täter dagegen gelingt die Flucht. Wütend und bestürzt schwört Harney Rache – und gerät dabei immer tiefer in Chicagos dunklen Sumpf des Verbrechens …
Weitere Informationen zu James Patterson sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
James Patterson
und
David Ellis
Tag des Verrats
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Peter Beyer
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Escape« bei Little, Brown and Company, a division of Hachette Book Group Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung November 2023
Copyright © der Originalausgabe 2022 by James Patterson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotive: gettyimages/aaaaimages; Trevillion images/Magdalena Russocka; FinePic®, München
Redaktion: Ann-Catherine Geuder
KS · Herstellung: ik
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-31167-4V001
www.goldmann-verlag.de
Für den Ausnahmeanwalt Dan Collins und die fantastische Familie Collins – Kristin, Riley, Declan und Aidan Collins
8. April
1
Er ist hier irgendwo. Ich bin mir sicher. Und das Mädchen könnte noch am Leben sein.
Das Mädchen: die fünfzehnjährige Bridget Leone, vor vierundvierzig Stunden auf einer Straße in Hyde Park entführt.
Bing. Bing. Bing. Bing.
Das ALPR, die automatische Kennzeichenerfassung auf dem Armaturenbrett unseres Zivilfahrzeugs, regt sich. Sie registriert das Nummernschild jedes Autos, an dem wir vorbeifahren, und sucht dabei nach Kennzeichen, die mit den Buchstaben F und D beginnen. Allerdings sagte unser Zeuge, die Buchstaben könnten auch andersherum gewesen sein, D und F, und vielleicht nicht einmal direkt nebeneinander.
Wenn sich unser Verdacht bestätigt, dann hat derselbe Mann, der Bridget Leone entführt hat, im Verlauf der letzten anderthalb Jahre in der Metropolregion Chicago noch vier weitere Mädchen im Alter von dreizehn bis sechzehn Jahren entführt, alle afroamerikanischer Herkunft. Keines dieser vier Mädchen wurde gefunden. Alle vier waren Ausreißerinnen und lebten auf der Straße – weshalb sie von den überlasteten Polizisten in den unterbesetzten Vorstadt-Departments, die sich mit den erkalteten Spuren verschwundener Mädchen befassen, übersehen und vergessen wurden.
Bei Bridget Leone liegt der Fall anders. Auch sie ist Afroamerikanerin und fünfzehn Jahre alt, das schon, aber sie lebte nicht auf der Straße und war auch keine Ausreißerin. Nichtsdestotrotz berichteten ihre Eltern, sie würde sich für ihr Alter »viel zu aufreizend« anziehen und hänge oft mit den »wilden Kids« herum, eine typische Teenager-Rebellion, die ihr Entführer fehlgedeutet haben könnte. Und kurz bevor sie entführt wurde, so erfuhren wir dann noch von ihren nicht gerade redseligen Freunden, hatte sie mit Klassenkameraden in einer Gasse nur wenige Blocks von ihrer Elite-Highschool entfernt Gras geraucht.
Nach Bridgets Verschwinden rief ihr Vater – ein millionenschwerer Bauträger – seinen guten Kumpel Tristan Driscoll an, den Polizeipräsidenten von Chicago, der seinerseits sofort die Special Operations Section darauf ansetzte, sie ausfindig zu machen. Was bedeutet, dass Carla Griffin und ich als leitende Ermittler in diesem Fall fungieren.
Das auf dem Armaturenbrett montierte Gerät brummt. Ein Treffer. Carla beugt sich auf dem Beifahrersitz nach vorn und kontrolliert die Sache. »Falscher Alarm«, verkündet sie.
Diese automatischen Nummernschildlesegeräte sind natürlich nicht perfekt. Manchmal wird ein D mit einer Null oder einem O verwechselt oder ein E mit einem F.
Bing. Bing. Bing. Bing.
»Ich komme mir vor wie in einer Scheißspielhölle«, maule ich, während ich unser Zivilfahrzeug in eine dicht bewaldete Gegend namens Equestrian Lakes steuere. Hier gibt es riesige Villen mit ausgedehnten Grünflächen drumherum.
Carla grinst. »Hier geht’s tatsächlich mehr um Glück als um Können.«
Da hat sie recht. Wir haben kaum Anhaltspunkte. Niemand hat gesehen, in welche Richtung der Täter mit seinem Wagen davonfuhr, nachdem er Bridget auf der Straße aufgegriffen hatte. Auf der Route, die er genommen hat, gab es keine PODs – unsere polizeilichen Überwachungskameras, die an verschiedenen Stellen entlang der Straßen installiert sind. Der einzige Zeuge war ein Obdachloser, der kein Handy besaß, sodass er weder ein Foto machen noch anrufen konnte. Noch dazu konnte er sich nur an zwei mögliche Ziffern auf dem Nummernschild eines »dunklen« SUV erinnern und uns vage einen Weißen beschreiben, der »leicht gebeugt« geht, wahrscheinlich zwischen eins fünfundsiebzig und eins achtundsiebzig groß ist, eine lange Narbe auf der linken Gesichtshälfte hat und eine Baseballkappe trägt.
Wir haben eine Vermisstenmeldung über AMBER und diverse Fahndungsaufrufe herausgegeben, darüber hinaus erhält jeder Polizist in Northern Illinois Blitzmeldungen auf seinem Bildschirm. Die Illinois State Police patrouilliert auf den Highways. An dem Abend, als Bridget gekidnappt wurde, haben wir die ALPR-Geräte auf diese Buchstaben angesetzt – D und F, nebeneinanderliegend – und stießen dabei auf einen Ford Explorer auf der South Archer Avenue. Zugelassen auf jemanden in Missouri, der vor sechs Monaten das Zeitliche gesegnet hat.
Wir haben alle registrierten Sexualstraftäter in der Gegend überprüft. Bis jetzt Fehlanzeige. Wir können nur hoffen, dass uns das Glück hold ist. Es sei denn, ich liege mit meinem Bauchgefühl richtig, und er hält sich hier auf, am südwestlichen Ende von Cook County.
Mein Gedanke ist der: Dieses weitgehend unbesiedelte Gebiet liegt in der Nähe des Ortes, wo das ALPR-System den Ford Explorer erfasst hat. Es gibt hier ein paar nette Wohngebiete, klar, aber die Gegend ist zum großen Teil ländlich geprägt, mit viel Wald und mit Häusern, die weit zurückgesetzt von der Straße stehen. Es gibt keine Bürgersteige, Bordsteine oder Straßenlaternen. Jede Menge Privatsphäre. Perfekt für jemanden auf der Jagd.
Anstatt also alles vom Hauptquartier der Special Operations an der Ecke North und Pulaski zu leiten, sind Carla und ich hier, nehmen Telefonanrufe entgegen und erteilen Anweisungen, während wir in einem Zivilfahrzeug patrouillieren – nicht gekennzeichnet, solange man die kleine Kamera auf dem Dach nicht bemerkt.
In Equestrian Lakes, einer schicken Wohngegend, fällt uns nichts Ungewöhnliches auf, also fahre ich zurück auf die Hauptstraße, die Rawlings, und folge ihrem kurvigen Verlauf, während das ALPR ständig bing-bing-bing macht, wenn Autos vorbeifahren.
Die Gegend wird immer abgeschiedener und bewaldeter. Sie sieht aus wie eine Seenlandschaft, was mich an die Ausflüge erinnert, die wir während meiner Kindheit nach Michigan gemacht haben. Die Dämmerung hat noch nicht eingesetzt, als ich nach links in einen schmalen, von hohen Bäumen fast verdeckten Feldweg abbiege. An die Stämme sind Schilder mit der Aufschrift Privatgelände genagelt, und ich erhasche einen flüchtigen Blick auf tiefer zurückliegende Häuser. Die Sonnenstrahlen fallen nur sporadisch durch das Laubdach der Bäume, sodass sich die Scheinwerfer unseres Wagens automatisch einschalten. Nur ein kurzer Abstecher, bevor ich …
Eine Viertelmeile vor uns biegt ein weißer Lieferwagen in unsere Richtung auf die Straße ein. Carla telefoniert gerade mit der State Police, lässt ihr Handy jedoch sinken und verstummt.
Ich verlangsame den Wagen. Der Van fährt weiter auf uns zu, exakt im Rahmen der Geschwindigkeitsbegrenzung, die Scheinwerfer sind auf uns gerichtet.
Bing. Das ALPR erfasst sein Kennzeichen.
»Gewerblicher Lieferwagen«, liest Carla vom eingebauten Bildschirm ab, »zugelassen auf LTV, LLC. Die Zulassung ist auf dem neuesten Stand.«
Der Transporter drosselt das Tempo und macht uns Platz, sodass er beinahe auf den nicht befestigten Randstreifen gerät.
Ich halte an, stelle auf P und schalte den Warnblinker ein. Nur um mal zu sehen, wie der Fahrer reagieren wird.
Der Van scheint noch langsamer zu werden, hält aber nicht an. Carla und ich beugen uns nach unten, um aus dem Fenster einen Blick hinauf zum Fahrer werfen zu können, der in seinem Van höher sitzt als wir.
Es ist ein Weißer, schlecht rasiert, dunkel gerahmte Brille, Baseballkappe, mit einem Verband auf der linken Wange. Er umklammert das Lenkrad mit beiden Händen. Seine Augen bleiben nach vorn gerichtet, er wirft nicht einmal einen kurzen Blick in unsere Richtung, obwohl wir mitten auf der Straße angehalten und den Warnblinker betätigt haben.
»Sieht das für dich aus wie ein Weißer, eins fünfundsiebzig, gebeugt, Narbe im Gesicht?«, flüstert Carla.
Ja, todsicher. Kein Ford Explorer, kein F oder D auf dem Nummernschild, sondern ein Typ, auf den die Beschreibung passt und der in einem dahinschleichenden Lieferwagen hockt. »Sehen wir uns das mal an.«
Ich stelle den Gangwahlhebel auf D und wende, um dem Fahrzeug zu folgen.
2
Der Lieferwagen zockelt die Schotterpiste entlang und wird noch langsamer, als wir hinter ihm auftauchen. Bis jetzt hat sich der Fahrer nichts zuschulden kommen lassen. Er ist nicht zu schnell gefahren. Keine kaputten Rücklichter. Keine offensichtlichen Fehlfunktionen, die eine Kontrolle rechtfertigen würden.
»Kein hinreichender Verdacht«, konstatiert Carla. Eine Zusammenfassung und eine Warnung. Wenn wir den Wagen anhalten, ohne hinreichenden Tatverdacht gehabt zu haben, handeln wir uns vor Gericht Probleme ein.
Aber wir benötigen keinen hinreichenden Verdacht, um ihn ein Weilchen zu verfolgen. Wir leben in einem freien Land.
Ich rechne damit, dass er in Richtung der Hauptstraße fährt, von der wir gerade gekommen sind, der Rawlings. Aber das macht er nicht: Der Van biegt nach links in einen unbeschilderten Weg ein. Noch so ein Feldweg.
Das ist kein Vergehen. Und er hat den Blinker gesetzt.
Trotzdem. Ich werfe einen Blick auf Carla, deren Gesichtsausdruck zeigt, dass es ihr ähnlich geht wie mir: Sie wappnet sich.
»Baird Salt«, liest sie vor, als sie beim Abbiegen des Lieferwagens das Logo auf seiner Seitenwand zu sehen bekommt.
Ich biege ebenfalls auf die Nebenstraße ein. Als Straße kann man diese Piste eigentlich kaum bezeichnen – es ist eher eine Lichtung durch das Buschwerk und den dichten Baumbestand, gerade breit genug für einspurigen Verkehr. Die Unebenheiten reichen aus, um die Federung unseres Taurus und die Füllungen in meinen Zähnen auf die Probe zu stellen. Das Blätterdach der Bäume ist so dicht, dass der Weg fast vollständig im Schatten liegt, nur an einigen Stellen dringen die hellen Strahlen der untergehenden Sonne durch.
Der Van fährt in normalem Tempo den Weg entlang, der kaum zu erkennen und auch kaum befahrbar ist. Ich habe das Gefühl, als führe ich mitten durch einen Dschungel; überhängende Äste schlagen leicht gegen unsere Windschutzscheibe und schrammen an den Seiten des Taurus entlang.
Wir haben immer noch keine offiziellen polizeilichen Maßnahmen ergriffen, lassen aber keinen Zweifel mehr daran, dass wir ihn verfolgen. Wenn dieser Typ unschuldig ist, muss er sich über unser Verhalten wundern.
Aber er ist nicht unschuldig, denke ich, während mein Puls hämmert. Das ist unser Mann.
Und er weiß, dass wir es wissen.
»Sosh, wo bist du?«, fragt Carla in ihr Funkgerät. Ein anderes SOS-Team, Detectives Lanny Soscia und Mat Rodriguez, sind ebenfalls in dieser Gegend und machen das Gleiche wie wir.
»Westlich der Archer in der Nähe der … Hogan?«
»Wir sind gleich südlich der Rawlings und fahren auf einem nicht beschilderten Feldweg Richtung Westen. Wir verfolgen einen weißen Lieferwagen, auf dessen Fahrer die Beschreibung passt. Brauchen Verstärkung.«
»Wo auf der Rawlings?«, fragt Sosh nach.
Carla verflucht das GPS, das sich gerade einen Wolf sucht und keine Verbindung herstellen kann. »Wir sind an der ersten Abzweigung westlich des Wohngebiets Equestrian Lakes, Südseite. Westlich von … Addendale, glaube ich.«
»Sind unterwegs.«
Ich halte zwei, drei Autolängen Abstand, während der Van vorwärtsholpert.
Dann wird er langsamer. Ich stupse Carla an, die daraufhin nickt.
Vor uns öffnet sich eine Lichtung, die Sonne taucht den Boden in helles Licht. Es gibt keine Deckung mehr durch Bäume.
Eine Art Straße? Eine Kreuzung?
»Was ist da vorn?«, frage ich Carla, weil ich meinen Blick nicht vom Weg abwenden will.
»Das GPS fährt immer noch nicht hoch«, antwortet sie. Dann ruft sie über Funk den Hubschrauber der State Police. »Air 6, hier CPD 5210. Können Sie mich hören?«
»Air 6 an 5210, wie ist Ihr Standort?«
Diese Bundespolizisten und ihre Förmlichkeit. Carla wiederholt unseren Standort, so gut es ihr möglich ist.
»Wir werden versuchen, euch ausfindig zu machen«, erwidert der Pilot über Funk. »Das GPS ist ein Albtraum hier draußen.«
Was du nicht sagst. Der Van wird noch langsamer, also bremse auch ich ab.
Schließlich erreicht er die Lichtung, die plötzlich im Licht der Sonne erstrahlt, während wir in der Dunkelheit der Bäume stehen bleiben.
Der Lieferwagen rollt bedächtig eine kleine Steigung hinauf, einen winzigen Hügel, und kommt dann endgültig zum Stehen.
»Er hat angehalten«, informiere ich Carla, die gerade damit beschäftigt ist, heftig auf der Tastatur des Laptops herumzuhacken, um das GPS in Gang zu setzen. »Was zum Teufel macht er da? Was hat er vor? Sind das da …« Ich beuge mich vor und kneife die Augen zusammen.
»Warte – das GPS ist wieder da«, sagt Carla.
»Da sind Gleise«, sagen wir beide wie aus einem Mund.
Kein öffentlicher Bahnübergang. Keine Andreaskreuze, Schranken oder Blinklichter. »Einer dieser uralten Bahnübergänge, die seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt werden«, sagt Carla.
»Was zum Teufel macht er dann da?«, murmle ich.
»Er parkt auf den Gleisen.«
Plötzlich hören wir es beide, rechts von uns, von Norden kommend. Das Rumpeln eines herannahenden Zuges.
»Scheiße.«
»Er ist erledigt, und er weiß es«, sagt Carla. »Er will Selbstmord begehen.«
Und möglicherweise ein fünfzehnjähriges Mädchen mit in den Tod reißen.
Wir springen aus dem Wagen.
3
Wir hetzen auf den Lieferwagen zu, spüren dabei das Vibrieren des herankommenden Zuges unter den Füßen und schwärmen zu beiden Seiten aus, während der Zugführer das Signalhorn des Zuges dröhnend ertönen lässt. Das kreischende Geräusch von Metall auf Metall durchdringt die Luft, während der Zugführer vergeblich versucht, vor dem Transporter zum Stehen zu kommen, der das Gleis blockiert.
»Chicago Police! Chicago Police!«, rufe ich, während ich mich der Fahrertür nähere, auf der das Logo des Salz-Unternehmens prangt.
Im Seitenspiegel bekomme ich kurz das Gesicht des Mannes zu sehen, seine intensiv blickenden Augen. Mit durchdrehenden Reifen setzt sich der Transporter plötzlich in Bewegung, das Fahrzeug schleudert vom Bahngleis und über die Schienen – genau in dem Moment, als der Zug mit tief dröhnendem Horn an uns vorbeirauscht, Funken sprühend und mit schrill kreischenden Bremsen.
Ich mache einen Satz nach hinten und verliere dabei fast das Gleichgewicht. Carla alarmiert über ihr Funkgerät den Hubschrauber der State Police und alle Einheiten, während wir den Van auf der anderen Seite der Gleise, die jetzt der Güterzug blockiert, aus den Augen verlieren.
Mit einem Ruckeln kommt der Zug zum Stehen. »Nein!«, schreie ich. »Weiterfahren! Räumen Sie den Bahnübergang!«
Das wird ewig dauern. Der Zugführer hat seine Vorschriften. Jetzt erscheint er ganz hinten am Gleis. Wahrscheinlich kann er mich gar nicht hören. Er verflucht wahrscheinlich gerade den wahnwitzigen Fahrer, der es darauf hat ankommen lassen.
Carla geht in die Hocke und schaut unter dem Zug durch. »Ich kann hier unten durch nichts sehen!«
Ich schaue mich um, und ein Zweig streift mein Gesicht.
Ein Baum.
Ich greife nach dem dicksten Ast in meiner Nähe und tue etwas, was ich seit fünfundzwanzig Jahren nicht mehr getan habe: Ich mache einen Klimmzug an einem Ast. Doch vergeblich. Der stehende Zug versperrt noch immer die Sicht. Ich lange nach dem nächsthöheren Ast, ziehe mich an ihm empor und setze mich rittlings darauf. Da!
Ich erspähe den Lieferwagen, als dieser gerade nach links abbiegt und dabei durch etwas fährt, das wie ein Maisfeld aussieht. »Er ist nach ein paar Hundert Metern weiter Richtung Süden abgebogen!«
Ich verliere ihn aus den Augen. Aber wenigstens weiß ich jetzt, in welche Richtung er unterwegs ist. Ich klettere wieder vom Baum, springe vom letzten Ast, zerkratze mir dabei die Hände und falle mit dem Gesicht voran ins Unterholz, in dem Giftefeu wachsen könnte. »Komm schon!«, rufe ich und renne zum Wagen zurück.
Wir steigen ein. Ich lege den Gang ein, biege in die gleiche Richtung ab, in die der Van fährt, nach Süden, und fahre den abschüssigen Schotterweg neben den Bahngleisen zu meiner Rechten entlang.
»Air 6, habt ihr das Arschloch?«, ruft Carla. »Wir sind in der Nähe der Rawlings bei den Bahngleisen! Verfolgen einen weißen Lieferwagen. Er fährt Richtung Süden, wahrscheinlich eine halbe Meile südwestlich der Gleise und der Rawlings.«
»CPD 5210, sind unterwegs.«
Wir rasen den abschüssigen Schotterweg entlang, wobei unsere Reifen immer wieder durchdrehen.
»Auf zwölf Uhr«, sagt Carla zu mir.
Ich sehe es: ein massives Hindernis neben dem Gleiskörper, ein großer schwarzer Verteilerkasten, der im Schotterbett verankert ist. Ich kann ihn nicht einfach umfahren. Auf der linken Seite ist unbefestigtes Terrain, wir könnten darin stecken bleiben. Die einzige Möglichkeit besteht darin, nach rechts zu fahren und dabei fast auf die Gleise zu geraten. Carla wappnet sich.
»Hoffentlich zahlen sich gleich all die Jahre Videospiele aus«, sage ich.
Ich beschleunige und reiße das Lenkrad nach rechts, der Winkel ist gefährlich spitz, und Carla rutscht fast vom Beifahrersitz in mich hinein. Wir schrammen über die Böschung der Bahngleise und poltern wieder nach unten in Richtung des Verteilerkastens, aber der Schwung befördert uns an ihm vorbei. Der Taurus rast fast in genau das Gelände zur Linken, das ich hatte vermeiden wollen. Wir wirbeln Steine und Staub auf, aber der Taurus richtet sich wieder aus, und wir zischen weiter vorwärts.
»Air 6 an 5210, haben den weißen Van im Visier.«
Das haben wir auch. Da vorn, vielleicht hundert Meter vor uns. Er rast wieder quer über die Gleise, zurück auf die Seite, auf der wir uns befinden. Das Baird-Salt-Logo ist unverkennbar.
Er fährt im Kreis. Er fährt dorthin zurück, wo er hergekommen ist.
»CPD 5210 nimmt Verfolgung auf«, gibt Carla durch.
»CPD 5210, wir können ihn in diesen Wäldern nicht aufspüren.«
Deshalb ist er zurückgekehrt. Er kennt diese Wälder. Er weiß, wo er sich verstecken kann. Immerhin sind wir ihm noch auf den Fersen. Aber er hat einen Vorsprung. Und ich kann nicht schneller fahren, ohne auf dem unebenen Schotter die Kontrolle über den Taurus zu verlieren.
Nach neunzig Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlen, erreichen wir die Straße an der Stelle, an der der Lieferwagen die Gleise wieder überquert hat. Carla gibt besonnen und ruhig die Entwicklungen durch: »An alle Einheiten, wir müssen das Gebiet abriegeln. Sheriff 1, Sie übernehmen, Sie kennen die Gegend.«
Ich trete das Gaspedal durch, und der Taurus mit seinem für Polizeieinsätze aufgemotztem Motor rast los. Wenigstens ist diese Straße geteert, sodass wir gut vorankommen können. Aber das kann der Van auch. Ich fahre fast neunzig Meilen pro Stunde und hoffe dabei nur inständig, dass uns nichts und niemand in die Quere kommt. Ich kann es nicht zulassen, dass wir den Lieferwagen aus den Augen verlieren. Wahrscheinlich haben unsere Kollegen ihn mittlerweile auch lokalisiert, aber das ist nicht das Problem.
Das Problem ist das Mädchen und was der Typ mit ihr anstellen wird, wenn er sich in die Enge getrieben fühlt.
»Da, Harney, da …«
Wir erhaschen einen Blick auf den Van, der wieder nach links abbiegt – und den Kreis vollendet.
Er fährt zurück nach Hause?
»Verdächtiger fährt Richtung Norden«, meldet Carla. »Air 6, habt ihr ihn?«
Ich hole alles aus dem Taurus raus, rutsche dann in einer Linkskurve zur Seite weg auf einen Feldweg und baue fast einen Unfall. »Das ist die gleiche Straße«, sage ich. »Dieselbe, auf der wir ihn entdeckt haben.«
Jetzt, da wir uns sicher sind, gibt Carla es durch. Aber der Lieferwagenfahrer ist im Vorteil.
Wir sehen, wie er vor uns ein letztes Mal abbiegt.
»Er hat das alles nur gemacht, um nach Hause zurückzukehren«, sinniert Carla. »Was ist so besonders daran, wieder nach Hause zu kommen?«
Ich trete auf die Bremse, als wir um eine Kurve schlittern und den Abzweig erreichen, den der Van gerade genommen hat.
»Das werden wir gleich herausfinden«, sage ich.
4
Als wir den Abzweig erreichen, erblicken wir ein Betreten verboten-Schild, das an einer Kette quer über dem Weg baumelt. Das ergibt keinen Sinn. Wie konnte der Verdächtige hier durchrasen, und hinterher ist sie wieder befestigt?
Wie auch immer. Ich schieße mit dem Taurus durch, wobei sich die Kette mit dem Schild an beiden Seiten absenkt, noch bevor ich sie touchiere.
»Eine Art Automatik«, konstatiert Carla, überprüft ihre Waffe und rückt ihre Weste zurecht. »Wer zum Teufel ist dieser Typ?«
Wir folgen einem kurvenreichen Weg und werden wegen der Kurven langsamer. Zu langsam, um den Van einzuholen.
»Komm schon …«
Vor uns bremst der Lieferwagen vor einem Backsteinhaus ab, und das Garagentor öffnet sich. Der Fahrer gibt Gas. Hinter uns dringt das Geheul von Polizeisirenen – Staat, Bezirk, Stadt – von der Rawlings Road zu uns.
Mit quietschenden Reifen hält der Van in der Garage. Der Fahrer springt heraus. Die Hintertüren seines Wagens öffnen sich. Er greift hinein und holt ein Mädchen heraus. Afroamerikanerin, an Händen und Füßen gefesselt. Bridget Leone.
Mit dem Mädchen auf den Armen stürmt der Mann ins Haus, als wir ebenfalls zum Stehen kommen.
Ich renne in die Garage und sehe, dass die Tür zum Haus einen Spalt offen steht. Mit der Glock im Anschlag stoße ich die Tür auf und rufe: »Chicago Police!«
Ich stehe in einer Küche, oben in einer Ecke blinkt ein rotes Licht. Ein Einbruchalarm?
Wir stürmen in ein spärlich eingerichtetes Wohnzimmer mit einer Couch und einem Sessel, aber sonst kaum etwas. Auf der linken Seite befindet sich eine Tür. Rechts ist eine Schiebetür aus Glas, die auf eine Terrasse führt.
Und ein weiteres rotes Licht, das oben in der Ecke blinkt.
»Bridget! Bridget Leone?«, ruft Carla. Sie versucht es an der Türklinke. Die Tür öffnet sich, und dahinter führt eine Treppe nach unten.
Aus den Augenwinkeln erhasche ich einen Blick auf eine Gestalt, die über den Hinterhof rennt. Es ist unser Täter, Käppi und Statur passen zur Beschreibung.
»Bridget!«
Aus dem Keller ist ein leises, aber deutliches »Ja!« zu vernehmen.
»Ich übernehme den Täter, du das Mädchen!«, rufe ich Carla zu.
Ich schiebe die Glastür auf und springe von der Veranda auf die Wiese, die gut drei Meter tiefer liegt. Ich ignoriere den Schmerz in meinem Knöchel und sprinte los.
Die Wiese ist umschlossen von einer dichten Hecke aus Sträuchern, ein natürlicher Zaun, aber ich habe gesehen, wo er hineingeschlüpft ist, und ich sehe sein Käppi auf dem Pfad liegen. Ich sprinte los, die Glock in der rechten Hand. Der Pfad ist schmal, der Boden uneben. Ich könnte jederzeit in einen Hinterhalt geraten. Trotzdem renne ich so schnell ich kann durch ein Gelände, das dieses Arschloch kennt wie seine Westentasche und ich nicht.
Das Arschloch ist also im Vorteil. Aber wenn ich motiviert bin, verleiht mir das Flügel, und ich habe das Gefühl, dass das bei diesem Typen nicht der Fall ist.
Schließlich vernehme ich ihn weiter vorn, sein schweres Atmen, das Geräusch seiner Schritte. Er kommt in mein Blickfeld und rennt so schnell ihn seine Beine tragen, aber es reicht nicht.
»Polizei!«, rufe ich, so laut ich kann, während ich mit brennendem Schmerz in der Brust und pochendem Knöchel sprinte. Dann fasse ich einen Entschluss, bleibe stehen, ziele und schieße auf einen Baum vor ihm.
Das Holz zersplittert. Der Mann duckt sich und verlangsamt sein Tempo.
Dann bleibt er ganz stehen.
»Hände hoch und umdrehen!«, schreie ich und gehe weiter auf ihn zu, die Glock mit beiden Händen umklammernd.
Er hebt die Hände. Dreht sich um.
Glänzende Knopfaugen, fettiges, dunkles Haar, Knollennase. Ein großer Kopf, der von einem langen, dünnen Hals und hängenden Schultern aufragt. Große Ohren stehen von seinem Kopf ab wie bei einer Zeichentrickfigur. Der Verband baumelt von seinem Gesicht, der Schweiß hat die Oberhand über den Kleber gewonnen, sodass eine ordentliche Narbe zum Vorschein gekommen ist.
»Runter auf die Knie!«, befehle ich.
Er reagiert nicht. Stattdessen setzt er ein Pokerface auf und formt ein Wort mit den Lippen.
»Buh!«
Er schaut über meine Schulter an mir vorbei.
»Geh auf die …«
Plötzlich wird mir klar, dass er gar nicht »Buh« gesagt hat.
Er hat »Bum« gemacht.
Mein Handy summt in meiner Tasche.
Hinter mir ertönt eine grollende, donnernde Explosion. Ich wirbele herum und sehe, wie in einem riesigen orange-schwarzen Feuerball das Dach vom Haus fliegt und die Seitenwände des Hauses einstürzen.
Das gesamte Haus ist binnen fünf Sekunden in Schutt und Asche gelegt.
Ich drehe mich erneut um. Der Verdächtige ist wieder losgelaufen, biegt in den dichten Wald ab und verschwindet aus meinem Blickfeld.
Ich schaue nach vorn und zurück, stecke meine Waffe ins Holster und renne zum Haus.
5
Hastig schiebe ich Äste beiseite und stolpere über ein Loch auf dem Weg, während schwarzer Rauch den Himmel erfüllt. Ich spüre die sengende Hitze schon, bevor ich die Lichtung erreiche.
Als ich mich durch das letzte Gebüsch in den Hinterhof zwänge, schlagen mir Hitze, dunkler Rauch und Staub entgegen. Ich stürze beinahe über ein junges Mädchen, das bekleidet mit T-Shirt und Shorts auf dem Gras liegt, die Augen geschlossen.
»Bridget?« Ich beuge mich zu ihr hinunter und berühre ihren Hals, um den Puls zu fühlen. »Bridget Leone?«
Sie öffnet die Augen.
Ich halte mir eine Hand vor den Mund, um besser atmen zu können. »Bist du okay? Kannst du dich bewegen?«
Sie bringt ein Nicken zustande, blinzelt mich an und hustet.
Von der anderen Seite der Ruine kommen ein Beamter der State Police und eine Einheit des County Sheriffs angerannt. Ich winke sie herbei. Irgendwann bemerken sie mich in dem ganzen Rauch. »Das ist Bridget«, erkläre ich den Männern, während mein Blick hin und her huscht, auf der Suche nach Carla. »Bringt sie hier weg!« Aber vorher beuge ich mich dicht an ihr Ohr. »Bridget, weißt du, wo meine Kollegin ist?«
Immer noch benommen, schüttelt sie den Kopf. Sie hat keine Ahnung.
Die Beamten nehmen sie in ihre Mitte und bringen sie rasch weg von dem Feuer, dem giftigen Ruß und der sengenden Hitze.
»Der Verdächtige ist über diese Lichtung gerannt!«, rufe ich den Hilfssheriffs zu und deute in die entsprechende Richtung. »Ich glaube nicht, dass er bewaffnet war, aber sicher bin ich mir nicht! Los! Und setzt den Hubschrauber auf ihn an! Macht schon!«
Ich kämpfe mich voran, den Mund in die Armbeuge gepresst, schnell und gierig einatmend. »Carla!«, rufe ich. »Carla!« Jedes Mal beschert es mir einen Hustenanfall.
Inzwischen sind mehr als ein Dutzend Polizisten in ihren verschiedenen Uniformen am Tatort eingetroffen. Ich wende mich an zwei von ihnen und rufe: »Hier muss irgendwo eine Polizistin der Chicago Police sein!«
Kleine Feuer glimmen innerhalb der Trümmerlandschaft, aber das Haus bestand ganz aus Ziegeln und Beton, was sie größtenteils gleich wieder erlöschen ließ. Das eigentliche Problem ist die schlechte Luftqualität – durch die dicke Suppe aus Staub und rußigem Rauch kann ich kaum etwas erkennen.
Was ich allerdings erkennen kann, ist, dass das Haus dem Erdboden gleichgemacht wurde. Teile des Daches und der Wände liegen verstreut herum. Ein einziger Trümmerhaufen. Carla könnte irgendwo darunter liegen.
»Carla!«, rufe ich, und andere schließen sich mir an und rufen ebenfalls ihren Namen. Ohne es wahrhaben zu wollen, weiß ich, dass sie keine Chance hatte, falls sie noch im Haus war. Aber das Mädchen ist entkommen, also ist sie es wahrscheinlich auch.
Der Qualm wird immer dichter. Ich ziehe meine Maglite hervor und leuchte damit umher. Ein Rettungsteam löscht gerade die restlichen Flammen.
»Billy, alles okay bei dir?«
Ich drehe mich um. Es ist Lanny Soscia, ein Mitglied der SOS-Truppe. »Ich kann Carla nicht finden!«, rufe ich.
Wir durchforsten die Trümmer, Teile des Daches, der Wände, der Möbel. Ich bekomme erneut einen Hustenanfall. Jemand reicht mir eine Atemschutzmaske.
Dann erinnere ich mich daran, dass kurz vor der Explosion mein Handy gesummt hat. Ich schaue nach: Der Anruf kam von Carla. Ich drücke auf Rückruf und sehe mich um.
Im dichten Rauch, nur ein paar Meter rechts von mir, leuchtet das Display eines Mobiltelefons auf.
»Hier drüben!«, rufe ich und eile hinüber. Carla liegt unter einer Betonplatte, die ihren Körper bis zu den Schultern bedeckt.
Ihre Augen sind geschlossen. Sie sieht … Sie sieht nicht …
»Ich bin hier, Kleines, ich bin hier.« Ihr Gesicht ist rußgeschwärzt. Ich berühre ihren Hals und ertaste einen schwachen Puls.
»Hierher!«, schreie ich. »Officer am Boden! Wir brauchen einen Rettungshubschrauber!«
Carla hustet, spuckt dabei Blut und öffnet die Augen. Ich lege meine Hand über ihr Gesicht, bemüht, sie zu schützen, während ich mich neben ihr auf den Boden lege. »Das wird schon wieder«, lüge ich sie an.
Ihre Augen verengen sich zu einem Lächeln, ohne dass sie lächelt.
Sosh kommt mit mehreren Polizisten angerannt.
»Wir müssen das Ding hier von ihr runterheben«, sage ich. Ich versuche, die Platte zu verschieben. Sie schwer zu nennen, wäre untertrieben, aber wir müssen sie nur so weit anheben, dass jemand anderes Carla darunter hervorziehen kann.
»Sollten wir sie nicht lieber liegen lassen?«, fragt Sosh und beugt sich herunter.
Er könnte recht mit seinen Bedenken haben. Jemanden mit Verdacht auf Rückgratverletzungen bewegt man nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. »Wir müssen ihr zumindest das Ding hier abnehmen«, sage ich. »Wenn alle auf einmal mit anpacken, können wir es schaffen.«
Ich beuge mich zu Carla hinunter. »Setz die Maske auf, Carla, dann musst du diesen Scheißrauch nicht einatmen.«
Ich lege ihr die Maske auf Mund und Nase. Trotz ihres geschwächten Zustands gelingt es ihr, sie beiseitezuwischen. »Sag Darryl … dass ich ihn liebe und dass ich … jetzt … auf ihn zähle.«
»Sag du es ihm«, erwidere ich. »Wenn du ihn nachher siehst.«
Selbst in ihrem verwirrten, angeschlagenen Zustand gelingt es ihr, mir einen vielsagenden Blick zuzuwerfen. »Sag meinem Schatz … dass seine Mama ihn lieb hat.«
»Er weiß das«, entgegne ich mit erstickter Stimme. »Samuel weiß es, aber du wirst ihm das selbst sagen, verdammt noch mal!«
Officers wuseln um uns herum, bemüht herauszufinden, wie man diese massive Betonplatte von Carlas Körper weghebeln kann.
Sie zuckt zusammen. »Hat das Mädchen … hat …«
»Dem Mädchen geht es gut«, versichere ich ihr. »Du hast sie gerettet, Carla.«
Sie schließt die Augen.
»Setz die Maske auf«, sage ich, »dann heben wir das Ding hier von dir runter.«
Officers haben auf beiden Seiten der Betonplatte Wagenheber aufgestellt, während andere sich darauf vorbereiten, sie hochzuwuchten.
Carla befeuchtet ihre Lippen und versucht zu sprechen. »Komm … näher.«
Ich nähere mich ihr so weit wie möglich, liege praktisch Nase an Nase mit ihr auf dem Gras. Ich wische ihr den Ruß aus dem Gesicht und streichele ihre Wange. »Ich bin hier«, sage ich, kaum imstande, etwas über die Lippen zu bringen.
»Du hast mir das Leben gerettet«, flüstert sie. »Du … weißt das.« Vor Schmerz verzerrt sie das Gesicht. Ihr kommen die Tränen, und sie tropfen ihr von der Wange seitlich auf das Gras.
Die Betonplatte beginnt, sich zu heben, die Wagenheber stemmen sie vom Boden, und ein Dutzend Polizisten mühen sich damit ab, unter sie zu greifen.
»Du hast mir meines auch gerettet«, sage ich ihr und räuspere mich erstickt. »Das tun Partner eben. Wir halten zusammen.« Ich nehme ihre Hand in meine. »Wir werden immer zusammenhalten. Denkst du, ich lasse dich so einfach davonkommen? Du und ich, wir werden zusammen in Rente gehen. Du, Darryl und ich, wir werden in Schaukelstühlen sitzen und uns gegenseitig Geschichten vom Krieg erzählen.«
Mithilfe der Wagenheber bekommen die Polizisten genug Angriffsfläche, um die Platte in einen Neunziggradwinkel hochzustemmen, und lassen sie dann in die andere Richtung umkippen.
Dabei kommt eine Grasfläche zum Vorschein, die vom Ruß unberührt ist. Aber getränkt mit Carlas Blut.
»So ist es besser«, flüstert Carla mit geschlossenen Augen.
»Gut«, sage ich. »Der Rettungshubschrauber ist auf dem Weg. Bleib bei mir, Kleines. Komm schon, bleib bei mir.«
Sie antwortet nicht.
Sie macht die Augen nicht mehr auf.
»Carla!«, rufe ich.
»Carla«, flüstere ich.
6
Darryl Griffin sitzt auf einem Stuhl, stoisch, benommen, drei Stunden nach seiner Ankunft in Our Lady of the Cross. Sein Gesicht liegt im Schatten: Das Licht im Flur ist funzelig, und natürliches Licht gibt es hier nicht, weil wir uns im Keller befinden.
Im Flur vor der Leichenhalle des Krankenhauses.
»Ich hatte sie gerade erst zurückbekommen«, flüstert er. »Wir waren endlich wieder eine Familie.«
Nach drei Jahren der Trennung, meint er. Darryl und Carla hatten sich versöhnt, nachdem Carla clean geworden war, und er war wieder bei Carla, ihrem Sohn Samuel und Darryls betagter Mutter eingezogen. Carla hatte noch nie so glücklich gewirkt wie in den letzten paar Monaten.
Ich setze mich neben ihn, immer noch benommen, immer noch ungläubig. »Ihr seid auch weiterhin eine Familie«, versichere ich ihm. »Ihr habt immer noch Samuel. Carlas letzte Worte lauteten, ich solle dir sagen, dass sie sich auf dich verlässt.«
Darryl beugt sich nach vorn, lässt den Kopf in seine rauen Hände sinken und stöhnt vor Kummer. Ich lege ihm eine Hand auf den Rücken, aber es gibt nichts, was ich tun oder sagen könnte. Er wiederholt diesen Kreislauf schon seit Stunden, weint bis zur Erschöpfung, um dann wieder ruhig und dumpf dazusitzen.
Die Tür zur Leichenhalle öffnet sich. Samuel, der gerade elf Jahre alt geworden ist, tritt auf den Flur hinaus und bleibt stehen. Er hatte darum gebeten, etwas Zeit allein bei seiner Mutter verbringen zu dürfen. Er war dreißig Minuten dort drinnen. Die einzige gute Nachricht ist, dass Carla nur von den Schultern abwärts verletzt gewesen ist – ihre Wirbelsäule ist gebrochen, und sie hat massive innere Verletzungen erlitten. Aber da sie rücklings auf der Edelstahlbahre liegt und bis zum Hals in Laken gehüllt ist, konnte Samuel lediglich das makellose Gesicht seiner Mutter und den friedlichen Ausdruck darin sehen.
Als er im Flur steht, sieht er sich um, als hätte er keine Ahnung, wo er sich befindet und was er als Nächstes tun soll. Ich gehe zu ihm und nehme ihn in die Arme. Er erwidert die Umarmung nicht, steht einfach nur starr da.
»Deine Mutter wird immer deine Mutter bleiben«, flüstere ich. »All ihre Liebe, all ihre Hoffnungen und Träume für dich. Sie werden immer in dir weiterleben, Sam.«
Einen bedrückenden Moment lang bleibt er reglos und stumm. Dann spricht er langsam, zögernd, mit belegter Stimme. »Hatte … hatte sie … Schmerzen?«
»Nein, nein, nein«, wiegele ich ab. »Sie hat nichts gespürt.«
Ich wünschte, ich könnte mir da sicher sein. Einer der Sanitäter berichtete, dass ihre Wirbelsäule wahrscheinlich beim Aufprall der Platte gebrochen wurde und dieser Bruch sie jedes Gefühl von der Wirbelsäule abwärts verlieren ließ. Aber vielleicht hat er das nur gesagt, um mich zu trösten, so wie ich es gerade zu Samuel gesagt habe.
»Sie hat einem jungen Mädchen das Leben gerettet«, flüstere ich. »Sie ist eine Heldin.«
Sein schlaksiger kleiner Körper beginnt zu zittern.
Sein Vater gesellt sich dazu und übernimmt. »Komm, wir fahren nach Hause«, sagt er. Es ist schon weit nach Mitternacht. Ich winke einen der Uniformierten herbei und weise ihn an, die Familie sicher nach Hause zu bringen.
»Ich komme morgen früh vorbei«, sage ich. Ich umarme die beiden, und dann, weil es nichts anderes zu tun oder zu sagen gibt, sehe ich den beiden Männern, die es in Carlas Leben gegeben hat, erschüttert hinterher, wie sie sich den Flur entlangschleppen. Ein Telefonanruf von mir, und ihrer beider Leben wurde auf den Kopf gestellt.
Detective Lanny Soscia kommt herüber und lehnt sich an die Wand. Er hat blutunterlaufene Augen, hält ein Handy hoch und zeigt mir die Schlagzeile der Tribune auf dem Display: Polizei rettet die kleine Leone.
»Du bist berühmt«, kommentiert Sosh emotionslos.
Ich reiße mich aus meiner Lethargie. Darryl und Samuel sind jetzt weg. Auch ich hatte meine Zeit bei Carla, und ich vermute, dass ich in meinen Gebeten noch lange zu ihr sprechen werde.
Aber jetzt ist es erst mal an der Zeit, meinen Job zu erledigen. Es ist an der Zeit, sich um die Unterüberschrift der Schlagzeile zu kümmern: Entführer noch auf freiem Fuß.
»Lasst uns dieses Arschloch finden«, sage ich.
7
Sosh und ich fahren mit dem Aufzug in das zweite Obergeschoss des Our Lady, wo sich Polizisten aus allen mit der Entführung befassten Behörden drängen – State Police und Bezirkssheriff, lokale Polizisten und CPD. Als ich den Flur hinuntergehe, tritt eine bedrückende Stille ein, aus Respekt für meinen im Einsatz getöteten Partner, hier und da Händeschütteln und Rückenklopfen als Beileidsbezeugung. Jemand weist mir den Weg zu dem Zimmer, nach dem ich suche.
Ich sehe Soshs Partner aus unserem Sondereinsatzkommando, Detective Mat Rodriguez, vor Bridgets Krankenzimmer stehen. »Es gab keinen sexuellen Übergriff«, teilt er mir mit. »Kein Missbrauch jedweder Art.«
Das ist gut. Was auch immer Bridget durchgemacht hat, welche Schrecken und Traumata sie auch erlebt haben mag, zumindest ist der Kerl nicht so weit gekommen.
»Sie wurde auf der Straße aufgegriffen, in einen Kofferraum geworfen und zu dem Haus gefahren, in dem ihr sie gefunden habt. Der Typ hat sie im Keller eingesperrt, aber er hat ihr nicht wehgetan. Er hat sie nicht angerührt. Er gab ihr Essen und Wasser. Einen Eimer zum Reinpinkeln. Er hat sie sogar geschminkt, erzählte sie, und ihr die Haare frisiert.«
»Mein Gott.«
»Ja, ich weiß, er hat sie aufgedonnert. Aber er hatte sie noch nicht angefasst, zumindest nicht auf diese Weise.« Mat schüttelt den Kopf. »Sie hat sich nicht getraut, sich zu bewegen, bis er zu ihr heruntergekommen ist und sie hinten in den Lieferwagen gelegt hat. Das war der Moment, in dem ihr ihn erspäht habt.«
»Er wollte sie an einen anderen Ort bringen«, sinniere ich. »Dieser Keller war nicht ihr endgültiger Bestimmungsort. Er hat sie aus der Stadt geholt, sie in diese unbesiedelte Gegend gebracht und dann ein paar Tage gewartet, bis sich der Staub gelegt hatte, bevor er sie in einem anderen Fahrzeug wegbringen wollte.«
»Sieht so aus, ja.«
»Sonst noch was, Mat?«
Er verzieht das Gesicht. »In dem Van, während der Verfolgungsjagd, da war sie zwar hinten in einem abgeschlossenen Bereich, aber sie hat gehört, wie er ihr etwas zurief. Sie meinte, das meiste, was er gesagt hat, konnte sie nicht verstehen, aber sie hörte, dass er ihr zurief, sie solle summen. Das schrie er ihr ein paarmal zu, hat sie erzählt.«
»Er sagte ihr, sie solle summen?«
Mat zuckt mit den Schultern. »Das hat sie erzählt.«
»Okay, Mat.« Ich schiebe mich durch die Tür in das Krankenzimmer. Bridget Leone, die jünger aussieht als ihre fünfzehn Jahre, schläft friedlich in einem Bett, dessen Kopfteil um fünfundvierzig Grad aufgestellt ist. Sie hat eine Infusionsnadel im Arm, während medizinische Geräte brummen. An der Seite ihres Betts sitzen ihre Eltern. Jackson Leone, der Bauträger, erhebt sich von seinem Stuhl. Er trägt ein Button-down-Hemd, Jeans und teure Schuhe. Seine Frau Martha kauert weiter am Bett und hält die Hand ihrer Tochter. Als sie mich bemerkt, erhebt sie sich ebenfalls.
»Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll«, sagt Jackson und schüttelt mir die Hand. »Worte können es nicht ausdrücken …«
Seine Frau schlingt ihre Arme um mich und murmelt ein eindringliches »Vielen, vielen Dank, dass Sie sie uns zurückgebracht haben«.
»Das mit Ihrer Kollegin tut mir aufrichtig leid«, erklärt Jackson. »Können wir etwas tun?«
Ich hebe eine Schulter. Es gibt nichts, was er tun kann.
»Ich habe gehört, sie hat einen kleinen Jungen hinterlassen. Ist da … Wir dachten … Könnten wir etwas für ihn einrichten, das ihm in der Collegezeit hilft? Irgendetwas in der Art?«
Als ich Anstalten mache, darauf zu antworten, spüre ich, wie mich die Emotionen übermannen. Ich nicke und lege ihm eine Hand auf die Schulter. »So etwas … hätte Carla viel bedeutet«, flüstere ich.
Wir müssen alle weinen. Als wir uns wieder gefasst haben, wenden wir uns Bridget zu. Ihre Augen sind jetzt halb geöffnet; sie sieht aus wie unter Drogen gesetzt, nimmt uns aber wahr.
»Ich muss ihr ein paar Fragen stellen«, erkläre ich.
Die beiden nicken und machen mir Platz. Ich ringe mir ein Lächeln ab und stelle mich zu ihr ans Bett.
»Hi, Bridget.«
Sie blinzelt träge. »Sie sind derjenige … der mich … gefund…«
»Ja, das war ich. Kannst du mir von dem Mann erzählen, der dich entführt hat?«
Es kommt in Schüben und mit Unterbrechungen. Und es stimmt mit Mats Bericht überein – der Typ hat sie auf der Straße aufgegriffen, in den Kofferraum geworfen, sie zu diesem abgelegenen Ort gefahren, sie eingesperrt, aber er hat ihr zu essen gegeben, sie eingekleidet, geschminkt, ihr die Haare gewaschen und sie gestylt. Dabei trug er die ganze Zeit eine Skimaske, außer in dem Moment, als er sie entführte. Aber das macht nichts – ich habe sein beschissenes Grinsegesicht gesehen und werde es nie mehr vergessen.
Dann kommen wir zu ihrer Fahrt im Lieferwagen.
»Ich war … gefesselt«, erzählt sie. »An den Handgelenken und den Knöcheln. Ich war hinten im Laderaum. Ich konnte ihn nicht sehen und auch nicht richtig … hören. Es war holprig.«
Diesen Pfad im Wald als holprig zu bezeichnen, ist so, als würde man einen Hurrikan windig nennen.
»Dann sind wir einen kleinen Hügel hinaufgefahren und haben angehalten.«
Richtig – der verwaiste unbeschrankte Bahnübergang.
»Ich hörte …« Sie schluckt schwer. Bridgets Mutter tritt vor, um sie durch einen Strohhalm Wasser trinken zu lassen. »Ich habe einen Zug gehört. Gespürt, wie …«
»Du hast das Vibrieren des herannahenden Zuges gespürt.«
Sie nickt.
»An was erinnerst du dich danach?«
»Er … hat mir etwas zugerufen«, bringt sie hervor. »Er hat gerufen, ich solle summen.«
»Summen? So, wie man eine Melodie summt?«
Sie nickt. Eine nonverbale Antwort fällt ihr leichter. Wir haben jetzt gute fünfzehn Minuten geredet, und ihre Kraft lässt nach.
»Und dann … Was geschah dann?«
»Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Aber dann hörte ich, wie jemand geschrien hat: ›Chicago Police!‹«
Das bin ich gewesen, als Carla und ich uns zu beiden Seiten an den Lieferwagen heranpirschten.
»Und dann?«
»Dann zischte der Van los … echt schnell. Wir rasten über so einen Hügel und dann weiter.«
Ich schenke ihr ein Lächeln. »Du machst das toll. Kannst du mir sonst noch etwas erzählen von dem, was du den Mann hast sagen hören?«
Sie schüttelt den Kopf. »Als der Van über den Hügel gefahren ist … über die Gleise, da bin ich hinten gegen die Tür gerollt.«
»Der Schwung hat dich zu den Hintertüren befördert«, helfe ich ihr. »Weg von der Fahrerkabine.«
Sie nickt. »Da konnte ich ihn nicht mehr hören.« Sie hustet. Es ist ein tiefer, trockener Husten, weil sie nach der Explosion verschmutzte Luft eingeatmet hat.
Ich gebe ihr eine Weile, bis sie aufhört zu husten und noch einmal von ihrer Mutter Wasser bekommen hat.
»Bridget«, fahre ich dann fort, »erzähl mir noch einmal von dem Summen. Erzähl mir genau, was er gesagt hat. Wort für Wort.«
Sie schließt die Augen, um es sich ins Gedächtnis zu rufen. Dann holt sie tief Luft und wiederholt es.
»›Summ! Kannst du mich hören? Summ!‹« Sie blinzelt heftig.
»Und das war’s.«
»Ich … Das war alles, was ich gehört habe. Das war, als der Lieferwagen immer schneller wurde und ich zur Hintertür gerollt bin.« Sie lässt den Kopf auf das Kissen sinken, ist am Ende ihrer Kräfte.
Ich sehe Bridgets Eltern an. Sie wissen auch nicht mehr als ich.
Ich schaue zu Sosh herüber, der jetzt ebenfalls im Zimmer ist.
Er hat ihr gesagt, sie soll summen?
Fünf Wochen später: Mai Montag
8
Veronica versucht, sich zu konzentrieren.
Sie hört: das Brummen eines Automotors. Eine Hupe ertönt. Das Schreien in ihrem Kopf. Bitte, lieber Gott, lass nicht zu, dass er mir wehtut, lass nicht zu, dass er mich tötet.
Sie spürt: das Rumpeln, als sie durch ein Schlagloch fahren, die Bewegung des Autos, als es um eine Ecke biegt. Sie spürt den Schweiß, der ihr von der Stirn tropft, aber er gelangt nicht in ihre Augen.
Sie schmeckt: den bitteren Knoten des Seils in ihrem Mund, das ihr fest um den Hinterkopf gebunden wurde.
Sie sieht: nichts. Nichts, seit er ihr die Augen verbunden hat.
Nach einer Weile lassen das Anhalten und Anfahren, die Bodenwellen und Kurven nach, und es geht in eine sanfte, gleichmäßige Fahrt über. Sie versucht zu schätzen. Egal, wie heftig ihr Herz pocht, und ungeachtet der wachsenden Furcht versucht sie, sich eine Vorstellung von der Richtung zu machen, in die sie fahren, während sie gefesselt und mit verbundenen Augen im Kofferraum eines fremden Autos liegt.
Sie schätzt, dass sie schon etwa vierzig, fünfundvierzig Minuten unterwegs sind. Sie schätzt, dass er die Straßen der South Side durchquert und nun den Highway erreicht hat. Aber ob er die Kennedy oder die Edens nimmt, ob er nach Norden oder Süden fährt, vermag sie nicht zu sagen.
Veronica weiß nicht, warum er das hier tut oder was er vorhat. Sie weiß nicht, wer er ist, konnte sein Gesicht nicht sehen. Sie weiß nur, dass der Mann sie gegen zwei Uhr nachts in ihrem Schlafzimmer überrumpelt hat, dabei eine Skimaske trug und eine Waffe in der Hand hielt.
Während er ihr mit einer Hand den Lauf der Pistole an die Stirn presste, schob er seine andere langsam unter das Bettzeug und legte seine Hand zwischen ihre Beine. Er bewegte die Hand nicht, benutzte seine Finger nicht so, wie sie es befürchtete. Aber er sagte ihr, dass er es könnte.
Ich kann alles mit dir machen, was ich will, sagte er. Und das werde ich auch, wenn du nicht tust, was ich dir befehle. Ich werde tun, was ich will, und dann jage ich dir eine Kugel in den Schädel.
Also sei brav, Veronica, dann ist es bald vorbei.
Sie schätzt, dass weitere dreißig Minuten vergangen sind. Sie konnte den schreienden Schmerz in ihrem Kopf nicht ausblenden oder gar die Panik besänftigen, die ihre Fähigkeit zu denken und zu rechnen beeinträchtigt. Sie weiß nicht, in welche Richtung sie gefahren sind, und die zurückgelegten Meilen kann sie bestenfalls grob einschätzen.
Sie könnten sich inzwischen überall im Großraum Chicago befinden.
Sie hört den Großteil der Außengeräusche, das leise Rattern von Maschinen, während das Auto fast zum Stillstand kommt.
Eine Garage. Das Tor rollt nach oben, und das Auto fährt hinein.
Das Auto hält an. Der Motor erstirbt. Schritte. Jetzt kommt er zu ihr. Ihr Herz rast, sodass sie weder denken noch sprechen kann …
Helles Licht durchdringt ihre Augenbinde.
»Hallo, Veronica«, sagt der Mann. »Ich werde jetzt deine Knöchel losbinden, damit du gehen kannst. Nicke, wenn du verstehst.«
Sie nickt.
»Danach hole ich dich aus dem Auto und führe dich ins Haus. Solange du kooperierst, werde ich dir nicht wehtun. Nicke, wenn du das verstehst.«
Sie nickt.
»Ich habe immer noch meine Waffe. Möchtest du sie wieder an deinem Kopf spüren?«
Sie schüttelt den Kopf.
»Möchtest du, dass ich meine andere Hand dahin lege, wo ich sie vorhin hingelegt habe?«
Nein, denkt sie und schüttelt wieder verneinend den Kopf.
»Tu, was ich dir sage, Veronica, und nichts von beidem wird passieren.«
Er zerrt sie aus dem Kofferraum. Da sie jetzt die Beine frei bewegen kann, steht sie mühsam auf, wobei ihre Knie vor Schreck fast zusammenschlagen. Er schiebt sie vorwärts, eine Hand auf ihrer Schulter. Sie macht, immer noch mit verbundenen Augen, zaghafte Schritte. Er führt sie zwei Stufen hinauf und durch eine Tür hindurch. Statt nach Benzin riecht es jetzt nach Essen aus der Mikrowelle. Linoleumboden. Eine Küche.
Sie geht weiter, biegt um eine Ecke. Teppichboden.
Sie bleiben stehen. Der Fremde lässt seine Hand auf ihr, aber es scheint, als würde er mit der anderen an die Wand klopfen. Sie hört ein hydraulisches Zischen, spürt einen Luftzug.
Er schiebt sie vorwärts. Einen Moment lang befürchtet sie, dass er sie ins Leere stößt, in den Tod, doch dann berühren ihre nackten Füße einen Stahlboden, der eine halbe Stufe tiefer liegt. Sie stolpert vorwärts gegen etwas aus Glas, stößt sich die Wange, bewahrt jedoch das Gleichgewicht.
»Vorsicht, Stufe! Hätte dich wohl warnen sollen.«
Sie vernimmt, dass ein Knopf gedrückt wird und dass sich Türen klickend schließen. Dann gleiten sie, von einem weiteren summenden Geräusch begleitet, nach unten.
Ein Aufzug.
Die Fahrt dauert nicht lange, in einem normalen Aufzug vielleicht ein oder zwei Stockwerke. Dann hört sie, wie die Türen auseinandergleiten.
Und sie spürt die Waffe an ihrem Hals.
Der Mann bindet ihr die Hände los. »Hör gut zu, Veronica. Ich möchte, dass du die Augenbinde noch sechzig Sekunden lang aufbehältst. Ich möchte, dass du bis sechzig zählst. Ich werde dich beobachten. Wenn du die Augenbinde nicht aufbehältst, bis du bis sechzig gezählt hast, werde ich sehr wütend werden. Du willst doch nicht, dass ich wütend werde, oder?«
Sie schüttelt den Kopf.
Er stößt sie aus der Aufzugkabine. Sie kämpft noch um ihr Gleichgewicht, als hinter ihr auch schon die Türen zugehen. Der Aufzug gleitet mit einem summenden Geräusch nach oben.
Andere, dickere Türen schließen sich mit einem lauten, dumpfen Geräusch.
Sie zählt bis sechzig. Dann zieht sie sich die Augenbinde ab.
Sieht sich um.
Und schreit.
9
»Soweit man weiß, ist er tot. Sieht nach einer Sackgasse aus.« Der Streifenpolizist, ein junger Bursche namens Walden, lässt die Akte auf meinen Schreibtisch fallen.
Ich hebe sie auf und pfeffere sie ihm gegen die Brust. »Finde ihn«, raunze ich ihn an. »Und dann kannst du mir sagen, ob es eine Spur oder eine Sackgasse ist.«
»Er ist ein obdachloser Junkie und ein Sexualstraftäter, Billy. Er liegt mittlerweile vermutlich mit einer Überdosis irgendwo unter einer Brücke. Wir haben an allen nur erdenklichen Orten nach ihm gesucht.«
»Schaut genauer hin«, entgegne ich. »Strengt euren Grips mehr an.«
»Detective, ich will ja nur …«
»Wir können den Auftrag auch jemandem geben, dem es nicht am Arsch vorbeigeht, dass ein Polizistenmörder immer noch auf freiem Fuß ist, frische Luft atmet und das Leben von Riley lebt, während ein hochdekorierter Detective sechs Fuß unter der Erde liegt. Ist es das, was du mir sagen willst, Walden? Dass es dir am Arsch vorbeigeht?«
»Hey, hey, hey. Jetzt mal halblang. Zeig her.« Als Soscia an meinem Schreibtisch angelangt ist, nimmt er Walden die Akte ab und liest sie durch. »Also, was haben wir denn da: Ein Typ, der unter dem Lower Wacker schläft, dachte, er hätte den Täter auf einer Phantomzeichnung erkannt, und jetzt fahnden wir nach allen, die unter dem Lower Wacker schlafen? Das sind so an die hundert Leute, mehr oder weniger, in jeder Nacht.«
»Ja«, erwidere ich, »und wenn du eine bessere Spur hast, bin ich ganz Ohr.«
Sosh legt dem Streifenpolizisten eine Hand auf die Schulter. »Alles gut, Walden. Wir übernehmen ab hier.«
Ich sehe zu, wie Walden sich verkrümelt, dann fahre ich Sosh an: »Was soll das bedeuten, Teufel noch mal?«
»Das soll, Teufel noch mal, bedeuten, dass du die Ermittler dazu bringst, wie der Hamster im Rad zu laufen«, sagt Sosh. »Der Täter hat sich in Luft aufgelöst, Junge. Die Spur ist kalt geworden.« Mit einer übertriebenen Geste der Entschuldigung streckt er beide Hände aus. »Wir werden ihn finden. Wir suchen überall, wo wir suchen können. Wir haben alle nur menschenmöglichen Fahndungsaufrufe laufen. Er wird schon noch auftauchen. Das weißt du. Aber du machst dich und alle anderen gerade vollkommen fertig …«
»Harney!«
»… und das schon seit über einem Monat. Es wird Zeit, dass du es langsamer angehst, du Wadenbeißer.«
»Ich entscheide, wann es Zeit ist«, entgegne ich.
»Harney!«, ertönt erneut eine Stimme hinter uns. »Himmel noch mal, habe vielleicht immer noch ich das Sagen hier – oder habe ich ein Memo verpasst?«
Wir drehen uns beide um. Lieutenant Wizniewski steht in der Tür zu seinem Büro, nachdem er zweimal meinen Namen gerufen hat.
»Soweit ich weiß, haben immer noch Sie das Sagen, Lew«, bestätigt Sosh. »Und, haben Sie diese Woche schon das Auto des Präsis gewienert?«
»Darüber reden wir noch«, sage ich an Sosh gewandt.
Als ich Wiz’ Büro betrete, sitzt der schon wieder hinter seinem chaotisch unordentlichen Schreibtisch. Eigentlich fehlt nur die sonst so obligatorische nicht angezündete Zigarre zwischen seinen Lippen; er kaut in letzter Zeit Kaugummi, um seinen Mund anderweitig zu beschäftigen.
Er grinst mich breit an, wobei ein Stück Kaugummi zwischen seinen Zähnen sichtbar wird.
»Worüber freuen Sie sich so?«, frage ich. »Haben Sie ein neues Körperspray geschenkt bekommen?«
»Nee«, blafft er mich an.
»Haben Sie was mit Ihren Haaren gemacht? Denn ich muss schon sagen, Lew, Sie haben noch nie besser ausgesehen.«
Er schüttelt seinen so gut wie kahlen Kopf, und sein pausbäckiges Gesicht erhellt sich. »Okay, Harney. Sind Sie fertig?«
»Ich will keinen neuen Partner«, komme ich ihm zuvor.
»Ich sagte auch nicht, dass Sie einen bekämen.«
»Okay, was dann?«
»Lassen Sie mich der Erste sein, der Ihnen gratuliert«, setzt er an. »Wieder einmal haben Sie durch harte Arbeit und hervorragende Ergebnisse Lorbeeren eingeheimst.«
Mit übertriebener Geste werfe ich einen Blick hinter und über mich.
»Was zum Teufel machen Sie da?«
»Ich halte Ausschau nach einem Messer in meinem Rücken«, erwidere ich. »Oder nach einer Guillotine.«
»Entspannen Sie sich. Wir gründen eine neue Task Force innerhalb der SOS.«
Ich schneide eine Grimasse. »Der Witz bei der Special Ops ist doch gerade der, dass es sich schon um eine Spezialeinheit handelt. Und jetzt brauchen wir eine Spezialeinheit in der Spezialeinheit?«
»Offensichtlich. Und Sie werden sie leiten.«
Das lasse ich mir einen Moment durch den Kopf gehen. »Ich bin gerade mitten in einem Fall«, bringe ich schließlich vor.
»Sie sollten eigentlich gerade dabei sein, die Imperial Gangster Nation zur Strecke zu bringen«, sagt er. »Wissen Sie, wie viele Leute die Nation allein im letzten Monat ins Jenseits befördert hat?«
»Sechs.«
»Ge…nau«, sagt er. »Und wir haben summa summarum null Fälle gelöst.«
»Wir sind nahe dran, Lew. Das wissen Sie doch. Jeden Tag …«
»Ja, ich weiß, Harney, aber Sie wissen ja, wie das läuft. Noch eine Schießerei in der West Side, und die Presse wirft mit Scheiße auf den Bürgermeister. Der Bürgermeister scheißt deshalb auf den Polizeipräsidenten, der Polizeipräsident scheißt auf mich, und …«
»Und ich stehe unter Ihnen.«
Er zeigt auf mich. »Das tun Sie, mein Freund. Der Bürgermeister will der Öffentlichkeit erzählen, dass wir eine brandneue Task Force eingerichtet haben, die sich der Zerschlagung der Gangs widmet, also sagt der Präsi, dass wir es tun werden und Sie sie leiten werden. Und das bedeutet, dass Ihr ganzer Fokus sich ab sofort darauf richtet. Ihr ganzer Fokus.«
»Was heißt, dass ich nicht weiter nach Carlas Mörder fahnden soll«, sage ich. »Ich kann nicht beides auf einmal machen.«
»Leider nein.«
»Die Botschaft lautet also, dass es uns am Arsch vorbeigeht, wenn jemand einen von uns tötet?«
»Die Botschaft lautet, dass wir ein riesiges Polizeiaufgebot aus mehreren Bezirken einsetzen, das nach diesem Perversen fahndet, und wir werden ihn schnappen. Aber Sie, Mr Supercop, widmen sich der Imperial Gangster Nation und einem gewissen Jericho Hooper.«
»Ich werde die Nation und Jericho im Auge behalten«, erkläre ich. »Aber ich werde auch den Perversen schnappen.«
Wiz lehnt sich in seinem Schreibtischstuhl zurück, beäugt mich und kaut so heftig auf seinem Kaugummi herum, als wolle er es für meine Widerworte bestrafen. Seine markante Stirn beginnt zu glühen. »Sehen Sie, Sie haben eine Menge Vorschusslorbeeren bekommen, Harney«, sagt er und lächelt. »Sie haben eine große Tat vollbracht mit diesem Mädchen Bridget. Und Sie haben Ihren Partner verloren. Aber dieser Vorschuss reicht nicht ewig. Sie bekommen eine neue Anstellung.«
»Ich nehme sie nicht an.«
»Ich sagte gerade, dass Sie es tun.«
»Ja, das hatte ich bereits verstanden. Ich werde es tun, nachdem ich den Perversen geschnappt habe.«
»Sie werden es sofort tun!«, ruft er mir hinterher, während ich aus seinem Büro stürme.
10
»Was ist denn mit dir passiert?« Sosh wirft sich gerade sein Sportsakko über, als ich an meinen Schreibtisch zurückkehre.
»Mir wurden gerade die Eier abgeschnitten.«
»Tut mir leid wegen ... Du weißt schon. Ich fahre mit Winters zu einer Durchsuchung. Komm mit.«
»Ich passe.« Ich schaue zu meiner Rechten hinüber, zu dem leeren Schreibtisch mit seiner freien, polierten Holzoberfläche. Keine Fotos von Samuel und Darryl mehr. Keine lederne Arbeitstasche auf dem Boden. Keine Klugscheißersprüche mehr.
Ich hätte derjenige sein können, der auf der Suche nach Bridget in den Keller ging. Carla hätte dem Täter hinterherjagen können. Dann wäre sie jetzt noch am Leben, mit ihrem kleinen Sohn und ihrer wieder auflebenden Beziehung zu ihrem Ex. Wäre bei ihrer Familie, die sie braucht. Und ich wäre derjenige, der unter der Erde läge. Ich, der ich keine Ehefrau und keine Kinder habe, die auf mich angewiesen sind.
Diese eine Entscheidung, in diesem Bruchteil einer Sekunde, in der die Aufgaben geteilt werden. Wer immer den Kürzeren zieht: Tut mir leid wegen ... Du weißt schon.
»Billy, komm mit. Fahr mit uns. Das würde dir guttun.«
Ich erwache wie aus einer Trance Ich hatte nicht bemerkt, dass Sosh immer noch neben mir steht. Er weiß, wo ich mit meinen Gedanken war, und starrt ebenfalls zu Carlas Schreibtisch hinüber. Er hat mir schon ein Dutzend Predigten gehalten. Man weiß es nie. Das ist eben so. Die Risiken des Jobs. Sie kannte die Risiken. Sie würde wollen, dass du weiter deinen Job machst.
»Mir geht’s gut«, sage ich.
»Wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, komm doch heute Abend ins Hole.«
»Klar, wir sehen uns dann dort.«
Ich gehe aufs Klo und spritze mir am Waschbecken Wasser ins Gesicht. Als ich in den Spiegel schaue, wünschte ich, ich hätte es nicht getan. Ich denke an Samuel, diesen großartigen kleinen Jungen, für den Carla die Welt war. Alles, was ich tun kann, ist, mich ab und zu um ihn zu kümmern. Es scheint ihm relativ gut zu gehen, vor allem, weil sein Dad wieder auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Aber er wird viel schneller erwachsen werden müssen, als er sollte.
Und das alles nur, weil so ein Perverser gern junge Mädchen entführt und seinen Spaß mit ihnen hat.
Dieser verdammte Perverse, das Grinsen in seinem Gesicht, als er mir gegenüberstand und mit den Lippen »Bum« formte.
Und ich soll aufhören, Jagd auf ihn zu machen?
Ich schlage gegen die Wand der Toilettenkabine, bis meine Knöchel bluten, weil sonst nichts in der Nähe ist, auf das ich einschlagen könnte. Nachdem ich der Kabine eine Lektion erteilt habe, die sie nie vergessen wird, atme ich tief durch und verlasse den Waschraum.
Mein Handy klingelt in meiner Tasche. Der Anruf kommt von einem Mobiltelefon mit der Vorwahl 812.
Ich kenne die Vorwahl. Die einzige Person, die ich in Terre Haute kenne, kann mich unmöglich von einem privaten Anschluss aus anrufen.
»Harney«, melde ich mich.
»Was zum Teufel machst du da?«
Er ist es. Diese typische tiefe, kratzige Stimme, mit der er das Gespräch ohne Begrüßung beginnt. Es ist Pop. Mein Vater, der verurteilte Straftäter, der für den Rest seines Lebens im bundesstaatlichen Hochsicherheitsgefängnis in Terre Haute, Indiana, einsitzen wird.
»Was meinst du?«, frage ich. »Von wo aus rufst du an?«
»Ich? Oh, ich schlürfe Bananen-Daiquiris auf den Cayman Islands. Was zum Teufel glaubst du denn, wo ich bin?«
Pop und ich haben keine, sagen wir mal herzliche Beziehung. Ich habe ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass ich nie wieder mit ihm reden will, und er hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass es ihm scheißegal ist, was ich will.
Er ruft mich einmal pro Woche an. Ich erkenne es immer an der Anrufer-ID eines eingeschränkten Telefondienstes, der vom Federal Bureau of Prisons betrieben wird. Am Anfang habe ich ihn einfach auf die Mailbox quatschen lassen, damit er die ihm zustehende Telefonzeit nutzen konnte, um mir über irgendein Thema eine Predigt zu halten. Und ich hörte mir die Nachricht dann später an. Trotz allem – sei es aus morbider Neugier oder wegen des Mysteriums familiärer Bande – hörte ich sie mir an.
Vor über einem Monat, nach dem Tod von Carla, rief er ebenfalls an. Aus irgendeinem Grund ging ich ans Handy. Wahrscheinlich war ich nach dieser Tragödie ungewohnt sentimental. Ich weiß es nicht. Aber ich nahm den Anruf direkt entgegen. Und dann fing ich an zu heulen wie ein Kind. Ich hasste es, dass ich ihm wieder diese Nähe zu mir, diese Verbindung mit mir gestattete.
»Ich meinte die Handynummer«, sage ich. »Was ist mit deiner Telefonkarte?«
»Ist doch wurscht. Hör mal, eins solltest du inzwischen wissen: Es ist besser, für sich selbst zu arbeiten als für jemand anderen.«
Ich gehe an Wiz’ Büro vorbei. »Okay, danke für diese Lebensweisheit. Sonst noch was? Soll ich mir auch die Zeit nehmen, stehen zu bleiben und an den Rosen zu schnuppern?«
»Immer diese negative Einstellung. Bei all meinen Kindern, aber vor allem bei dir.«