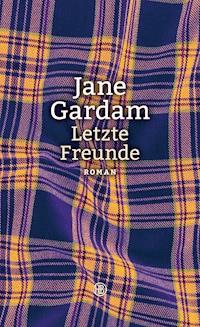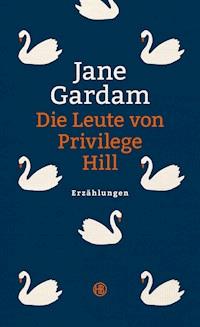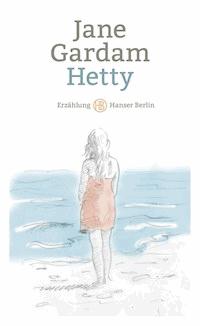Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein weiser und zugleich irrwitzig komischer Roman der Bestseller-Autorin Jane Gardam über Glück und Grausamkeit des Erwachsenwerdens Man kann spannender aufwachsen als Marigold Green. Das Jungeninternat in Yorkshire, dem ihr Vater vorsteht, ist alles, was sie mit siebzehn von der Welt gesehen hat, richtige Freunde hat sie keine, und die Kommunikation mit ihrem Vater beschränkt sich auf schweigsame abendliche Schachpartien. Grell sind hier nur ihre leuchtend orangeroten Locken, ihre übersteigerte Fantasie und ihr vollkommen unangepasstes Auftreten. Da kehrt aus dem Nichts ihre einzige Kindheitsfreundin Grace zurück, von der sie jahrelang nichts gehört hat, umwerfend schön, nonchalant und rätselhaft, und plötzlich ist nichts mehr, wie es war … Mit ihrem ganz besonderen Humor erzählt Jane Gardam von den Grausamkeiten der Adoleszenz und der verblüffenden Allgegenwart des Eros in der bigotten nachviktorianischen Gesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Man kann spannender aufwachsen als Marigold Green. Das Jungeninternat in Yorkshire, dem ihr Vater vorsteht, ist alles, was sie mit siebzehn von der Welt gesehen hat, richtige Freunde hat sie keine, und die Kommunikation mit ihrem Vater beschränkt sich auf schweigsame abendliche Schachpartien. Grell sind hier nur ihre leuchtend orangeroten Locken, ihre übersteigerte Fantasie und ihr vollkommen unangepasstes Auftreten. Da kehrt aus dem Nichts ihre einzige Kindheitsfreundin Grace zurück, von der sie jahrelang nichts gehört hat, umwerfend schön, nonchalant und rätselhaft, und plötzlich ist nichts mehr, wie es war … Mit ihrem ganz besonderen Humor erzählt Jane Gardam von den Grausamkeiten der Adoleszenz und der verblüffenden Allgegenwart des Eros in der bigotten nachviktorianischen Gesellschaft.
Jane Gardam
Tage auf dem Land
Roman
Aus dem Englischen von Monika Baark
Hanser Berlin
Für
WP + VA x 47
1918—1965
»Jugend heißt stolpern.«
Benjamin Disraeli, Coningsby oder die neue Generation.
»Und nun das Gegenstück zum vorigen logischen Schluss! Jetzt wird es verzwickt, pass also gut auf, es könnte sich als tröstlich erweisen.«
Tom Stoppard, Rosenkranz und Güldenstern sind tot
Prolog
Das Interview schien vorbei zu sein. Die Rektorin des College saß da und betrachtete die Kandidatin. Die Rektorin saß mit dem Rücken zum Licht, ihre kräftige, kurze Silhouette hob sich scharf gegen das Fenster ab, und nur der Flausch ihrer alternden, aber ziemlich hübschen Haare lockerte die ganze Erscheinung etwas auf. Draußen der graue und grausame Cambridger Nachmittag — Dezember und Regen.
Die Kandidatin saß vor ihr und fragte sich, was nun? Der Stuhl hatte eine weiche Sitzfläche, aber hölzerne Lehnen. Sie schlug die Beine erst so rum übereinander, dann andersrum — dann fragte sie sich, ob man die Beine überhaupt übereinanderschlagen durfte. Sie fragte sich, ob sie aufstehen sollte. Neben ihr lag ein Zigarettenkästchen. Sie fragte sich, ob man ihr eine Zigarette anbieten würde. Im Bücherregal stand eine Karaffe Sherry. Sie sah aus, als würde sie selten benutzt.
Dies war das dritte Interview des Tages. Das erste war genau wie erwartet gewesen — mäkelig, schnippisch, harsch, argwöhnisch — unfreundlich, noch bevor man die Hand vom Türknauf genommen hatte. Ein Härtetest. Typisch Cambridge. Ein Zeichen der Zeit. Eine Stunde später dann das zweite Interview — fünf Leute diesmal hinter einem Tisch — vier Frauen, ein Mann, alle in alten Klamotten. Ganz schön ausführlich. Aber höflich. Gar nicht so schlecht. »Haben Sie irgendwelche Fragen an uns?«
(»O ja. Ich möchte wissen, warum ich hier bin. Ob ich wirklich hierherkommen will, selbst wenn ihr mich nehmt. Wie ihr alle so seid. Ob ihr jemals verrückt wart vor Liebe? An Selbstmord gedacht habt? Im Kino geweint? Jemanden in einem Bett umschlungen?«)
»Nein, danke. Ich glaube, Miss Blenkinsop-Briggs hat meine Fragen heute Morgen beim Interview schon beantwortet.« Sie bewegen ihre Stifte, schürzen die Lippen, drehen sich aus der Hüfte zueinander, legen die Fingerspitzen zusammen. Ich merke auf. Ich setze mich gerade hin. Ich mustere sie kühl, aber nicht respektlos. Hier könnte ich eine Chance haben. Aber denk nicht, es sei ein gutes Zeichen, wenn sie nett zu dir sind, hat die olle Miss Bex gesagt.
Und jetzt sitzen wir hier. Das dritte Interview. Die Rektorin kennenlernen. Ein Gespräch mit der Rektorin heißt, ich habe Chancen auf ein Stipendium. Unfassbar!
Im Gegenlicht kann ich ihr Gesicht nicht erkennen. Sie hat etwas Grübelndes. Sie ist eine Masse. Unter dem Flausch ist Masse. Eine massive Intelligenz, die vor sich hin klickt und tickt — beobachtet, bewertet, aussiebt, einordnet. Kein Gefühl, keine Regung, kein einziger dummer Gedanke. Eine beeindruckende Frau.
Sie steht auf. Es war uns eine Freude. Sie hoffe auf ein Wiedersehen. (Heißt das, sie nehmen mich?) Von so weit her sei ich gekommen für das Interview. Ganz aus dem Norden. Sie hoffe, ich sei gut untergebracht gewesen.
Wir geben uns auf sehr nordische Weise die Hand. Dann schlüpft sie in einen Mantel — sehr schöner Mantel. Pelz. Schöner Pelz. Irgendwo schimmert da was Menschliches durch. Sie begleitet mich zur Tür und die Treppe runter, und auf den Collegestufen bleiben wir noch mal stehen.
Ein kalter weißer Nebel wirbelt umher, steigt vom Fluss auf. Die Bäume sind schlank, peitschen mit ihren langen schwarzen Ruten das Wasser. Ein Innenhof, frostig, herrlich proportioniert. Ein Brunnen, ein Tor. In den Fenstern rings um den Innenhof gehen nach und nach die Lichter an. Aber es ist feucht, alt, kalt, kalt, kalt. So kalt wie zu Hause.
Soll ich hierherkommen?
Würde es mir am Ende vielleicht doch gefallen?
Kapitel 2
In diesem ganzen großen Frieden ist natürlich immer Paula da gewesen, und vielleicht wäre ein solcher Frieden ohne Paula unerträglich gewesen. Vielleicht war er ja unerträglich, wie mir heute aufgeht. Vielleicht ist meine Mutter deshalb so plötzlich gestorben. Vielleicht hat meine Mutter einen Blick auf mich geworfen und sich gedacht: »Erst langweile ich mich zu Tode, und dann das.« Ich glaube, es könnte Paula sein, die Vaters wundervolle Friedlichkeit so begehrenswert macht, und der große Tornado namens Paula ist es, der die stille Luft um Vater herum so angenehm macht.
Sie ist sechsunddreißig und kommt aus Dorset. Das an sich ist schon aufsehenerregend für uns hier oben. Im Nordosten trifft man jede Menge Leute aus Pakistan oder Jamaika oder Uganda oder Sambia oder Bootle, aber kaum jemanden von der Südküste Englands.
Paula kam mysteriöserweise hierher — ich glaube nicht, dass sie die Sache richtig durchdacht hatte —, als sie siebzehn war, zur Unterstützung der damaligen Hausmutter, die sich hastig in den Ruhestand begab und Paula den Weg zur Macht ebnete. Sie muss unanständig jung ausgesehen haben und war es ja auch, aber den Direktor oder das Direktorium oder den Bildungsbeauftragten oder Kaiser oder Fürsten oder sonst einen Machthaber hätte ich sehen wollen, der es geschafft hätte, diese Siebzehnjährige zu vertreiben, wenn sie sich in den Kopf gesetzt hatte, zu bleiben. Und ich denke, weder die Gestapo, der KGB noch eine Heerschar Midianiter hätten Paula missen wollen. Sobald man sie kennt, braucht man sie. Die Welt geht zugrunde, die Lichter gehen aus, und alle tappen nur noch im Dunkeln, sobald Paula den Raum verlassen hat.
Paula — ist einfach bezaubernd. Sie hat einen grandiosen geraden Rücken mit dem langen Hals einer Herzogin und einen Riesenschwall Haare, die am Oberkopf mit einer Nadel zu einem seidigen Bündel zusammengesteckt sind. Sie ist hochgewachsen, hat eine fein gezeichnete schmale Figur mit abgeschrägten Schultern, und alles, was sie trägt, sieht teuer aus. Auf Vaters Veranstaltungen kommt sie in egal was hereingerauscht und setzt sich egal wohin, und alles dreht sich nach ihr um. Sie nickt und lächelt nach hierhin und nach dorthin, und all die Metzgersfrauen in Polyester und Ohrringen auf dem Tanzboden sehen aus wie reihenweise nadelnde Weihnachtsbäume.
Paula redet manchmal, als wäre sie aus Hardys Am grünen Rand der Welt entsprungen — so schön. »Brav, mein Hase«, »Brav, mein Liebchen«. Um Ihnen die volle Großartigkeit Paulas zu veranschaulichen — noch nie habe ich gehört, dass jemand gekichert hätte, wenn sie zu einem der Jungen auf ihrer Krankenstation »Brav, mein Liebchen« sagt.
Paulas tiefe lustige kratzige Stimme passt zu ihren rosigen Wangen und flinken Füßen. Sie ist ständig am Rennen, und meistens in deine Richtung. Bei dem Vers »O einen Becher warmen Südens jetzt« muss ich immer an Paula denken, was ich ihr auch gesagt habe, als sie mir zum ersten Mal Keats vorlas, als ich ungefähr elf war. Ich habe sehr spät angefangen zu lesen, und es fiel mir selbst mit elf noch schwer, mich hinzusetzen und für längere Zeit zu lesen, also hat Paula mir vorgelesen. Ich wünschte, sie täte es noch heute.
»Im warmen Süden«, sagt Paula. »Da wär ich jetzt gern, statt in diesem gottverlassenen Nest.«
»Wieso bist du dann hiergeblieben?«, ruft der tagesaktuelle Junge aus dem Isolierzimmer. Es gibt ein Isolierzimmer für einsame Leidende und einen größeren Raum für Epidemien. Im Isolierzimmer liegt fast immer jemand, meist einer von den Kleinsten. Sie kommen in Trauben. »Hausmutter, ich bin krank«, »Hausmutter, mein Blinddarm bricht durch«, »Hausmutter, ich hab ein Loch in der Lunge«, und zack, wumms, hat sie sie gepackt, Fiebermessen, Pulsmessen: »Unfug, mein Liebchen. Lass den Quatsch, ja? Setz sich aufs Bett, trink einen Kakao und sei still, während ich unserer Marigold vorlese.« Sie biegt sie alle wieder zurecht, die Kranken wie die Heimwehkranken. Manchmal sagen sie schreckliche Sachen.
»Hausmutter, ich blute aus den Ohren.«
»Hausmutter, Terrapin hat Selbstmord begangen.«
»Hausmutter, Boakes liegt im Koma.«
Wenn es nicht wahr ist, und das ist es fast nie — weiß sie Bescheid. Wenn es wahr ist, wird sie zu einem brausenden Wirbelwind, das städtische Krankenhaus steht sofort stramm, und sie saust darauf zu, wirft Pfleger um wie Bowlingkegel und begleitet die Trage mit meisterlich wippendem Haarbausch bis vor die Türschwelle des Operationssaals. Ja, Paula ist allen wohlbekannt. Wenn jemand auf Prüfungsergebnisse wartet, ist es Paula, die sie als Erste rauskriegt. Bei Tagesanbruch steht sie unten vorm Postamt. Man rechnet schon mit ihr. Und wenn es Ärger gibt oder irgendwas Aufregendes in der Familie eines Jungen, weiß sie es im selben Moment, manchmal sogar eher.
»Wieso bist du dann hiergeblieben?«, fragte der tagesaktuelle Patient, nachdem ich ihr gesagt hatte, sie sei wie der warme Süden.
»Weiß der Kuckuck, mein Liebchen.«
»Welcher Kuckuck?«, fragte der Junge. Wahrscheinlich war es Terrapin oder Boakes. Im ersten Jahr sah man sie fast unausgesetzt Kakao schlürfen.
»Na, der Kuckuck eben. Noch Fragen?«
Terrapin (oder Boakes) lag warm eingepackt hinter der Tür zum Isolierzimmer. Ich saß auf dem Boden vor Paulas Wohnzimmerkamin. Paula saß im Schaukelstuhl, mit straffem Rücken unter ihrem Haar und Keats auf dem Schoß.
»O Hippokrene, die zum Rande schäumt.«
Das Feuer flammte auf. Draußen wehte ein roher, trostloser Wind, und ein schwarzer Ast tippte gegen die Scheibe, Möwen kreischten sich verzweifelt an, das Meer brauste. Auf dem Kaminsims stand ein Bild von Paulas Familie — ein Farmer auf einem Heuwagen und viele kleine Kinder in Schlapphüten, die grinsend in die Sonne blinzelten. Irgendwo bei Lyme Regis offenbar, wo immer das war. Dorset. Wessex. Der warme Süden.
»Warum bist du hiergeblieben, Paula?«
»Wer soll euch denn sonst Geschichten erzählen?«, sagte Paula. »So bin ich nun mal. Ich bin anscheinend eine sehr nette Frau.«
Sie las weiter die Ode an eine Nachtigall, und Terrapin — ich erinnere mich jetzt, dass es Terrapin war — schnitt von seinem Krankenbett aus besonders hässliche Grimassen in meine Richtung, auf allen vieren und vorgebeugt, um mich sehen zu können, und wirkte dabei kerngesund.
Ich hatte aber nie den Eindruck, dass Paula mich für sonderlich wichtig hielt. Eher im Gegenteil. Sie hatte keine Lieblinge. Sie strahlte eine unwiderrufliche Gerechtigkeit aus, und obwohl man spürt, dass ihre Hingabe und Gefühle tief und wahrhaftig waren, zeigte sie keinerlei Bereitschaft, darüber zu reden — zumindest nicht, was die liebenden Empfindungen anging. Egal wer vor ihr stand, der lächerliche Terrapin, der freundliche Boakes oder der wundervoll göttliche und himmlische Jack Rose, Held der Schule, sie behandelte alle Jungen gleich. Mir begegnete sie von Anfang an mit ruhiger und unerschütterlicher Fürsorglichkeit, die mich einhüllte wie ein Mantel. Sie hat mich nie übermäßig behütet oder bewacht, und ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich seit meiner Babyzeit jemals geküsst oder umarmt hätte. Jeden Abend meines Lebens hat sie mich ins Bett gebracht, und als ich die Masern oder Windpocken hatte, durfte ich drüben bei ihr auf der Jungensseite liegen, und ich wusste mit absoluter Sicherheit, dass sie immer in Rufweite wäre.
Sie hat aber nie versucht, mich zu bemuttern. Paula hat kein weiches Herz. Sie kann Rührseligkeit jedweder Art nicht ausstehen und sagt immer und immer wieder — es ist ihr Diktum, ihr ungeschriebenes Gesetz: VERZICHTE AUF SELBSTMITLEID.
Trotzdem kann man ihr alles erzählen. Sie ist nie schockiert, sie ist nie überrascht. Sie akzeptiert und akzeptiert und akzeptiert. Puffy Coleman verliebt sich immer wieder in die ganz kleinen Jungen (»Na ja, er tut ihnen ja nichts«); der liebe Uncle Edmund HB-Bleistift klettert Leitern hinauf und weint aus Liebe um alles auch nur annähernd Weibliche (»Weiß der Kuckuck, er ist nun mal ein Romantiker«); einer der Jungen betrinkt sich im Lobster Inn besinnungslos, nachdem er durch die Prüfung gerasselt ist (»Er soll seinen Rausch ausschlafen, sich bedauern lassen und sie Weihnachten nachschreiben«). Und sie fand es nie in irgendeiner Form abstrus, dass ich mit zehn noch immer nicht lesen konnte. »Wenn die Augen in Ordnung sind«, sagte sie, »und dafür haben wir ja jetzt gesorgt, kommt das Lesen von ganz allein. Ich halte ganz und gar nichts von diesen psychologischen Quacksalbern und IQs und weiß der Kuckuck was.« Und das Lesen kam wirklich von allein. Am Ende kam es.
Und niemals, niemals vermittelte mir Paula den Eindruck, dass ich hässlich sei, und als ich mal was in diese Richtung fallen ließ, ging sie in die Luft wie eine Bombe. »Nicht mit mir, mein Liebchen, nicht mit mir«, erklärte sie und polterte und klapperte mit der Nähmaschine.
»Ich hab keine Freunde«, jammerte ich. (Das war kurz nach den Masern. Ich war sehr schlecht drauf.)
»Selber schuld.«
»Alle hassen mich.«
»Nun bild dir mal bloß nichts ein. Himmel hilf, das Ding ist ja völlig hinüber.«
»Kein Wunder, wenn du sie auf den Boden fallen lässt. Das war die Nähmaschine meiner Mutter«, sagte ich. Ich weiß noch, dass mir dieser Satz Genugtuung verschaffte. Ich betonte jedes Wort einzeln. »Mein Vater hat sie meiner Mutter geschenkt. Sie hat sie immer geliebt.«
»Zu dumm, dass sie sie nicht öfter benutzt hat. Ich sag ja nur, als ich hierherkam, warst du ’n nackter Wurm in ’nem lumpigen Fetzen Decke, es war nicht ein einziger Strampler für dich im Haus!«
»Sie war nicht von dieser Welt — «
»Dann ist sie da, wo sie ist, ja bestens aufgehoben.«
»Paula!«
»VERZICHTE AUF SELBSTMITLEID«, wetterte sie mit leuchtenden Augen und schön wie der Tag. »VERZICHTE AUF — «
»Ich hab keine Mutter. Ich kann nicht lesen. Ich bin häss—«
»Du kannst genauso gut lesen wie alle andern. Du bist ’n Zahlengenie. Du kannst schwierige Stücke nach Gehör spielen und beim Schach mit deinem Vater mithalten. Und außerdem — «
»Bin ich hässlich.«
»Hast du wunderschöne Haut und Hände und Haare.«
»Ach Paula, meine Haare sind schrecklich. Sie sind kraus. Sie sind fluoreszierend. Man kriegt Migräne davon. Alle lachen über mich.«
»Abwarten«, sagte Paula feierlich wie ein Orakel, stach sich mit der Nähmaschinennadel in den kleinen Finger und schrie wie am Spieß. »Ich bin verwundet, ich blute, die Nadel steckt fest!«
Nachdem sie sich selbst gerettet hatte, fügte sie hinzu: »Du bist das beste Mädchen auf der Welt. Du bist die beste Freundin auf der Welt.«
»Du meine auch, glaube ich«, sagte ich, und wir sahen uns in die Augen, ohne Quatsch. Dann sagte ich: »So gesehen bist du meine einzige Freundin, und umgekehrt. Wir haben sonst niemanden.«
»Das ist wahr«, sagte Paula, ballte ihre Hand zur Faust und setzte sich auf den schmerzenden Finger. »Ein gottverlassenes einsames Nest ist das.«
»Warum bist du dann hiergeblieben?«
Womit wir wieder am Anfang wären.
Diese Gespräche mit Paula fanden immer donnerstagabends statt, und zwar »seit Adam und Eva«, wie unsere Mrs Dingse sagten, weil Donnerstag der Tag war, an dem Vater abends Besuch empfing.
Er machte das seit Vorkriegszeiten, sogar als er noch unverheiratet war, und es kamen immer dieselben Besucher: ein oder zwei, niemals mehr als drei ältere Lehrer. Uncle Bleistift und Puffy Coleman verstanden sich von selbst, und der Dritte im Bunde war meist ein Amalgam aus Spinnweben und Staub und hörte auf den Namen Old Price. Jeden Donnerstag während der Schulzeit kamen diese Leute gegen neunzehn Uhr dreißig angekrochen wie greise, heimkehrende Schnecken. Wenn es nicht allzu kalt ist, schälen sie sich im Flur aus Bekleidung, lassen Gehstöcke — Uncle HB besitzt einen Sitzstock — in den Flurständer fallen und schlurfen missmutig ins Arbeitszimmer. Paula bringt ihnen Kaffee und Gläser und Vater schließt langsam sein unterstes Schreibtischfach auf und holt eine Flasche Wein hervor, die er lange nach Ankunft der Gäste erst öffnet und wahrscheinlich nur dank des sehr bestimmten Einschreitens Uncle HBs, der oft auch noch einen eigenen Flachmann dabeihat, was Vater bestimmt noch nie bemerkt hat.
Während die Minuten nach dem Kaffee lang werden, schiebt Uncle HB seinen Flachmann nach hierhin und dorthin und rückt ihn an sehr auffällige Stellen, weil er ein guter Mensch ist, Feigheit jeder Art hasst und an unverblümte Ehrlichkeit glaubt, was menschliche Schwächen angeht. »Ich trinke«, sagt er, »aber niemals heimlich«, und er wirft einen finsteren Blick in die Runde, als würden alle anderen in ihrem Kleiderschrank Schnaps brennen. Auch mein Vater trinkt nicht heimlich, und ich bin mir sicher, dasselbe gilt für Puffy — nur jede Menge Gingerbeer mit den Jungen —, und wenn Old Price mehr als zwei Schlucke trinken würde, ginge er in einer kleinen Rauchfahne auf. Ich frage mich oft, wie es dazu kam, dass Vater traditionell den Wein besorgt und warum von ihm erwartet wird, dass er jede Woche eine Flasche Rosy, wie Paula sagt, zur Verfügung stellt, wo er selbst den üblichen leiblichen Genüssen so wenig zugetan zu sein scheint. Von allein käme er nie weiter als zum rein mechanischen Beäugen der Flasche und dem Lüften von Schulheften, alten Teekannen und ein bis zwei Socken auf der Suche nach dem Öffner, um letztendlich dazustehen wie der Priester bei der Messe, versonnen die Flasche gegen das Licht zu halten und in das Rosa des Weins zu schauen oder in das beunruhigend sexy Gesicht der Primavera über dem Kamin. Schließlich nimmt ihm Uncle Bleistift, der weder Farbe noch Botticelli bemerkt, die Flasche ab, schnuppert daran, beschwert sich darüber und schenkt ein. Dann nimmt Paula das Tablett und geht, und die vier sitzen da bis halb elf.
Als ich klein war, durfte ich manchmal ein bisschen dabei sein — na ja, dürfen ist übertrieben. Ich hab’s einfach gemacht. Sie schienen mich nicht wahrzunehmen, und ich habe viel gelernt. Mit vier oder fünf saß ich ewig unter dem Schreibtisch und spielte mit den alten Schuhen, die mein Vater dort anhäufte. Es waren freundliche Schuhe mit Namen, und wir führten schöne lange Privatgespräche, bevor Paula herabfuhr wie eine Walküre. »Darf ich kurz stören, die Herren, sie ist hier und kommt da jetzt raus, aber dalli. Unter diesem Schreibtisch. Ja. Ich hab die ganze Schule abgesucht. Sollten sich was schämen! Das Kind muss doch noch wachsen. Fünf Jahre alt, und es ist nach acht! Nee, nee, lassen Sie mal, Mr Hastings. Passen Sie lieber auf Ihren Flachmann auf, der fällt gleich runter« — und sie packte mich mit beiden Armen, hob mich hoch und schwang mich über sämtliche Köpfe hinweg durch die Luft, und ich brüllte: »Ich bin nicht müde. Ich mach hier was. Du bist nicht NETT, Paula« usw., und ich schlenkerte mit einem Schnürschuh, der Heim und Herd niemals wiedersehen würde.
Irgendwann passte ich nicht mehr unter den Schreibtisch, und außerdem roch es dort unten, Pardon, inzwischen ein wenig würzig, also gab ich die Donnerstagsempfänge auf, um mich Paulas Lazarettlesungen zu widmen, und ich lernte dabei weitaus interessantere, universellere und philosophischere Dinge.
Inzwischen habe ich Romane voller intelligenter Gespräche gelesen. In den Romanen gibt es oft eine Standardsituation, genannt Universitäts- bzw. College-Gespräch. Diese kann zwischen Studenten stattfinden oder, ein halbes Leben später, an den Alumni-Abenden. Sie besteht aus sehr vielen Pausen, und während der Pfeifenrauch aufsteigt und das Licht des Kaminfeuers auf den alten Ledereinbänden flackert, hängen Weisheit und sanfte Nostalgie in der Luft. Das Wesen Gottes, die Realität fester Gegenstände, die Nichtexistenz von Zeit werden thematisiert, sanft von allen Seiten betrachtet. Nicht so bei Vaters Leuten. Oben bei Paula, ein Stockwerk drüber — und Paula hat gar keine Schulbildung —, reden wir ohne Ende über:
Sünde
Tod
Liebe
Harmonie
Ethik
Vor allem über Ethik, z.B. wenn Posy Robinson Sehnsucht nach seiner Mama hat und weinend ins Zimmer kommt und wir nur zwei Eier und zwei Streifen Speck und zwei Löffel Kakao haben, während wir gerade unsere vier Füße aufs Kamingitter gelegt haben und nach den Nachrichten ein tolles Radiohörspiel hören.
Aber unten! Hier eine Kostprobe des Geplauders an einem der gelehrten Donnerstage.
»Kalt heute Abend.«
»Eigentlich besser so.«
»Ganz schön kalt. Hast du schon deine Kohle?«
»Nein. Hast du schon dein Öl?«
»Nein!«
»Wird Zeit, dass wir Ölheizung kriegen. Ist gar nicht so viel teurer.«
»Stinkt aber.«
»Ganz und gar nicht. Und man muss nicht mehr schippen.«
»Du hast ja Personal.«
»Personal! Der faule Sack. Hätten wir Öl, könnten wir ihn entlassen.«
»Gunning entlassen? Gunning entlassen?«
»Wird Zeit. Der ist seit den Zeppelinen bei uns.«
Beklommenes Schweigen, während man überlegt, ob Old Price noch die Zeppeline erlebt hat.
»Ich habe mal einen Zeppelin gesehen«, sagt Puffy Coleman freundlich. »Als Junge. Über dem Meer schoss eine Stichflamme in die Luft — bei Scarborough, und dann sahen wir lauter kleine Flammen ins Wasser fallen. Kleine brennende Männer. Ein schrecklicher Krieg war das.«
»Schrecklich.«
»Was war schrecklich?«
»Dieser Krieg.«
»Welcher Krieg?«
»Na ja — der letzte Krieg. Der — Zeppelinkrieg.«
»Ich erinnere mich«, sagt ein schwaches Stimmchen aus der Ecke, wenn es ein warmer Abend ist — er kommt nur an ausgewählten Abenden, Old Price, wie die Amsel bei Masefield — »Ich erinnere mich noch an die Zeppeline. Die Jungs sind alle raus und die Klippen entlanggerannt und haben gejubelt. Im Schlafanzug.«
»Ah«, sagt Puffy Coleman und senkt die Zähne.