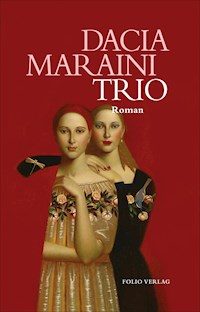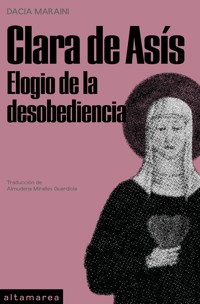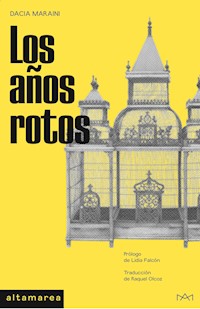Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Transfer Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Die Sonne brennt unbarmherzig, heiß sind die Tage am Meer. Auf Anna wartet die lang ersehnte Freiheit. Es ist Sommer 1943. Endlich holt der Vater die Vierzehnjährige und ihren jüngeren Bruder aus dem Nonneninternat ab, um die Ferien in einem Badeort in der Nähe von Rom zu verbringen. Anna ist hungrig nach Welt, sie will wissen, wie Liebe wirklich geht. Während das Dröhnen der Jagdbomber am Himmel die schläfrige Stille der Tage durchbricht, lernt sie in der Badeanstalt Savoia die gierigen Blicke junger wie alter Männer kennen und macht ihre ersten sexuellen Erfahrungen. Anna will das Unbekannte erfahren … Die Kunst der großen Autorin, über das zu schreiben, worüber andere schweigen. Lakonisch, verstörend, das Romandebüt der größten lebenden Schriftstellerin Italiens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
© Mauro Raffini
DACIA MARAINI, eine der wichtigsten Stimmen Italiens sowie feministische Pionierin. Geboren 1936 in Fiesole, aufgewachsen in Japan und Sizilien. Aufgrund der antifaschistischen Haltung des Vaters in einem japanischen KZ interniert, frühe Erfahrung von Hunger. Sie war eine der Ersten, die über Gewalt an Frauen schrieb, begründete experimentelle Theater und reiste mit Pier Paolo Pasolini für Filmprojekte nach Afrika, schrieb Drehbücher, u. a. für Margarethe von Trotta. Bei Folio erschienen zuletzt: Drei Frauen (2019/20), Die stumme Herzogin (2020), Trio (2021).
DIE ÜBERSETZERIN
Ingrid Ickler wohnt und arbeitet in der Nähe von Frankfurt. Sie übersetzt aus dem Italienischen, Französischen und Englischen, ist Autorin und Moderatorin.
Dacia Maraini
Tage im August
DACIA MARAINI
TAGE IM AUGUST
Roman
Aus dem Italienischen neu übersetzt von Ingrid Ickler
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Vorwort
Ein Buch wieder zu lesen, das man vor so vielen Jahren geschrieben hat, ist wie ein Jugendfoto zu betrachten. Dein Körper ist zwar präsent, aber gleichzeitig auch wieder nicht. In dieser Form existiert er nicht mehr. Bin ich wirklich dieses junge Mädchen, das die Welt aus dieser distanzierten und erstaunten Perspektive erzählt, oder bin ich es nicht? Was ist aus diesem Stil geworden, der Vorliebe, alle Details haargenau zu beschreiben, ohne sie als Teil eines großen Ganzen zu begreifen? Aus dieser jungen Autorin, die verblüfft die Widersprüche festhält, die ihr noch kindlicher Geist nicht verstehen kann?
Wo ist das junge Mädchen geblieben, das Bücher liebte und immer und überall leidenschaftlich las? In der Schule, wenn die anderen lernten, im Park, wenn die anderen spielten, in den Ballsälen, wenn sich die anderen verliebten, auf dem Boot liegend, wenn sich die anderen sonnten. Wohin ist sie verschwunden und mit ihr all die Worte und Geschichten der anderen?
Wenn ich zurückblicke, kann ich dieses Mädchen, der Schatten meines Schattens, nicht mehr erkennen. Dabei ist es immer noch da und erinnert mich durch ihr Schreiben daran, dass wir Teil einer Kontinuität sind, trotz verlorener und zerstörter Erinnerungen. Nichts von dem, was wir erlebt haben, geht verloren, auch nicht das Aufwachsen in einer schweren und prekären Zeit.
Ich habe keinen Hang zur Nostalgie. Aber die Vergangenheit zu betrachten, ja, das gefällt mir. Auch das, was vor meiner Geburt liegt, die Jugend meiner Eltern oder Großeltern, die ich mir nur ausmalen kann, meine Vorfahren, die in außergewöhnlichen Zeiten gelebt haben. Wie weit kann man in die familiäre Vergangenheit zurückblicken, ohne den Sinn für die Gegenwart zu verlieren?
In dem verträumten Blick, der uns aus den Fotos unserer Jugend entgegenschaut, liegt etwas Besonderes. Ist es die Illusion der Unendlichkeit, die uns trügt? Oder eine überdeutliche Bestätigung von der Unwirklichkeit der Formen? Formen, die verfliegen, auseinanderbrechen und über unsere anmaßenden Erwartungen lachen?
Soweit ich mich erinnere, kann ich nur sagen, „es war einmal ein junges Mädchen“, das verletzt einen brutalen und verachtenswerten Krieg überlebt hat. Ein Mädchen, das den Hunger kannte und sogar von einem Stück schimmligem Brot träumte.
Dieses Mädchen ist auf unerklärliche und wunderbare Weise dem Krieg und dem Konzentrationslager entronnen. Sie hat die Zeit des Mangels in der Nachkriegszeit erlebt, die immer wieder geflickten Schuhe, die gewendeten Mäntel, die Frostbeulen an den Händen, weil die Räume nicht geheizt waren, die Bücher, die sie heimlich, beim Licht einer Taschenlampe, unter der Bettdecke las.
Dieses Mädchen war so sehr in die Lektüre vertieft, dass sie sogar ihren Namen vergaß. Sie hatte beschlossen, so bald wie möglich selbst ein Buch zu schreiben, denn in den Büchern liegt das Salz der Erde und sie gierte nach diesem Salz. Für Zucker und Honig hatte sie nicht viel übrig.
Dieses junge Mädchen hat mit siebzehn Jahren einen nüchternen, ja rauen Roman geschrieben, den sie La vacanza (Ferien im August) nannte, was aber nicht im Sinne einer glücklichen Urlaubsreise oder Erholung gemeint war, sondern eine Leere beschrieb, eine Leerstelle, die ihren Forschergeist weckte: Wer und was lag jenseits der Tür, der Straße, des Flusses, jenseits der Stadt? Etwas Vernünftiges, für das es lohnt, sich zu opfern, oder waren da nur Leid und Verwirrung?
Die Antwort suchte sie in den Büchern. Um sich an Menschen zu wenden, war sie zu schüchtern und zu ungeschickt. Wenn sie jemandem gegenüberstand, errötete sie oder wurde bleich, sie bekam einen trockenen Mund, sodass sie keinen Ton herausbrachte.
Nur das Schreiben konnte die fehlenden Worte ersetzen, wie eine Mumie, die die Worte in sich begraben hatte. Nur das Schreiben brachte ihr ein wenig Frieden. Deshalb hatte sie damit begonnen, beunruhigende Geschichten zu erzählen: Sie wollte die Angst und die Scham überwinden, auf der Welt zu sein. Wie sie festgestellt hatte, war das eine einsame Tätigkeit, bei der sie Stille und Konzentration brauchte. Aber dann fanden diese in der strikten Einsamkeit geschriebenen Worte durch seltsame, alchemistische Wege den Weg zu fernen Augen und Ohren, was ihr eine sonderbare Form des Vertrauens und des Muts schenkte.
Die Figur der Anna war eines Morgens bei ihr aufgetaucht und hatte um Asyl und Verständnis gebeten.
Auch heute noch sind es immer die Figuren, die zu mir kommen und mich bitten, über sie zu schreiben. Anfangs sträube ich mich und schotte mich ab. Es scheint schwierig, fast unmöglich, über jemanden zu schreiben, den ich so wenig kenne, der absolute Ansprüche an unsere Vorstellungskraft stellt, jemand, der gehört, gepflegt, gesehen und analysiert werden möchte. Mein Gott, wie mühsam, sage ich mir, wie kann ich das nur schaffen.
Und dann wird die Aufgabe von Tag zu Tag aufregender: Während ich schreibe, wird mir die Figur immer vertrauter und je vertrauter sie mir wird, desto mehr möchte ich sie von Grund auf kennenlernen. So zwingen mich diese geschickten, von irgendwoher kommenden Figuren, bei ihnen zu bleiben, neugierig und sehnsüchtig. Am Ende verliebt man sich regelrecht in sie und das Schreiben wird zur schieren Notwendigkeit.
Aus einem Gefühl der kindlichen Ähnlichkeit wurde Anna geboren. Dieses Mädchen hatte an meine Tür geklopft, fast wie eine andere Version meiner selbst, aber auch wie eine andere, eine Fremde mit vielen Fragen, die ich nicht verstand.
Sie hat mir von diesem lebenslustigen und stets improvisierenden Vater erzählt, von der antriebslosen und gleichgültigen Stiefmutter, von diesem dickköpfigen und einzelgängerischen Bruder, von den alten Männern und den jungen, die vom Schoß des Mädchens angezogen wurden, wie Bienen vom süßen Nektar.
In diesen Nachmittagen, an denen es nach Algen und Jasmin duftet, findet sich viel von Palermo, genauer gesagt von Mondello, aber ich habe die Handlung an die Küste Latiums verlegt, weil ich damals in Rom lebte und nicht wollte, dass sich mein Blick in einer diffusen Ferne verlor.
Dann ist alles in den Brunnen der Erinnerung gefallen. Dort haben die Figuren uns seit Jahren Gesellschaft geleistet und dösend darauf gewartet, wieder zum Leben erweckt zu werden. Nun bietet sich ihnen die Gelegenheit der Rückkehr und ich fürchte mich fast ein wenig. Ich vertraue den Lesern eine vergessene Figur an, die schmerzhaft stumm und seltsam ohnmächtig ist, in der Hoffnung, dass ihr etwas von der Frische jener Jahre geblieben ist.
Dacia Maraini
1
Wir rannten die Treppe hinab und den langen Flur entlang, ohne auf eine der Schwestern zu treffen. Es herrschte Mittagsruhe. Die Fensterläden waren geschlossen, man konnte kaum etwas sehen.
Die alte Nonne an der Pforte öffnete uns die Tür und brummelte: „Wenn sie hier rausgehen, weiß man nie, wie sie wieder zurückkehren.“ Seit ich im Internat war, hatte ich sie immer so in ihrer Loge sitzen sehen, schwerfällig, in schwarzer Schürze und zerschlissenem rosa Schultertuch.
„Ihr wollt ans Meer?“, fragte sie und funkelte uns missgünstig an. „Passt auf, dass ihr euch nicht verkühlt“, fuhr sie fort, während sie uns hinausließ. Dann schlug sie die Tür zu.
Mumuri wartete draußen schon auf uns. Er saß rittlings auf seinem Motorrad.
„Da seid ihr ja.“ Er lächelte zufrieden. „Los, steigt auf“, sagte er und reichte uns eine Hand.
Wir kletterten auf das Motorrad, Giovanni vorne und ich hinten. Das Köfferchen befestigte er, so gut es ging, neben dem Hinterrad und ich legte ein Bein darauf ab.
„Auf geht’s!“, sagte Papa heiter, die Füße gegen den Boden gestemmt, um das Motorrad im Gleichgewicht zu halten. Wahrscheinlich stand eine der Schwestern am Fenster, aber wir blickten weiter zu Boden und taten so, als hätten wir sie vergessen. „Bereit? Sitzt ihr gut?“, fragte er, richtete seine Baskenmütze und umfasste den Lenker.
Ruckartig fuhr das Motorrad an, es beschleunigte und wir legten uns in die Kurve. Giovanni war aufgeregt und klammerte sich zitternd am Lenker fest, ich hatte meine Arme von hinten um den muskulösen Körper meines Vaters gelegt und fühlte mich mit seiner Freude und seinem Selbstvertrauen verbunden. Die Passanten und die wenigen Autos nahm ich gar nicht richtig wahr. Ich schob den Kopf vor, um mir den Wind ins Gesicht wehen zu lassen, und widerstand dem Drang, mir die Haare aus den Augen zu streichen.
Mumuri fuhr sicher, dabei plauderte er munter.
„Ich wette, ihr seid noch nie Motorrad gefahren“, stellte er lachend fest. Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er fort: „Du hast Angst, Giovannino, gib es ruhig zu. Ein Dreikäsehoch wie du hat Angst.“
Giovanni schüttelte den Kopf, ohne den Griff zu lockern, seine Hände waren schon ganz blau vor Anstrengung.
„Und wie geht’s dir, Anna?“ Mumuri drehte sich ein wenig zu mir um, ich konnte sein sonnengebräuntes Gesicht erkennen, das hier und da von langen tiefen Falten durchschnitten war, die getönte Brille saß auf seiner breiten Nase. „Du hättest gerne ein Eis, nicht wahr? Wie blass du bist, meine Kleine. Du wirst sehen, das Meer wird dir guttun. Wenn du zurückkommst, werden die Schwestern dich kaum wiedererkennen.“
Ich blickte zurück und dachte an das Internat, das hinter uns lag und auf uns warten würde. Die Schwestern mit ihren mit Haarnadeln am Kopf befestigten langen Schleiern, die klimpernden Rosenkränze. Für Mumuri war alles einfach: Jetzt nahm er uns mit in die Ferien ans Meer, hinterher würde er uns mit dem gleichen klapprigen Motorrad und dem gleichen unbekümmerten Gesichtsausdruck wieder zum fünf Meter hohen Eingangstor zurückbringen. Ich schlang die Arme fester um die breite muskulöse Taille meines Vaters, der sich besorgt umsah. „Du willst ein Eis, oder?“ Er zwinkerte mir zu. „Wir sind fast da.“
Wir hielten vor einer Eisdiele an der Ecke eines Dorfplatzes. Auf dem Bürgersteig lag eine zerdrückte Eiswaffel. Darüber schwirrte ein Schwarm Fliegen. Eine Katze schnupperte daran und trottete dann weiter. Giovanni wollte nicht absteigen und Mumuri machte sich über ihn lustig. Er zog sich die hellen Lederhandschuhe aus und ich dehnte die schmerzenden Beine.
„Der Wind brennt ganz schön“, sagte Giovanni und betastete seine geröteten Wangen.
„Die Sonne brennt“, verbesserte ihn Papa und schob den Perlenvorhang vor dem Eingang der Eisdiele beiseite.
Mumuri bestellte zwei Eis zu fünf Lire, Pistazie und Torrone. Giovanni hielt seine Waffel vorsichtig fest und leckte langsam und konzentriert, die Zunge weit herausgestreckt, die Kiefer auf und ab bewegend und die Stirn vor Anstrengung runzelnd.
Papa plauderte mit dem Padrone, einem beleibten Mann, der ihm Fotos berühmter Boxer zeigte.
„Luigi Musina“, sagte er und deutete auf ein Bild mit Widmung. „Europameister im Halbschwergewicht. Er hat keine Nase mehr, aber schauen Sie sich die Muskeln an.“ Papa nickte, dabei behielt er Giovanni im Auge, der sein Eis aß. „Und das ist Proietti, eine ganz andere Liga. Tolles Foto, was?“
„Sehr schön“, erwiderte Mumuri mit gleichgültiger Miene.
„Enrico Urbinati, Europameister im Fliegengewicht“, der Padrone klatschte in die Hände. „Die verdienen Unsummen.“
„Sie schon“, sagte Mumuri gelangweilt.
„Der Weg ist beschwerlich, aber es lohnt sich. Ich habe es auch probiert, wissen Sie. Aber ich hatte es zu eilig, war zu ungeduldig. Ein gutes Gefühl, den Kopf zu senken und zuzuschlagen, bis man so richtig erschöpft ist.“
Papa reagierte diesmal nicht. „Zufrieden?“, fragte er Giovanni, beugte sich zu ihm und strich ihm übers Haar. Der Mann hinter dem Tresen schaute ihm aufmerksam zu, er atmete schwer.
„War das Eis gut?“, fragte Papa freundlich und Giovanni nickte.
„Noch eins?“
„Ja.“
„Hast du Papa lieb?“
„Ja“, antwortete Giovanni und starrte zu Boden. Für ein Eis war er zu jeder Lüge bereit.
„Wenn dein Papa nicht wäre, wer würde dir dann ein Eis kaufen? Die Nonnen sind ziemlich knausrig, was?“
Der Padrone wischte sich die Hände an der knöchellangen Schürze ab. Dann verschwand er hinter dem Tresen und füllte keuchend, aber mit ruhigen Handbewegungen eine zweite Eiswaffel. Mumuri griff danach und reichte sie Giovanni weiter, der sie von allen Seiten anleckte, damit das Eis nicht tropfte.
Mumuri warf einen Blick auf die Uhr an der Wand und verzog das Gesicht. „Es ist schon spät, wir müssen uns beeilen“, drängte er und zog zwei Geldscheine heraus. Der Padrone hielt sie gegen das Licht, drehte sie zweimal um und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Dann legte er sie mit einem zufriedenen Lächeln in die Kasse und lehnte sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen.
Giovanni nahm sich Zeit für sein Eis. Er leckte genüsslich, die Augen fest auf die grüne und die gelbe Creme gerichtet, die er mit der Zunge umrundete und von der jedes Mal ein wenig mehr verschwand.
Mumuri wagte nicht, ihn zu stören, sondern betrachtete ihn neugierig. Vielleicht wurde ihm zum ersten Mal klar, wie fremd er ihm war. Ich beobachtete meinen Vater und suchte nach Ähnlichkeiten zwischen uns.
„Fertig, mein Junge?“, fragte er und umfasste mit seiner großen kräftigen Hand die klebrigen Finger seines Sohnes. Giovanni wollte noch ein Eis und der Barbesitzer musterte ihn versonnen. Papa verlor die Geduld. „Es ist spät, habe ich gesagt. Sie wartet auf uns.“
„Wer?“, platzte ich heraus. Mumuri wirkte angespannt, plötzlich sah sein Gesicht müde aus, aber seine listigen Augen leuchteten.
„Noch eins“, quengelte Giovanni.
Papa reagierte wütend und packte ihn am Handgelenk. Giovanni starrte ihn hasserfüllt an. Dann entdeckte Mumuri einen vorbeilaufenden Hund und versuchte uns auf ihn aufmerksam zu machen.
„Schaut mal, was für ein schöner Hund.“
Giovanni drehte den Kopf weg und beharrte auf seinem Eis. Mumuri packte ihn am Arm und zog ihn nach draußen.
Ich folgte ihnen.
Wir stiegen wieder auf das völlig verstaubte Motorrad, der Motor war noch warm. Giovanni hatte Tränen in den Augen und biss die Zähne zusammen. Mumuri wirkte nervös und abwesend. Wir fuhren lange Zeit, ohne dass jemand ein Wort sprach. Dann hörte ich Mumuris Stimme.
„Was hast du gesagt?“, rief ich zurück.
„Eure zweite Mama wartet zu Hause auf euch.“
Ich reagierte nicht und umklammerte ihn noch fester. Mama war nicht mehr da und das wusste er auch. Warum sprach er von einer zweiten Mama? Ich dachte daran, wie wir an jedem ersten Sonntag im Monat in Reih und Glied mit den Schwestern auf den Friedhof gingen. Die verwelkten Blumensträuße rochen feucht. Ich mochte diesen Ort, wo ständig ein angenehm frischer Wind wehte. Giovanni schlief auf der Bank ein, kurz bevor wir die Tüten mit unserem Proviant herausholten. Brot und ein Ei. Man musste aufpassen, dass einem der Wind nicht alles aus den Händen wehte. Giovanni versteckte sich hinter meinem Rücken und kicherte. Die Schwestern stimmten mit lauter Stimme ein Gebet an und wir mussten die Antwort singen.
„Warum sagst du nichts, Anna?“
„Wie heißt diese Mama?“
„Mama, das reicht.“ Papas Stimme klang wütend und gezwungen. „Hast du deinen Papa lieb, Giovannino?“
Giovanni reagierte nicht. Papa beschleunigte. Ein Militärlaster überholte uns und machte einen Höllenlärm, der Luftstrom war so stark, dass wir fast das Gleichgewicht verloren hätten.
„Ihr müsst nett zu ihr sein, verstanden?“
Wir antworteten nicht und er schüttelte den Kopf.
„Ihr seid undankbar. Hat dir das Eis geschmeckt, ja oder nein?“, fragte er Giovanni und küsste ihn auf den Kopf. Ich hörte seine Stimme nur undeutlich, bruchstückhaft, der Wind trug seine Worte mit sich fort.
Eines Morgens waren wir festlich gekleidet und frisiert worden. Die Schwestern tuschelten untereinander und musterten uns gerührt. Eine hatte versucht, mir mit einem Stift und ein wenig angefeuchtetem Papier Locken zu drehen. Obwohl mir die Augen vor Müdigkeit brannten, spürte ich, dass etwas Wichtiges geschehen würde. Ohne die übliche Tasse Milch mussten wir ins Besuchszimmer gehen.
„Dein Vater“, sagte die Mutter Oberin und schob sich den Schleier aus dem Gesicht. Ich knickste. Er lachte, warf den Kopf in den Nacken und nahm mich in den Arm. Dabei flüsterte er mir etwas zu, das ich nicht verstand, sein Mund kam mir so nah, dass ich seinen warmen Atem auf meinen Wangen spüren konnte. Er roch nach Rauch. Danach wollte er auch Giovanni an die Brust drücken. Die Nonne entfernte sich schwankend und wir sahen ihn ängstlich an. „Wie viele Perlen an diesem Rosenkranz“, sagte Papa und zog ein von der Sonne ausgebleichtes Foto unserer Mutter aus der Tasche. Die Beine waren ab dem Knie abgeschnitten. Ihr Gesicht war lang gezogen und hatte etwas von einem Pferd, sie lächelte freundlich. Giovanni streckte sich, um besser sehen zu können. Mumuri schlug die Beine übereinander und sagte: „Das bin ich.“ Dabei legte er mir seine warme Hand in den Nacken. Zum allerersten Mal dachte ich: Das ist mein Vater. Auf dem Foto winkte er in die Kamera, er wirkte mager und hatte ein strahlendes Lächeln. Am unteren Bildrand stand in Großbuchstaben ALDO MUMURI.
„Siehst du das Haus dort, mit dem weißen Dach und dem hohen Baum?“, fragte Mumuri unvermittelt. „Seht ihr das? Das ist unser Haus. Zeit fürs Mittagessen. Mama wartet schon auf euch.“
Das Motorrad rumpelte über einen Weg voller Schlaglöcher und blieb dann qualmend vor einer grauen Steintreppe stehen. Eine Frau in einem gelben Kleid kam auf uns zu, sie strich sich mit den Fingern einer Hand die Haare aus dem Gesicht und lächelte verlegen.
„Nina, das ist Giovanni und das ist Anna. Sieh nur! Kaum dreht man sich mal kurz um und schon sind sie groß wie ein Baum. Ist dir aufgefallen, wie ähnlich sie mir sind? Giovanni ist ganz der Vater. Das habe ich gleich gesehen. Wir haben unterwegs Pause gemacht und ein Eis gegessen. Stell dir vor, mein Sohn hatte zuvor noch nie eins probiert.“
Er plapperte drauflos, weil er nicht wusste, was er sagen sollte. Nina überkreuzte die Hände hinter dem Rücken, wir blieben stocksteif stehen und betrachteten ihr Lächeln.
„Giovanni, das ist deine Mama. Gib ihr einen Kuss. Was ziehst du denn für einen Flunsch. Geh schon zu ihr und umarme sie. Sie ist eine gute Frau, das kannst du mir glauben. Schau dir nur ihr Gesicht an. Du wirst doch keine Angst haben, oder? Komm schon, Annuccia, sei deinem Bruder ein gutes Beispiel.“
Giovanni ging auf Nina zu und umarmte sie teilnahmslos.
„Bravo, Giovanni, ganz der Sohn seines Vaters. Der weiß, was sich gehört. Er ist ernsthaft und versteht sofort. Und jetzt du, Anna, mach schon.“
Nina hatte sich auf den Kies gekniet und hielt mir eine glänzende ungepuderte Wange hin. Ich küsste sie widerwillig, sie roch nach Schweiß und Parfüm. Papa nahm uns bei der Hand und ging mit uns die Treppe hoch.
„Das gefällt dir, was? Schau nur, schau, was es hier alles gibt“, sagte er und zog uns von einem Zimmer ins andere.
„Das ist euer Zimmer“, verkündete er stolz und öffnete die Milchglastür.
Der Raum war lang und schmal. Die ganze hintere Wand bestand aus einem großen Fenster. Auf dem Nachttisch stand ein Strauß mit Kunstblumen und über dem Bett hing ein Ölfarbendruck der Madonna. Giovanni öffnete den Schrank und versteckte sich darin. Papa beobachtete ihn besorgt und stolz zugleich, dann zeigte er mir mein Bett. Es hatte ein Kopfteil aus glänzendem Mahagoni und eine violette Satinbettdecke.
„Gefällt es dir?“ Ich nickte, aber das reichte ihm nicht. Er wollte, dass wir uns begeistert und vor allem dankbar zeigten.
„Überrascht?“, fragte er weiter und legte den Kopf schief, dabei lächelte er so freundlich, wie er nur konnte. Nina stand auf der Schwelle, ihre Augen fest auf ihn geheftet, die Lippen leicht geöffnet.
„Nina, schau nur, so große schöne Kinder. Komm doch näher, setz dich zu uns.“
Nina kam mit wiegenden Hüften ins Zimmer und setzte sich aufs Bett. Auf ihren Lippen lag ein scheues Lächeln, in ihren Augen lag Neugier. Mumuri legte ihr eine Hand auf den Oberschenkel und erzählte mit Leidenschaft von ihrem Haus, seinem Geschäftspartner, der im oberen Stockwerk wohnte, vom Meer und vom Geschäft. Dabei wechselte er von einem Thema zum anderen.
„Jetzt habe ich Hunger“, verkündete er und sprang auf. Wehe, das Essen stünde noch nicht auf dem Tisch.
„Ist das Essen fertig? Ich habe Hunger wie ein Bär, Nina.“
Nina nickte und antwortete, das sei es schon eine ganze Weile. „Kommt“, sagte sie und ihre Stimme klang sanft und ein wenig schleppend. Alle Wörter schienen miteinander verbunden zu sein und reihten sich ohne Betonung aneinander, es klang wie ein schläfriger Singsang. Mumuri starrte sie mit gierigen Augen an.
Wir setzten uns an einen Tisch mit geschwungenen Beinen, die leicht schief standen. Der Boden bestand aus Marmorbruchstein, von der Decke hing eine Lampe aus blauem Glas.
Giovanni wollte sich die Hände nicht waschen. Er umklammerte sein Glas und trank große Schlucke Wasser. In seinen Augen standen Tränen. Papa musterte ihn verärgert.
„Schau nur, Giovanni trinkt wie ein Fisch“, sagte er und lachte, dabei suchte er Ninas Blick. Aber Nina reagierte nicht, vielleicht ärgerte sie sich über uns oder dachte an etwas anderes.
„Nina, hör gefälligst zu, wenn ich etwas sage, Herrgott noch mal!“ Er knöpfte den Hemdkragen auf und kreiste den Kopf. Nina schaute ihn mit ihren haselnussbraunen Augen an und lächelte.
„Was gibt es als zweiten Gang? Diese Seeluft macht mich nervös, die Stille und der Fischgeruch gehen mir auf die Nerven.“ Er kratzte sich mit der einen Hand im Nacken, mit der anderen zerkrümelte er das Brot neben seinem Teller.
Giovanni brach in Tränen aus. Ich spürte ein Gefühl der Leere in der Brust. Nina beobachtete uns teilnahmslos. Sie schien sich zu fragen, was wir in einem Haus zu suchen hatten, das nicht das unsere war. Mumuri wusste nicht recht, ob er Giovanni ohrfeigen und ins Bett schicken oder auf den Schoß nehmen und trösten sollte. Deshalb schaute er ihn nur an, kaute sein Fleisch und wartete darauf, dass er aufhörte zu weinen.
Irgendwann war Giovanni erschöpft, er legte die Arme auf den Tisch und schlief ein, die Haare fielen auf den Teller voller Soße.
„Der arme Junge, er ist todmüde. Außerdem hat er viel Eis gegessen.“ Mumuri wischte sich den Mund sauber, zerknüllte die Serviette und stand auf, um seinen Sohn ins Bett zu bringen. „Nina, hilf mir.“
Widerwillig folgte sie ihm.
Ich sah ihnen nach. Das Fenster stand offen und ließ die milde Meeresbrise ins Zimmer. Ich spürte, wie meine nackten Beine am Holz des Stuhls festklebten. Als ich aufsah, entdeckte ich eine Katze auf dem Fensterbrett, die mich aufmerksam beäugte. Sie hatte die Pfoten unter das Kinn gelegt, ihre durchsichtigen Augen wirkten fragend. Beim Anblick ihres vom Abendlicht nur schwach beleuchteten weißen Fells beruhigte ich mich allmählich. Die Schnauze wurde durch einen schwarzen Fleck, der vom rechten Auge bis zum linken Ohr reichte, in zwei Hälften geteilt.
„Das ist das Haus meines Vaters“, sagte ich mir, dabei hatte ich das Gefühl, die Katze könnte meine Gedanken lesen. Nina und die Katze waren sich ähnlich, daran gab es keinen Zweifel. Ich betrachtete die weiche Kurve ihres Rückens und die gleichermaßen gelangweilt wie hellwach wirkenden leuchtenden Augen. Sie musterte mich, als wüsste sie schon alles über mich, einerseits gespannt auf meine Reaktion und andererseits ungerührt, bemüht, mich zu verstehen, und bereits jetzt davon gelangweilt.
2
„Ich verbrenne Nina“, rief Giovanni und hielt die Flamme an einen Haufen trockener Blätter, die er in einer kleinen Feuerstelle aus Steinen aufgeschichtet hatte. „Ich verbrenne Signor Pompeo“, fuhr er fort und pustete gegen das Laub.
„Sei still, ich lese“, sagte ich, aber Giovanni tat so, als hätte er mich nicht gehört. Er hob das rußverschmierte Gesicht.
„Das Feuer ist ausgegangen“, jammerte er, „hilf mir, es wieder anzuzünden, Anna.“
Ich legte die Zeitung beiseite und half ihm.
„Wann kommt Papa wieder?“, fragte er und stocherte mit einem trockenen Zweig in dem Blätterhaufen herum.
„Am Samstag.“
„Wann geht Nina weg?“
„Nie.“
„Wann hört der Krieg auf?“
„Keine Ahnung. Frag Papa.“
Wie aus dem Nichts tauchten Flugzeuge auf, der Lärm war ohrenbetäubend und wir verstummten.
„Komm, wir laufen zum Strand, das sind feindliche Bomber.“ Giovanni trat das Feuer aus und rannte los. Ich folgte ihm.
Am Strand trafen wir auf Signor Pompeo Pompei, der ein Handtuch schwenkte, mit seinem Sohn Armando und seiner Frau im Schlepptau. Er war Papas Geschäftspartner, der über uns wohnte.
„Was macht ihr denn da, Kinder?“, keuchte er. „Das sind Kampfflugzeuge, sie bombardieren uns.“
„Das will ich sehen“, rief Giovanni und versuchte sich aus dem Griff von Signora Mary zu befreien.
„Sie bombardieren uns, sie sind böse. Sie werfen Bomben ab, auch auf Rom. Und auf Santa Martina. Sogar aufs Meer.“
Signora Mary zitterte in ihrem nassen Wollbadeanzug. Armando rauchte seine Zigarette zu Ende, sein Gesichtsausdruck war finster und entschlossen.
Die Pompeis zwangen uns, mit ihnen nach Hause zu gehen. Armando zündete sich eine weitere Zigarette an. Pompeo ging nach oben, um Schuhe zu holen, Signora Mary kauerte sich auf einem Stuhl zusammen. Die Flugzeuge entfernten sich, ohne eine Bombe abgeworfen zu haben, der Lärm der Motoren durchschnitt die Luft.
„Sie fliegen nach Rom. Vertrauen wir auf Gott“, jammerte sie fröstelnd.
Signor Pompei seufzte erleichtert. Er griff nach einer Zeitung und faltete sie zusammen, um sich Luft zuzufächeln. Nina kam aus der Küche. Sie wunderte sich über unsere Anwesenheit und fragte, was passiert sei.
„Meine liebe Nina, wir haben uns so erschreckt!“ Signora Mary zeigte auf ihre mit Gänsehaut überzogenen und mit roten Flecken übersäten blassen Beine.
Armando warf den Zigarettenstummel aus dem Fenster und zündete sich unmittelbar danach die dritte Zigarette an. Giovanni verschwand und versteckte sich im Schrank.
„Ich gehe zurück an den Strand“, sagte Armando.