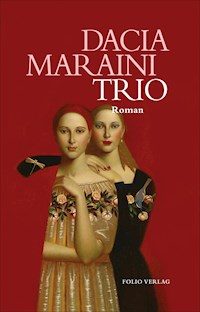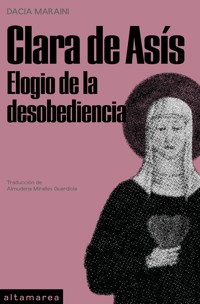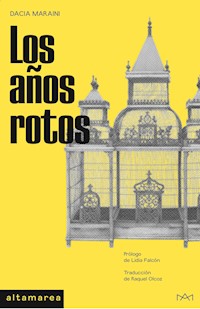Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Transfer Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Blühende Orangenbäume, der Duft von Jasmin – die Geschichte einer Emanzipation und das farbenprächtige Gemälde Siziliens im 18. Jh. Dacia Maraini beschwört in ihrem preisgekrönten Klassiker und großen Familienroman eine untergegangene Welt herauf. Die taubstumme Herzogin Marianna Ucrìa wird mit 13 Jahren an ihren über 30 Jahre älteren Onkel verheiratet. Ihr Vater bringt ihr Lesen und Schreiben bei, so kann sie mit ihrer Umgebung kommunizieren. Die Literatur wird für sie Rückzugsmöglichkeit aus der emotionalen Leere ihrer Ehe und Mittel zur intellektuellen Emanzipation. Dank der Bücher und ihrer geschärften Sensibilität nimmt sie die Umwelt aufmerksamer wahr und kann die Freuden und Ängste ihrer Mitmenschen fast körperlich spüren. Erst als Witwe erfährt sie den schockierenden Grund ihrer Taubstummheit und erlebt die wahre Liebe über Standesgrenzen hinweg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DACIA MARAINI
DIE STUMME HERZOGIN
Roman
Mit einem Nachwort von Maike Albath
Aus dem Italienischen von Sabina Kienlechner
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Nachwort
1
Ein Vater und eine Tochter, da sind sie: er blond, schön, strahlend, sie plump, sommersprossig, ängstlich. Er in nachlässiger Eleganz, mit heruntergerutschten Strümpfen, schief aufgesetzter Perücke, sie in ein dunkelrotes Korsett gezwängt, das ihre wächserne Hautfarbe hervorhebt.
Die Augen des kleinen Mädchens folgen im Spiegel den Bewegungen des Vaters, der gebeugt steht und sich die weißen Strümpfe über die Waden zieht. Sein Mund bewegt sich, aber der Klang seiner Stimme dringt nicht bis zu ihr vor, er verliert sich, bevor er das Ohr des Kindes erreicht, fast als sei die geringe Entfernung, die sie voneinander trennt, nichts als eine Täuschung des Auges. Sie scheinen einander nah, doch sie sind tausend Meilen voneinander entfernt.
Das Mädchen beobachtet die Lippen des Vaters, die sich nun rascher bewegen. Sie weiß, was er zu ihr sagt, auch wenn sie ihn nicht hört: dass sie sich schnell von der Frau Mutter verabschieden solle, dass sie sich beeilen solle, mit ihm in den Hof hinunterzugehen und in die Kutsche zu steigen, denn sie seien spät dran, wie üblich.
Unterdessen ist Raffaele Cuffa, der immer, wenn er ins „Häuschen“ kommt, vorsichtig und leicht schreitet wie ein Fuchs, vor Herzog Signoretto getreten und stellt einen großen geflochtenen Weidenkorb vor ihn hin, aus dem ein weißes Kreuz herausragt.
Der Herzog öffnet den Korbdeckel mit einer leichten Drehung des Handgelenks, in der die Tochter eine seiner typischen Bewegungen wiedererkennt: Es ist die verärgerte Geste, mit der er Dinge beiseiteschiebt, die ihn langweilen. Seine Hand fährt träge und sinnlich zwischen die gut gebügelten Stoffe, erschauert bei der Berührung mit dem eiskalten Silberkreuz, schließt sich um das mit Münzen gefüllte Säckchen und zieht sich rasch wieder zurück. Auf einen Wink hin beeilt sich Raffaele Cuffa, den Korb wieder zu bedecken. Nun bleibt nichts mehr zu tun, als die Pferde nach Palermo zu lenken.
Marianna läuft inzwischen ins Schlafzimmer der Eltern, wo sie ihre Mutter im Bett vorfindet, hingegossen zwischen die Leintücher, in einem mit Spitzen überladenen Nachthemd, das ihr an einer Schulter herabgerutscht ist, die Finger der einen Hand fest um eine emaillierte Tabakdose geschlossen.
Das Mädchen bleibt einen Augenblick stehen, überwältigt vom Duft des mit Honig versetzten Schnitttabaks, der sich mit den anderen Ausdünstungen vermischt, die das Erwachen der Mutter begleiten: Rosenöl, geronnener Schweiß, getrockneter Urin, mit Lilienessenz parfümierte Pastillen.
Die Mutter drückt die Tochter mit einer bedächtigen, zärtlichen Geste an sich. Marianna sieht die Bewegungen der Lippen, doch mag sie sich jetzt nicht anstrengen, um den Sinn der Worte zu erraten. Sie weiß, dass sie ihr sagt, sie solle nicht allein über die Straße gehen, denn taub, wie sie ist, könnte sie leicht von einem Wagen zermalmt werden, den sie nicht kommen gehört hat. Und dann die Hunde, die kleinen wie die großen, sie solle sich nur ja von den Hunden fernhalten. Ihre Schwänze, das wisse sie sehr gut, würden lang und länger, bis sie sie jemandem um die Taille schlingen können, wie es die Schimären tun, und dann, zack!, spießen sie dich mit dem spitzigen Zweizack auf, und du bist tot, noch bevor du es merkst …
Einen Augenblick lang starrt das Mädchen auf das dickliche Kinn der Frau Mutter, auf den wunderschönen, fein linierten Mund, auf die glatten, rosigen Wangen, auf die unschuldigen, ergebenen, abwesenden Augen: Niemals werde ich so werden wie sie, sagt sie sich, niemals, nicht einmal, wenn ich dafür sterben würde.
Die Frau Mutter spricht noch immer von den Hundeschimären, die lang werden wie Schlangen, die einen mit ihren Schnurrbarthaaren kitzeln, die einen mit ihren boshaften Augen verzaubern, aber das Kind läuft weg, nachdem es ihr noch einen flüchtigen Kuss gegeben hat.
Der Herr Vater sitzt schon in der Karosse. Aber er schimpft nicht, er singt. Das erkennt das Mädchen daran, wie er die Wangen bläht und die Augenbrauen hebt. Kaum hat sie den Fuß auf das Trittbrett gesetzt, fühlt sie sich von innen gepackt und in den Sitz gedrückt. Die Wagentüre wird mit einem trockenen Schlag von innen geschlossen. Und die Pferde rasen im Galopp davon, von Peppino Cannarota mit der Peitsche angefeuert.
Das Mädchen lässt sich in den gepolsterten Sitz zurückfallen und schließt die Augen. Zuweilen sind die beiden Sinne, auf die sie am meisten vertraut, so angespannt, dass sie aneinandergeraten. Die Augen haben den Ehrgeiz, die Formen voll und ganz zu erfassen, und der Geruchssinn bemüht sich seinerseits, die ganze Welt durch die beiden winzigen Öffnungen einziehen zu lassen, die sich an der Spitze der Nase befinden.
Nun hat sie die Lider gesenkt, um den Pupillen einen Augenblick Ruhe zu gönnen, und die Nasenlöcher haben begonnen, die Luft einzusaugen und peinlich genau die Gerüche zu erforschen und zu klassifizieren: Wie aufdringlich doch der Geruch des Lattichwassers ist, mit dem die Weste des Herrn Vaters imprägniert ist! Darunter erahnt man den angenehmen Duft des Reispuders, der sich mit dem schmierigen Geruch der Polsterung, dem sauren Dunst der zerdrückten Wanzen vermischt sowie mit dem Kitzeln des Straßenstaubs, der durch die Türritzen dringt, zusammen mit einem Hauch von Minzkraut, der von den Wiesen der Casa Palagonia heraufsteigt.
Aber ein besonders heftiger Schlag zwingt sie, die Augen wieder zu öffnen. Sie sieht, dass der Vater auf dem gegenüberliegenden Sitz eingeschlafen ist, der Dreispitz ist ihm auf die Schulter gerutscht, die Perücke hängt schief über der schönen, verschwitzten Stirn, die blonden Wimpern ruhen anmutig auf den frisch rasierten Wangen.
Marianna zieht die mostfarbenen Vorhänge über dem Relief aus vergoldeten Adlern beiseite. Sie sieht ein Stück der staubigen Straße und ein paar Gänse, die mit ausgebreiteten Flügeln vor den Wagenrädern fliehen. In die Stille ihres Kopfes drängen sich die Bilder der Landschaft um Bagheria: die knorrige Korkrinde über den nackten rötlichen Stämmen, die Olivenbäume mit ihren von winzigen grünen Eiern behangenen Ästen, die Brombeersträuche, die die Straße zu überwuchern drohen, die Äcker, die Kaktusfeigen, die Büschel des Schilfs und im Hintergrund die windumbrausten Hügel der Aspra.
Die Karosse passiert nun das Tor der Villa Butera und schlägt die Richtung nach Ogliastro und Villabate ein. Die kleine Hand umklammert weiterhin den Vorhang, trotz der Hitze, die der grobe Wollstoff ausströmt. Marianna sitzt auch deshalb so still und steif da, weil sie den Herrn Vater nicht durch irgendwelche unbeabsichtigten Geräusche wecken will. Aber wie dumm von ihr! Denn was ist mit dem Lärm von der Karosse, die über die Straßenlöcher holpert, und mit den Schreien von Peppino Cannarota, der die Pferde anspornt? Und mit dem Schnalzen der Peitsche? Und dem Gebell der Hunde? Wenn es für sie auch nur imaginäre Geräusche sind, für ihn sind sie wirklich. Und doch fühlt sie sich davon gestört und er nicht. Welche Scherze der Verstand den verkümmerten Sinnen doch spielt!
An den steifen Rohrhölzern, die der von Afrika herüberwehende Wind aufwirbelt, erkennt Marianna, dass sie sich nun in der Nähe von Ficarazzi befinden. Dort vorne links steht schon das große gelbe Gebäude, das „die Zuckerfabrik“ genannt wird. Durch die Türritzen dringt ein schwerer, säuerlicher Geruch. Es ist der Geruch des zerkleinerten, aufgeweichten, zerfaserten und in Melasse verwandelten Rohrs.
Die Pferde scheinen heute zu fliegen. Der Herr Vater schläft noch immer, trotz der heftigen Stöße. Es gefällt ihr, wie er dort liegt, ihrem Schutz ausgeliefert. Hin und wieder beugt sie sich vor und rückt ihm den Dreispitz zurecht oder verscheucht eine allzu lästige Fliege von seinem Gesicht.
Das Schweigen ruht wie ein totes Gewässer im behinderten Körper des Kindes, das vor Kurzem das siebte Lebensjahr vollendet hat. In jenem stillen und klaren Wasser schwimmen die Karosse, die Terrassen mit der zum Trocknen ausgebreiteten Wäsche, die davoneilenden Hühner, das in der Ferne sichtbare Meer, der schlafende Vater. Alles wiegt leicht und bewegt sich rasch von der Stelle, doch sind die Dinge allesamt miteinander verbunden durch jene Flüssigkeit, die die Farben zerfließen lässt und die Formen auflöst.
Als Marianna wieder zum Fenster hinausschaut, sieht sie mit einem Mal das Meer vor sich. Das Wasser ist klar und schlägt leicht gegen die großen grauen Steine. Ein Schiff mit schlaffen Segeln bewegt sich von der einen Seite des Horizonts zur anderen.
Ein Maulbeerzweig schlägt gegen das Fenster. Dunkelrote Beeren klatschen kräftig gegen das Glas. Marianna zuckt zurück, doch nicht schnell genug: Durch den Stoß hat sie sich den Kopf am Fensterrahmen angeschlagen. Die Frau Mutter hat schon recht: Ihre Ohren können sie nicht beschützen, und die Hunde könnten sie jeden Moment packen und ihr ans Leben gehen. Deshalb ist ihr Geruchssinn so fein ausgebildet, und deshalb sind ihre Augen so flink darin, sie vor allem zu warnen, was sich um sie herum bewegt.
Der Herr Vater hat die Augen einen Augenblick geöffnet, dann ist er in den Schlaf zurückgesunken. Und wenn sie ihm einen Kuss gäbe? Die frischen Wangen mit den Spuren einer ungeduldigen Rasur erwecken in ihr das Verlangen, ihn zu umarmen. Doch sie hält sich zurück, denn sie weiß, dass er die Schmusereien nicht liebt. Und dann, warum ihn aufwecken, wenn er so schön schläft, warum ihn in einen weiteren Tag voller „Langweilereien“ hineinzwingen, wie er es immer nennt, er hat es ihr sogar mit seiner schönen runden und gedrechselten Handschrift auf einen kleinen Zettel geschrieben.
An den regelmäßigen Erschütterungen der Karosse merkt das Mädchen, dass sie in Palermo angekommen sind. Die Räder rollen nun über die breiten Pflastersteine, und Marianna meint, das rhythmische Poltern hören zu können.
Bald werden sie in Richtung der Porta Felice abbiegen, dann werden sie den Cassaro Morto einschlagen, und dann? Der Herr Vater hat ihr nicht gesagt, wohin er sie bringen wird, doch an dem Korb, den ihm Raffaele Cuffa gebracht hat, kann sie es erraten. Zur Vicaria?
2
Es ist tatsächlich die Fassade der Vicaria, auf die der Blick des kleinen Mädchens fällt, als es, vom Arm des Vaters gestützt, aus der Karosse steigt. Seine Mimik, als er überstürzt erwachte, hat sie zum Lachen gebracht: die über beide Ohren gerutschte Perücke, das Grapschen nach dem Dreispitz und sein Sprung vom Trittbrett, der lässig hätte sein sollen, aber recht ungeschickt ausgefallen ist; es hat wenig gefehlt, und er wäre lang hingestürzt, so sehr sind ihm die Beine eingeschlafen.
Die Fenster der Vicaria sehen alle gleich aus, mit geschwungenen Gittern versehen, die in bedrohlichen Spitzen enden. Die große Haustür ist mit rostigen Nieten besetzt, daneben ein Türgriff in Form eines Wolfskopfes mit geöffnetem Maul. Es sieht eben aus wie das Gefängnis mit all seinen Hässlichkeiten, sodass die Leute, wenn sie vorbeigehen, die Köpfe abwenden, um es nicht sehen zu müssen.
Der Herzog hebt die Hand, um zu klopfen, doch die Tür wird ihm aufgerissen, und er tritt ein, als sei er bei sich zu Hause. Marianna geht hinter ihm her, zwischen den Bücklingen der Wächter und Diener hindurch. Der eine lächelt sie überrascht an, der andere macht ein finsteres Gesicht, ein Dritter versucht, sie am Arm zu packen. Sie aber befreit sich von ihm und rennt dem Vater nach.
Ein langer, enger Korridor: Die Kleine hat Mühe, mit dem Vater mitzuhalten, der mit großen Schritten auf die Galerie zuschreitet. Sie hüpft auf ihren Samtschuhen hinter ihm her, aber es gelingt ihr nicht, ihn zu erreichen. Einmal glaubt sie schon, ihn verloren zu haben, aber da steht er hinter einer Ecke und wartet auf sie.
Vater und Tochter befinden sich gemeinsam in einem dreieckigen Zimmer, das von einem einzigen Fenster hoch oben unter der gewölbten Decke nur schlecht beleuchtet wird. Hier ist ein Diener dem Herrn Vater dabei behilflich, den Überrock und den Dreispitz abzulegen. Er nimmt die Perücke entgegen und hängt sie an den Knauf, der aus der Wand ragt. Er hilft ihm, die lange Kutte aus weißem Tuch anzulegen, die in dem Korb neben dem Rosenkranz, dem Kreuz und dem Münzsäckchen gelegen hat.
Nun ist das Oberhaupt der Kapelle der Edlen Familie der Weißen Brüder fertig. In der Zwischenzeit sind, ohne dass das Mädchen dies bemerkt hätte, noch mehr Edelmänner eingetroffen, auch sie in weißen Kutten. Vier Gespenster mit schlaffen Kapuzen um den Hals.
Marianna blickt hinauf zu den Dienern, die sich mit geschickten Händen an den Weißen Brüdern zu schaffen machen, als seien diese Schauspieler, die sich auf ihren Auftritt vorbereiten: dass die Falten der Kutten schön gerade sitzen, dass sie makellos und schlicht auf die in Sandalen steckenden Füße herabfallen, dass die Kapuzen sich schön um den Hals bauschen und ihre Spitzen nach oben recken.
Nun sehen die fünf Männer alle gleich aus, sie unterscheiden sich nicht mehr voneinander: weiß in weiß und fromm in fromm; nur die Hände, die hin und wieder zwischen den Falten hervorlugen, und das wenige Schwarz, das hinter den Sehschlitzen der Kapuzen aufblitzt, lassen erahnen, wer sich dahinter verbirgt.
Das kleinste der Gespenster beugt sich über das Kind und fuchtelt in Richtung des Herrn Vaters aufgeregt mit den Händen. Es ist entrüstet, das merkt man daran, wie es mit dem Fuß auf den Boden stampft. Ein weiterer Weißer Bruder mischt sich ein und tritt einen Schritt vor. Es sieht aus, als wollten sich die beiden gegenseitig an der Gurgel packen. Aber der Herr Vater bringt sie mit einer strengen Geste zum Schweigen.
Marianna fühlt den kalten und weichen Stoff der väterlichen Kutte, die auf ihr nacktes Handgelenk fällt. Die rechte Hand des Vaters schließt sich um die Finger der Tochter. Ihre Nase sagt ihr, dass gleich etwas Schreckliches passieren wird, doch was? Der Herr Vater führt sie durch einen weiteren Korridor, und sie läuft, ohne zu schauen, wohin sie die Füße setzt, von einer eisigen und aufgeregten Neugier erfasst.
Am Ende des Korridors gelangen sie an eine steile Treppe mit schlüpfrigen Stufen. Die Edelmänner packen die Kutten mit den Händen, wie es die Frauen mit ihren weiten Röcken tun, und heben die Säume hoch, um nicht zu stolpern. Die steinernen Stufen sind feucht und schlecht zu erkennen, wiewohl ein Wächter ihnen mit einer hocherhobenen Fackel vorangeht.
Es gibt keine Fenster, weder hohe noch niedrige. Ganz plötzlich ist eine Nacht hereingebrochen, die nach verbranntem Öl, nach Mäuseexkrementen und Schweinefett riecht. Der Oberste Scharfrichter reicht die Schlüssel des Kellers dem Herzog Ucrìa, der zu einer kleinen Holztür aus gefügten Brettern geht. Dort schließt er, unterstützt von einem barfüßigen Jungen, ein Kettenschloss auf und schiebt einen großen eisernen Riegel zurück.
Die Tür geht auf. Die rauchige Fackel beleuchtet ein Stück Fußboden, über den ein paar Küchenschaben wie rasend davonflitzen. Der Wächter hebt die Fackel, und ein paar Lichtzungen fallen auf zwei halb nackte Körper, die vor der Wand liegen, die Fußknöchel an schwere Ketten gefesselt.
Der Eisenschlosser, der von wer weiß woher gekommen ist, beugt sich hinunter, um die Eisen des einen der beiden Häftlinge aufzuschließen. Es ist ein triefäugiger Jüngling, er wird ungeduldig, weil ihm das Öffnen zu langsam vorangeht, und er hebt einen Fuß, bis er mit dem großen Zeh beinahe gegen die Nase des Schlossers stößt. Dann lacht er und zeigt dabei seinen großen, zahnlosen Mund.
Das kleine Mädchen versteckt sich hinter dem Vater, der sich hin und wieder zu ihr herabbeugt und sie streichelt, aber mit grober Hand, eher um sich zu vergewissern, ob sie auch wirklich zuschaut, als um sie zu beruhigen.
Als der Jüngling endlich befreit ist und sich erhebt, sieht Marianna, dass er noch fast ein Kind ist, er wird ungefähr so alt sein wie der Sohn von Cannarota, der vor ein paar Monaten im Alter von dreizehn Jahren am Malariafieber gestorben ist.
Die anderen Gefangenen schauen stumm zu. Kaum aber beginnt der Junge, auf seinen befreiten Füßen auf und ab zu laufen, nehmen sie das unterbrochene Spiel wieder auf, froh, einmal so viel Licht zu haben.
Das Spiel besteht im Wanzentöten: Wer am schnellsten die größte Anzahl Wanzen zwischen den Daumennägeln zerdrückt, hat gewonnen. Die toten Wanzen werden sorgfältig auf eine Kupfermünze gelegt. Der Gewinner nimmt die Münze an sich.
Das Mädchen ist ganz darin vertieft, den drei Spielern zuzusehen, ihren Mündern, die sich lachend öffnen und Worte herausschreien, die sie nicht hört. Die Angst ist ihr vergangen, sie ist nun ruhig und überzeugt davon, dass der Herr Vater sie mit sich in die Hölle nehmen will: Er hat dafür gewiss einen geheimen Grund, ein „Warum-Darum“, das sie später einmal begreifen wird.
Er wird sie führen und ihr die Verdammten zeigen, die im Schlamm ersticken, die mit den Felsbrocken auf den Schultern wandern müssen, die sich in Bäume verwandeln, die aus dem Mund rauchen, weil sie glühende Kohlen verschluckt haben, die wie Schlangen durch den Staub kriechen, die in Hunde verwandelt werden, denen die Schwänze lang wachsen, bis Angeln daraus werden, mit denen sie die Passanten einfangen und an ihre Mäuler heranziehen, wie es die Frau Mutter erzählt.
Aber der Herr Vater ist auch dafür da, um sie vor diesen Tücken zu bewahren. Und dann kann die Hölle, wenn man sie als Lebendiger aufsucht, wie der Herr Dante es getan hat, auch recht schön anzuschauen sein: jene, die leiden, dort drüben, und wir, die wir zuschauen, hier. Ist es nicht das, was die weißen Kapuzenmänner meinen, die sich jetzt den Rosenkranz von Hand zu Hand reichen?
3
Der Junge schaut verstört auf Marianna, sie erwidert entschlossen seinen Blick, denn sie will sich nicht einschüchtern lassen. Doch seine Lider sind geschwollen, sie flattern; möglicherweise sieht er nicht gut, sagt sich das Mädchen. Wer weiß, wie er sie sieht; vielleicht groß und dick, wie sie im Zerrspiegel von Tante Manina aussieht, vielleicht auch klein und schmächtig. Sie zieht ihm eine Grimasse, und im selben Augenblick löst sich das Gesicht des Jungen zu einem finsteren, schiefen Lächeln.
Der Herr Vater packt ihn mit der Hilfe eines anderen Weißen Bruders am Arm und zieht ihn zur Türe hin. Die Spieler sinken wieder in ihr gewohntes Halbdunkel zurück. Zwei trockene Hände heben das Mädchen hoch und setzen es sanft auf der oberen Treppenstufe wieder ab.
Die Prozession setzt sich wieder in Gang: vorneweg der Wächter mit der brennenden Fackel, dahinter der Herzog Ucrìa mit dem Gefangenen am Arm, dann die übrigen Weißen Brüder, der Eisenschlosser und zuletzt zwei Diener im schwarzen Wams. Erneut befinden sie sich in dem dreieckigen Raum inmitten des Kommens und Gehens von Wächtern und Dienern, die Fackeln hochhalten, Stühle herbeirücken, Becken mit warmem Wasser, leinene Handtücher, Teller mit Brot und kandierten Früchten bringen.
Der Herr Vater beugt sich mit liebevollen Gesten über den Jungen. Niemals hat sie ihn so zärtlich und aufmerksam gesehen, sagt sich Marianna. Mit der hohlen Hand schöpft er Wasser aus einem Becken und lässt es über die schleimverkrusteten Wangen des Jungen laufen; dann trocknet er ihn mit dem frisch gewaschenen Handtuch, das der Diener ihm reicht. Gleich darauf nimmt er ein Stück von dem weichen weißen Brot zwischen seine Finger und hält es lächelnd dem Gefangenen hin, als sei dieser sein liebstes Kind.
Der Junge lässt sich versorgen, waschen und füttern, ohne ein Wort zu sagen. Er weint und lächelt abwechselnd. Jemand drückt ihm einen Rosenkranz mit großen schillernden Perlen in die Hand. Er betastet ihn mit den Fingerkuppen, dann lässt er ihn auf den Boden fallen. Der Herr Vater macht eine ungeduldige Gebärde. Marianna bückt sich, um den Rosenkranz aufzuheben, und legt ihn in die Hände des Jungen zurück. Flüchtig berührt sie dabei zwei seiner eisigen, hornhäutigen Finger.
Der Gefangene macht die Lippen breit und entblößt seinen halb zahnlosen Mund. Seine geröteten Augen hat man mit einem in Lattichwasser getunkten Stoffballen gereinigt. Unter den nachsichtigen Blicken der Weißen Brüder streckt der Verdammte die Hand nach einem Teller aus, er sieht sich einen Augenblick lang verängstigt um, dann stopft er sich eine honigfarbene, überzuckerte Pflaume in den Mund.
Die fünf Edelmänner haben sich nun niedergekniet und lassen die Perlen der Rosenkränze durch ihre Finger gleiten. Der Junge, dessen Wangen von den kandierten Früchten noch gebläht sind, wird sanft auf die Knie niedergedrückt, damit auch er sich ins Gebet vertiefe.
Die heißesten Stunden des Tages vergehen so im feierlichen Gebet. Hin und wieder nähert sich ein Diener mit einem Tablett voller Gläser mit Wasser und Anis. Die Weißen trinken und nehmen ihr Gebet wieder auf. Der eine oder andere wischt sich den Schweiß ab, andere drohen einzudösen, wachen ruckartig wieder auf und setzen ihr Rosenkranzgebet fort. Auch der Junge schläft ein, nachdem er noch drei kristallisierte Aprikosen verschlungen hat. Keiner hat das Herz, ihn zu wecken.
Marianna beobachtet den Vater, wie er betet. Aber hinter welchem der Kapuzenmänner versteckt sich der Herzog Signoretto, ist es der hier oder der andere mit dem gesenkten Kopf? Es scheint ihr, als könne sie seine Stimme hören, die langsam das Ave-Maria hersagt.
Im Schneckengang ihres Ohres, in dem Schweigen herrscht, hat sie die Erinnerung an ein paar vertraute Stimmfetzen bewahrt: die gurgelnde, raue Stimme ihrer Frau Mutter, die schrille der Köchin Innocenza, die sonore, gutmütige des Herrn Vaters, die gleichwohl zuweilen spitz wurde und unangenehm zersplitterte.
Vielleicht hatte sie sogar sprechen gelernt. Aber wie alt war sie damals gewesen? Vier Jahre oder fünf? Ein zurückgebliebenes, schweigsames und verschlossenes Kind, das von den anderen leicht in irgendeiner Ecke abgestellt und vergessen wurde, an das man sich dann plötzlich erinnerte und es suchte, um ihm Vorwürfe darüber zu machen, dass es sich immer versteckte.
Eines Tages war sie ohne sichtbaren Grund verstummt. Das Schweigen hatte sich ihrer bemächtigt wie eine Krankheit oder vielleicht wie eine Berufung. Die festliche Stimme des Herrn Vaters nicht mehr hören zu können, war ihr schrecklich traurig erschienen. Dann aber hatte sie sich daran gewöhnt. Inzwischen stimmt es sie freudig, wenn sie ihm beim Sprechen zusieht, ohne seine Worte zu erfassen, fast wie eine böswillige Genugtuung.
„Du bist so geboren, taubstumm“, hatte ihr der Vater einmal ins Heft geschrieben, und sie hatte sich davon überzeugen müssen, dass sie sich jene fernen Stimmen nur eingebildet hatte. Sie kann ja nicht zugeben, dass der liebste Herr Vater, der sie so sehr liebt, sie belügen könnte, also muss sie selbst wohl eine Träumerin sein. An Fantasie fehlt es ihr nicht, ebenso wenig an der Lust nach Sprache, und daher:
e pì e pì e pì,
sette fimmini p’un tarì
e pì e pì e pì
un tarì e troppu pocu
sette fimmini p’un varcuocu.*
Doch die Gedanken des Mädchens werden unterbrochen, weil einer der Weißen hinausgeht und gleich darauf mit einem großen Buch zurückkehrt, auf dem in goldenen Lettern steht: SEELENBEKENNTNISSE. Der Herr Vater weckt den Knaben mit einem freundlichen Stoß, und gemeinsam ziehen sie sich in einen Winkel des Saales zurück, wo die Mauern eine Nische bilden und eine steinerne Platte in der Art eines Sitzes befestigt ist.
Dort beugt sich der Herzog Ucrìa von Fontanasalsa zum Ohr des Verdammten hinab und fordert ihn auf zu beichten. Der Junge murmelt ein paar Worte mit seinem jungen zahnlosen Mund. Der Herr Vater redet liebevoll-beharrlich auf ihn ein. Der Junge lächelt schließlich. Sie sehen nun aus wie Vater und Sohn, die selbstvergessen über Familiendinge sprechen.
Marianna beobachtet sie voller Bestürzung: Was nimmt sich dieser kleine Papagei, der da neben dem Vater kauert, nur heraus? Es scheint, als kenne er ihn seit eh und je, als habe er schon immer seine ungeduldigen Hände zwischen seinen Fingern gehalten, als kenne er deren Umrisse in- und auswendig, als habe er von Geburt an dessen Gerüche in der Nase verspürt, als sei er schon tausendmal im Leben von seinen kräftigen Armen ergriffen und vom Trittbrett einer Karosse oder aus einer Sänfte oder aus der Wiege oder von einer Treppenstufe gehoben worden, mit jenem Zugriff, den nur ein leiblicher Vater für seine Tochter aufzubringen imstande ist. Was nimmt er sich nur heraus?
Eine glühende Mordlust steigt ihr in die Kehle, überflutet ihren Gaumen und versengt ihre Lippen. Sie wird ihm einen Teller an den Kopf werfen, ein Messer in die Brust jagen, sie wird ihm alle Haare ausreißen, die er auf dem Kopf hat. Der Herr Vater gehört nicht ihm, sondern ihr, ihr, der armen Taubstummen, die auf der Welt nur eine Kostbarkeit besitzt, nämlich den Herrn Vater.
Die Mordgedanken verflüchtigen sich durch einen plötzlichen Luftzug. Die Tür ist aufgegangen, und auf der Schwelle erscheint ein Mann mit einem Bauch wie eine Melone. Er ist gekleidet wie ein Narr, halb rot und halb gelb: Er ist jung und dick, hat kurze Beine, kräftige Schultern, Arme wie ein Ringer, kleine, schielende Augen. Er kaut Kürbiskerne und spuckt fröhlich die Schalen in die Luft.
Als der Junge ihn sieht, erblasst er. Das Lächeln, das ihm der Herr Vater entlockt hat, erstirbt ihm; seine Lippen beginnen zu zittern und seine Augenlider zu flattern. Der Narr nähert sich ihm, wobei er weiterhin die Kürbiskernschalen umherspuckt. Als er den Jungen wie einen nassen Putzlumpen zu Boden gleiten sieht, gibt er zwei Dienern einen Wink, damit sie ihn hochziehen und zum Ausgang schleifen.
Die Luft ist erschüttert wie vom Flügelschlag eines nie gesehenen riesigen Vogels. Marianna blickt sich um. Die Weißen Brüder schreiten feierlich auf die Türe zu. Das Tor öffnet sich mit Schwung, und nun ist jener Flügelschlag so nah und heftig, dass er sie geradezu betäubt. Es sind die Trommler des Vizekönigs, hinter ihnen steht die Menschenmenge, sie schreit und hebt die Arme, jubiliert.
Die Piazza Marina, die vorher noch leer gewesen war, ist nun voller Menschen: ein Meer von wiegenden Köpfen, lang gestreckten Hälsen, geöffneten Mündern, erhobenen Standarten, trampelnden Pferden, eine apokalyptische Masse von Körpern, die sich übereinander häufen, sich bedrängen, die den ganzen rechteckigen Platz überschwemmt haben.
*Und pi und pi und pi / sieben Weibchen für einen Tarì / Und pi und pi und pi / ein Tarì ist viel zu wenig / sieben Weibchen für eine Aprikose.
4
Aus den Fenstern quellen Köpfe hervor, auf den Balkonen herrscht ein großes Gedränge von Gestalten, die die Arme ausstrecken und sich weit vorbeugen, um besser sehen zu können. Die Justizminister mit den gelben Paradestöcken, die königliche Garde mit den violett-goldenen Standarten, die Grenadiere mit ihren Bajonetten stehen da und können nur mit Mühe die ungeduldige Menge in Schach halten.
Worauf warten sie alle? Das Mädchen ahnt es, doch es wagt nicht, daran zu denken. All die schreienden Köpfe scheinen an das Schweigen in ihrem Inneren zu klopfen und Einlass zu verlangen.
Marianna löst ihren Blick von der Menge und sieht zu dem zahnlosen Knaben hin. Er steht still und kerzengerade da: Er zittert nicht mehr und fällt nicht mehr in sich zusammen. Ein stolzer Glanz ist in seinen Augen: so viel Trubel, und alles nur für ihn! Die festlich gekleideten Leute, die Pferde, die Kutschen, alle warten nur auf ihn. Die Standarten, die Uniformen mit den glänzenden Knöpfen, die Hüte mit den Federn, das Gold, der Purpur, alles nur für ihn. Es ist ein Wunder!
Zwei Wächter reißen ihn brutal aus seiner ekstatischen Betrachtung des eigenen Triumphes. An das Seil, mit dem seine Hände zusammengebunden sind, binden sie ein längeres und stärkeres Seil, das sie am Schwanz einer Mauleselin befestigen. So gefesselt, schleifen sie ihn in die Mitte des Platzes.
Im Hintergrund, hoch oben auf dem Steri, präsentiert sich stolz eine blutrote Fahne. Und dort aus dem Palazzo Chiaromonte treten nun die Großen Patres der Inquisition, immer zwei und zwei, vor und nach ihnen jeweils ein Grüppchen von Ministranten.
In der Mitte des Platzes steht eine Bühne, etwa zwei bis drei Armlängen hoch, gerade so wie jene Bühnen, auf denen die Geschichten von Nofriu und Travaglino, von Nardo und Tiberio aufgeführt werden. Nur dass diesmal an der Stelle des schwarzen Vorhangs ein düsteres Holzgerüst steht; eine Art umgekehrtes L, an dem ein Seil mit einer Schlinge befestigt ist.
Marianna wird vom Herrn Vater hinter dem Gefangenen hergeschoben, der seinerseits hinter der Mauleselin herläuft. Die Prozession hat sich nun in Gang gesetzt, und niemand vermag sie mehr aufzuhalten, hätte er selbst den triftigsten Grund: vorneweg die königliche Garde hoch zu Pferde, dann die Weißen Herrn in ihren Kapuzen, die Minister der Justiz, die Erzdiakone, die Priester, die barfüßigen Mönche, die Trommler, die Trompeter, ein langer Zug, der sich mühsam seinen Weg durch die aufgeregte Menge bahnt.
Bis zum Galgen sind es nur ein paar Schritte, und doch scheint er weit entfernt in Anbetracht der umständlichen Umkreisung des ganzen Platzes, in der sich der Zug dorthin bewegt.
Endlich stößt Mariannas Fuß gegen eine hölzerne Stufe. Sie sind tatsächlich angekommen. Der Herr Vater steigt mit dem Verurteilten die Treppe hinauf, geführt vom Henker und gefolgt von den anderen Brüdern des Guten Todes.
Der Junge hat nun wieder jenes verstörte Lächeln auf dem blassen Gesicht. Das kommt, weil der Herr Vater ihn verzaubert, ihn mit seinen Trostworten fesselt, er öffnet ihm das Paradies, indem er ihm dessen Herrlichkeiten beschreibt, ein Dasein voller Ruhe und Muße, üppiger Mahlzeiten und ausgedehnter Schläfchen. Der Junge, ganz benommen wie ein Kleinkind von diesen eher mütterlichen als väterlichen Worten, scheint keinen anderen Wunsch mehr zu haben, als schnurstracks ins Jenseits zu eilen, wo es keine Gefängnisse, keine Wanzen, keine Krankheiten und keine Leiden gibt, sondern nur Zuckerwerk und Rast.
Das Mädchen sperrt die schmerzenden Augen auf; ein heftiger Wunsch bemächtigt sich ihrer: wenn sie mit ihm tauschen könnte, und sei’s nur für eine Stunde, wenn sie dieser zahnlose Junge mit den hervortretenden Augen sein könnte, um einmal die Stimme des Herrn Vaters wieder zu hören, um den Honig dieses allzu früh verlorenen Klangs zu kosten, ein einziges Mal nur, selbst wenn sie dafür sterben müsste und an jenem Strick aufgehängt würde, der dort in der Sonne baumelt.
Der Henker kaut noch immer Kürbiskerne und spuckt mit einem verächtlichen Ausdruck die Schalen durch die Luft. Es ist alles genau wie im Puppentheater: Gleich wird Nardo den Kopf heben, und der Henker wird ihm eine Tracht Prügel mit dem Holzstock versetzen. Nardo wird mit den Armen rudern, wird unter den Bühnenrand fallen, und dann wird er lebendiger als vorher wieder auftauchen, um noch mehr Prügel und Beleidigungen einzustecken.
Und die Menschenmenge lacht, schwatzt, isst und wartet auf die Stockschläge, gerade wie im Theater. Die Wasser- und Anisverkäufer kommen bis vor die Bühne, um ihre Schoppen anzubieten, sie werden beiseitegeschubst von denen, die „vasteddi e meusa“, gekochte Tintenfische und Kaktusfeigen, feilbieten. Jeder will seine Ware mithilfe der Ellenbogen in den Vordergrund schieben.
Ein Bonbonhändler tritt dem Mädchen vor die Nase, und als hätte er erraten, dass sie taub ist, deutet er mit beredten Gesten auf seinen Bauchladen, der an einem schmierigen Band um seinen Hals hängt. Marianna wirft einen schrägen Blick auf die kleinen Metallzylinder. Sie bräuchte nur die Hand auszustrecken, einen davon zu nehmen, mit dem Finger dagegenzudrücken, um den kreisförmigen Deckel zu öffnen und den kleinen, nach Vanille schmeckenden Zylinder herausgleiten zu lassen. Aber sie will sich nicht ablenken lassen; ihre Aufmerksamkeit gilt etwas anderem, nämlich dem, was dort oben am Ende der geschwärzten Holzstufen geschieht, wo der Herr Vater immer noch mit tiefer, weicher Stimme zu dem Verurteilten spricht, als sei dieser Fleisch von seinem Fleische.
Die letzten Stufen sind nun erklommen. Der Herzog Ucrìa verneigt sich vor den Autoritäten, die vor der Bühne sitzen: vor den Senatoren, den Prinzen, den Richtern. Dann kniet er gedankenvoll nieder, den Rosenkranz zwischen den Fingern. Die Menge wird einen Augenblick lang still. Sogar die fliegenden Händler unterbrechen ihr aufgeregtes Geschrei und bleiben mit ihren Rollwägelchen, ihren Gurten und ihren Waren stehen, mit offenem Mund strecken sie die Nasen in die Luft.
Nach dem Gebet hält der Herr Vater dem Verdammten das Kreuz hin, damit er es küsse. Und es hat den Anschein, als sei es nicht Christus, sondern er selbst, der dort am Kreuz, nackt und gemartert, sein schönes elfenbeinernes Fleisch und sein Haupt mit der Dornenkrone den lächerlichen Lippen des verängstigten Jungen zum Kuss anbietet, um ihn zu beruhigen und zu besänftigen und ihn glücklich und friedvoll in die andere Welt zu schicken.
Zu ihr ist er nie so zärtlich gewesen, so körperlich, so nahe, sagt sich Marianna, ihr hat er niemals seinen Körper zum Kuss angeboten, und nie hat er sich ihr so zugewandt, als wolle er sie mit zarten und tröstenden Worten überschütten.
Der Blick des Mädchens fällt auf den Verurteilten, und sie sieht, wie er sich mühsam niederkniet. Die verführerischen Worte des Herzogs Ucrìa sind wie weggewischt bei der Berührung mit dem kalten, glitschigen Seil, das der Henker ihm um den Hals legt. Trotzdem schafft er es irgendwie, sich aufrecht zu halten, und seine Nase beginnt zu rinnen. Er versucht, eine Hand zu befreien, um sich den Rotz abzuwischen, der ihm von der Lippe, vom Kinn tropft. Doch die Hand ist fest auf den Rücken gebunden. Zwei-, dreimal hebt er die Schulter, verdreht er den Arm, es scheint, als sei ihm das Naseputzen in diesem Augenblick das einzig Wichtige.
Die Luft erzittert von den Schlägen einer großen Trommel. Auf ein Zeichen des Richters gibt der Henker der Kiste, auf die hinaufzusteigen er den Jungen gezwungen hat, einen Tritt. Ein Zucken geht durch den Körper, dann streckt er sich, fällt in sich zusammen und beginnt, sich zu drehen.
Doch irgendetwas hat nicht richtig geklappt. Denn statt herunterzuhängen wie ein Sack, windet sich der Erhängte weiterhin in der Luft, mit geschwollenem Hals und aus den Höhlen tretenden Augen.
Als der Henker sieht, dass sein Werk nicht gelungen ist, zieht er sich mit kräftigen Armen am Galgen hoch, springt auf den Erhängten, und ein paar Augenblicke lang baumeln beide am Seil wie zwei Frösche bei der Paarung, während die Menge den Atem anhält.
Nun aber ist er wirklich tot; das sieht man an der Marionettenhaltung, die der hängende Körper eingenommen hat. Der Henker rutscht behänd am Galgenmast herab und landet mit einem geschickten Sprung auf dem Podest. Die Leute werfen ihre Mützen in die Luft. Ein blutjunger Brigant, der ein Dutzend Menschen umgebracht hat, ist hingerichtet worden. Das wird das Mädchen aber erst später erfahren. Bis jetzt steht sie da und fragt sich, was er getan haben mag, dieser Junge mit dem verängstigten, dummen Gesicht, der nur wenig älter war als sie selbst.
Der Herr Vater beugt sich erschöpft über die Tochter. Er berührt ihren Mund, als erwarte er sich ein Wunder. Er umfasst ihr Kinn und sieht ihr drohend und flehentlich in die Augen. „Du musst sprechen“, sagen seine Lippen, „du musst diesen verdammten Fischmund aufmachen!“
Das kleine Mädchen versucht, die Lippen zu formen, doch sie schafft es nicht. Ein unaufhaltsames Zittern packt ihren Körper. Die Hände, die sich noch an die Falten der väterlichen Kutte klammern, sind starr, steinern.
Der Junge, der gemordet hatte, ist tot. Und Marianna fragt sich, ob es sein kann, dass sie ihn getötet hat, da sie seinen Tod herbeigewünscht hat wie einen verbotenen Besitz.
5
Die Geschwister posieren vor ihr. Ein farbiges, eindrückliches Bild: Signoretto, der dem Herrn Vater so ähnlich ist mit seinem feinen Haar, den wohl geformten Beinen, der festlichen und zuversichtlichen Miene; Fiammetta in ihrem Nonnenkleidchen, das Haar unter der Spitzenhaube versteckt; Carlo in seinen kurzen Hosen, die sich um seine dicken Schenkel spannen, mit glitzernden schwarzen Augen; Geraldo, der vor Kurzem die Milchzähne verloren hat und lächelt wie ein Alter; Agata mit ihrer hellen, durchsichtigen Haut, die von Mückenstichen übersät ist.
Die fünf beobachten ihre stumme Schwester, die sich über die Palette beugt, und es sieht aus, als malte nicht sie die Geschwister, sondern die Geschwister sie. Sie mustern sie, während sie die farbigen Rundungen ausmalt, den Pinsel in die Ölfarbe taucht und ihn wieder zur Leinwand führt; rasch verschwindet das Weiß unter einem überaus zarten Gelb, und über diesem Gelb breitet sich in klaren, fröhlichen Pinselstrichen das Hellblau aus.
Carlo sagt etwas, worüber sie alle in Lachen ausbrechen. Marianna bittet sie mit Gesten, sie möchten doch noch ein wenig still halten. Die Kohlezeichnung mit den Köpfen, den Kragen, den Armen, den Gesichtern, den Füßen steht bereits dort auf der Leinwand. Die Farbe füllt nur mühsam die Formen, sie droht zu verlaufen und nach unten zu tropfen. Und geduldig erstarren die Geschwister wieder für ein paar Minuten. Dann aber ist es Geraldo, der das Gleichgewicht stört, indem er Fiammetta zwickt, die dies mit einem Fußtritt erwidert. Und gleich geht es los mit den Remplern, Schubsen und Ohrfeigen. Bis Signoretto sie mit Kopfnüssen zur Ordnung ruft: Er ist der Älteste und darf dies tun.
Marianna nimmt ihre Arbeit wieder auf und taucht den Pinsel ins Weiß, ins Rosa, während ihre Augen zwischen der Leinwand und der Gruppe der Geschwister hin- und herwandern. Es ist etwas Körperloses in ihrem Porträt, etwas zu Glattes, Irreales. Fast sieht es aus wie eines jener offiziellen „Porträtchen“, die die Frau Mutter von den Freundinnen zu machen pflegt, auf denen sie alle steif und kerzengerade dasitzen, weshalb nicht viel mehr als eine entfernte Erinnerung an das Modell übrig bleibt.
Sie muss sich ihre Charaktere besser vor Augen halten, sagt sie sich, wenn sie nicht will, dass sie ihr entgleiten. Signoretto will mit dem Vater konkurrieren, mit seinem autoritären Gehabe, seinem sonoren Lachen. Und die Frau Mutter beschützt ihn: Wenn Vater und Sohn aneinandergeraten, schaut sie ihnen unbeteiligt, beinahe amüsiert zu. Aber ihre nachsichtigen Blicke verweilen mit einer solchen Intensität auf dem Haupt des Sohnes, dass es für alle offensichtlich ist.
Der Herr Vater hingegen fühlt sich von ihm eher irritiert: Nicht nur, dass dieses Kind ihm auf eine überraschende Weise ähnelt, er führt auch seine Bewegungen besser aus als er selbst, mit mehr Anmut und Spannkraft. Als stünde er vor einem Spiegel, der ihm schmeichelt und ihn gleichzeitig daran erinnert, dass er selbst bald schmerzlos ersetzt würde. Außerdem ist er der Erstgeborene und trägt daher seinen Namen.
Der taubstummen Schwester gegenüber verhält sich Signoretto meist als Beschützer, wenn auch ein wenig eifersüchtig wegen der Aufmerksamkeit, die der Herr Vater ihr zukommen lässt; zuweilen zeigt er sich verächtlich gegen ihre Behinderung, andere Male aber nimmt er diese als Vorwand, um den anderen zu zeigen, wie großzügig er ist; doch man weiß nie, wo die Wahrheit aufhört und die Selbstdarstellung beginnt.
Neben ihm Fiammetta im Nonnenkleid, mit Augenbrauen wie Balken, zu eng beieinanderstehenden Augen und schiefen Zähnen. Sie ist nicht schön wie Agata, und deshalb wurde sie für das Kloster bestimmt. Selbst wenn sie einen Mann fände, könnte man nicht verhandeln, wie man das mit einer geborenen Schönheit kann. Im kleinen und wachen Gesicht dieses Kindes zeichnet sich schon jetzt die Kampfansage gegen eine Zukunft als Gefangene ab, die sie im Übrigen keck akzeptiert hat, indem sie diese Tracht trägt, die jede weibliche Form ihres Körpers verbirgt.
Carlo und Geraldo, fünfzehn und elf Jahre alt, sind sich so ähnlich, dass sie wie Zwillinge wirken. Aber der eine wird ins Kloster gehen und der andere zu den Dragonern. Oft sind sie gekleidet wie ein Miniatur-Abt und ein Miniatur-Soldat, Carlo in der Kutte und Geraldo in Uniform, und kaum sind sie im Garten, machen sie sich einen Spaß daraus, die Kleider zu tauschen oder sich ineinander verkrallt auf der Erde zu wälzen, sodass sowohl die cremefarbene Kutte als auch die schöne Uniform mit den Goldborten völlig ruiniert sind.
Carlo neigt zum Dickwerden. Er ist gierig auf Süßigkeiten und Delikatessen. Aber er ist auch der Liebevollste all ihrer Geschwister, und oft kommt er zu ihr, nur um ihre Hand zu halten.
Agata ist die Jüngste und die Schönste von allen. Man steht ihretwegen schon in Verhandlungen zu ihrer Verheiratung, die, ohne dass dem Haus etwas entzogen würde, außer einer Mitgift von dreißigtausend Scudi, der Familie die Möglichkeit geben wird, ihren Einfluss zu vergrößern, nützliche Verschwägerungen herzustellen, auf reiche Nachkommenschaft zu sinnen.
Als Marianna ihren Blick wieder hebt und auf die Geschwister richten will, sieht sie, dass sie verschwunden sind. Während sie in ihre Leinwand versunken war, haben sie die Gelegenheit genutzt, um sich davonzumachen, in der Gewissheit, dass sie weder ihr Kichern noch ihr Weglaufen hören könne.
Sie wendet gerade noch rechtzeitig den Kopf, um den Zipfel von Agatas Röckchen zu erspähen, wie es zwischen den Agaventrieben hinter dem „Häuschen“ verschwindet.
Wie soll sie nun das Bild weitermalen? Sie wird sich auf ihr Gedächtnis verlassen müssen, denn sie weiß schon, dass sich alle ihre fünf Geschwister nie wieder hier versammeln und für sie posieren werden, wie sie es heute nach langem Warten und Drängen getan haben.
Die Leere, die ihre Gestalten hinterlassen haben, hat sich sofort wieder gefüllt mit der Zwergpalme, den Jasminbüschen und den Olivenbäumen, die den Abhang zum Meer bewachsen. Warum soll sie nicht diese stille und immer gleiche Landschaft malen anstatt der Geschwister, die niemals still halten? In ihr ist mehr Tiefe und Geheimnis, seit Jahrhunderten posiert sie freundlich und scheint zu jedem Spiel bereit zu sein.
Mariannas jugendliche Hand greift sich eine neue Leinwand und schraubt sie anstelle der ersten auf der Staffelei fest; sie taucht den Pinsel in das weiche, ölige Grün. Wo aber soll sie beginnen? Bei dem frischen und glänzenden Grün der Zwergpalme oder beim blau flimmernden Grün des Olivenhains oder beim gelb gestreiften Grün der Hänge des Monte Catalfano?
Sie könnte auch das „Häuschen“ malen, so wie der Großvater Mariano Ucrìa es erbaut hat; mit seinen schiefen und plumpen Formen und den Fenstern, die eher zu einem Turm als zu einem Landhaus passen würden. Eines Tages wird das „Häuschen“ in eine Villa umgebaut werden, dessen ist sie sich sicher, und dann wird sie auch im Winter darin wohnen, denn ihre Wurzeln sind hier in dieser Erde, die sie mehr liebt als die Pflastersteine von Palermo.
Während sie noch unschlüssig mit dem tropfenden Pinsel dasteht, fühlt sie sich am Ärmel gezupft. Sie wendet den Kopf. Es ist Agata, die ihr einen Zettel hinhält.
„Der Puppenspieler ist da, komm!“ An der Handschrift erkennt sie, dass Signoretto das geschrieben hat. In der Tat klingt es eher wie ein Befehl als eine Einladung.
Sie steht auf, trocknet den tropfenden Pinsel mit einem feuchten Tuch, wischt sich die Hände an der gestreiften Baumwollschürze ab und geht hinter ihrer Schwester her in Richtung Vorhof. Carlo, Geraldo, Fiammetta und Signoretto stehen schon um Tutui herum. Der Puppenspieler hat seinen Esel an den Feigenbaum gebunden und ist dabei, sein Theater aufzubauen. Vier vertikale Bretter, die sich mit drei horizontalen Stangen kreuzen. Rundherum vier Armlängen schwarzes Leinen.
Unterdessen sind an den Fenstern die Diener erschienen, die Köchin Innocenza, Don Raffaele Cuffa und sogar die Frau Mutter, der der Puppenspieler unverzüglich seine Ehrerbietung erweist, indem er sich tief vor ihr verbeugt.
Die Herzogin wirft ihm eine Zehn-Tarì-Münze zu, er hebt sie geschwind auf, stopft sie sich ins Hemd, verbeugt sich nochmals theatralisch und holt dann seine Puppen aus der Satteltasche, die an den Flanken des Esels herabhängt.
Marianna hat sie schon gesehen, diese Stockschlägereien, diese Köpfe, die unter den Bühnenrand stürzen, um gleich darauf frech und spöttisch wieder zu erscheinen. Jedes Jahr um diese Zeit taucht der Tutui im „Häuschen“ von Bagheria auf, um die Kinder zu unterhalten. Jedes Jahr wirft die Herzogin ihm eine Zehn-Tarì-Münze zu, und jedes Mal überstürzt sich der Puppenspieler in Verbeugungen und Hutschwenken, und zwar so übertrieben, dass man meinen könnte, er wolle alle an der Nase herumführen.
In der Zwischenzeit sind, man weiß nicht, von wem herbeigerufen, Dutzende von Dreikäsehochs aus den benachbarten Höfen eingetroffen. Die Mägde kommen auf den Hof herunter, trocknen sich die Hände an den Schürzen ab und streichen sich das Haar glatt. Auch Don Ciccio Calò, der Kuhhirt, ist mit seinen Zwillingstöchtern Lina und Lena aufgetaucht, ebenso Peppe Geraci, der Gärtner, mit Frau Maria und ihren fünf Kindern, sowie der Lakai Don Peppino Cannarota.
Da ist auch schon Nardo, der den Tiberio mit Stockschlägen traktiert – pitsch, patsch! Das Schauspiel hat begonnen, und die Kinder haben noch immer nicht aufgehört zu spielen. Einen Augenblick später aber sitzen sie alle brav dort auf der Erde, die Nasen in die Luft gestreckt und den Blick starr auf die Szene gerichtet.
Marianna bleibt ein wenig abseits stehen. Die Kinder machen ihr Angst: Zu oft schon ist sie ihren Neckereien zum Opfer gefallen. Sie springen sie an, wenn sie sie nicht sehen kann, um sich über ihre Schreckreaktion zu freuen, sie wetten miteinander, wem es gelingt, einen Knallfrosch explodieren zu lassen, ohne dass sie es merkt.
Inzwischen ist aus der Tiefe jenes schwarzen Leinens ein neuer, unerwarteter Gegenstand aufgetaucht: ein Galgen. Noch nie ist im Theater des Tutui ein Galgen zu sehen gewesen, und bei seinem Anblick halten die Dreikäsehochs die Luft an vor Aufregung, denn das ist wirklich eine spannende Neuigkeit!
Ein Gendarm mit einem Schwert an der Seite, der zunächst den Nardo wie üblich längs der schwarzen Leinwand rauf- und runtergejagt hat, packt ihn nun endlich am Kragen und steckt ihm den Kopf in die Schlinge. Ein Tamburspieler erscheint auf der linken Seite, und Nardo muss auf ein Schemelchen steigen. Dann gibt der Gendarm dem Schemel einen Fußtritt, sodass er beiseitefliegt, und Nardo sackt in sich zusammen, während das Seil sich zu drehen beginnt.
Marianna wird von einem Zittern geschüttelt. Etwas in ihrer Erinnerung zappelt wie ein Fisch an der Angel, etwas, das nicht heraufkommen will und um sich schlagend das stille Wasser ihres Bewusstseins aufrührt. Die Hand hebt sich, um nach dem groben Stoff der Kutte des Herrn Vaters zu fassen, aber sie stößt nur auf die struppigen Schwanzhaare des Esels.
Nardo baumelt im Leeren, baumelt mit der ganzen Leichtigkeit seines jungenhaften Körpers, triefäugig und zahnlos, im starren Blick ein grenzenloses Staunen, und es sieht aus, als hebe er seine Schulter und wolle krampfhaft eine Hand befreien, um sich die rinnende Nase abzuwischen.
Marianna fällt steif und schwer nach hinten und schlägt mit dem Kopf auf den nackten harten Boden des Vorhofs. Alles dreht sich nach ihr um. Agata läuft zu ihr hin, gefolgt von Carlo, der sich über die Schwester beugt und in Tränen ausbricht. Cannarotas Frau wedelt ihr mit der Schürze Luft zu, während eine Magd davonstürzt, um die Herzogin herbeizurufen. Der Puppenspieler lugt unter dem schwarzen Vorhang hervor, in der Hand hält er eine Puppe mit dem Kopf nach unten, während Nardo immer noch oben am Galgen baumelt.
6
Eine Stunde später erwacht Marianna im Schlafzimmer der Eltern mit einem nassen Tuch auf der Stirn. Der Essig sickert zwischen ihren Lidern hindurch und brennt ihr in den Augen. Die Frau Mutter ist über sie gebeugt: Sie hat sie erkannt, noch bevor sie die Augen öffnet, an ihrem starken Geruch nach honigsüßem Schnitttabak.
Die Tochter schaut die Mutter von unten her an: der volle, von einem zarten blonden Flaum umschleierte Mund, die vom vielen Tabakschnupfen geschwärzten Nasenlöcher, die großen, dunklen, gutmütigen Augen; sie könnte nicht sagen, ob sie schön ist oder nicht, gewiss ist da etwas, das störend wirkt, aber was? Vielleicht ihr Hang, jeglichem Druck nachzugeben, ihre unerschütterliche Ruhe, ihr Sich-Einhüllen in die süßlichen Gerüche des Tabaks, gleichgültig gegen alles und jeden.
Sie hat immer den Verdacht gehegt, dass die Frau Mutter in ferner Vergangenheit, als sie noch sehr jung und fantasievoll war, beschlossen hat, sich totzustellen, um nicht sterben zu müssen. Von dort muss ihr jene besondere Fähigkeit zugewachsen sein, alles Lästige mit einem Maximum an Gehorsam und einem Minimum an Kraftaufwand zu ertragen.
Großmutter Giuseppa schrieb ihr, bevor sie starb, zuweilen etwas über die Mutter in das Heft mit den Bourbonen-Lilien: „Deine Mutter war so schön, dass alle sie haben wollten, aber sie wollte niemanden. Sie war eine ‚Cabeza de cabra‘, ein Dickschädel wie ihre Mutter, die aus der Gegend von Granada stammte. Sie wollte den Cousin nicht heiraten, wollte ihn einfach nicht, deinen Vater Signoretto. Und alle sagten: Er ist doch ein schönes Jungchen, und schön ist er ja wirklich, nicht weil er mein Sohn ist, sondern weil man sich die Augen reiben muss bei seinem Anblick. Sie machte eine Schnute, als sie ihn heiratete, deine Mutter sah aus, als ginge sie zu einer Beerdigung, und einen Monat nach der Hochzeit verliebte sie sich in ihren Mann, und liebte ihn so sehr, dass sie anfing, Tabak zu schnupfen … nachts konnte sie nicht mehr schlafen und nahm deshalb Laudanum …“
Als die Herzogin Maria sieht, dass die Tochter wieder zu sich gekommen ist, geht sie zum Schreibtisch, nimmt ein Blatt Papier und schreibt etwas darauf. Sie trocknet die Tinte mit Asche und reicht dem Mädchen das Blatt.
„Wie geht’s meinem Kindchen?“
Marianna hustet und spuckt den Essig aus, der ihr in den Mund geflossen ist, während sie sich aufrichtet. Die Frau Mutter nimmt lachend den nassen Lappen von ihrem Gesicht. Dann geht sie wieder zum Schreibtisch, kritzelt noch etwas und kehrt mit dem Blatt zum Bett zurück.
„Du bist nu dreizehn Jahre alt und es is an der Zeit dir zu sagen das du dich vermälen must und wir einen Mann für dich gefunden haben weil ich nich ein Nönnchen aus dir machen will wie es das Schiksal deiner Schwester Fiammetta is.“
Zweimal liest das Mädchen dieses eilig hingeschriebene Billett der Mutter, auf dem die Rechtschreibung völlig außer Acht gelassen ist, Dialekt und Hochsprache durcheinandergewürfelt sind und auch das Schriftbild schief und wellig verläuft. Einen Ehemann? Aber warum nur? Sie dachte immer, dass ihr, stumm wie sie ist, das Heiraten verwehrt sei. Außerdem ist sie erst dreizehn Jahre alt.
Die Frau Mutter wartet nun auf eine Antwort. Sie lächelt sie liebevoll an, aber das Liebevolle ist ein wenig gespielt. Sie fühlt für diese taubstumme Tochter ein unerträgliches Mitleid und eine Verlegenheit, die sie erstarren lässt. Sie weiß nicht, wie sie sich ihr gegenüber verhalten, wie sie sich ihr verständlich machen soll. Schon das Schreiben behagt ihr wenig; und gar die Handschrift anderer entziffern zu müssen, ist eine wahre Tortur für sie. Doch mit mütterlicher Selbstverleugnung schreitet sie gehorsam auf den Schreibtisch zu, nimmt ein weiteres Blatt, den Gänsekiel und das Tintenfässchen und bringt alles der Tochter ans Bett.
„Für die Taubstumme einen Mann?“, schreibt Marianna, auf einen Ellenbogen gestützt, und in ihrer Verwirrung bekleckst sie das Laken mit Tinte.
„Der Herr Vater hat alles getan, um dich zum Sprechen zu bringen hat dich sogar mit sich mitgenommen zur Vicaria damit der Schreck dir hilft aber du hast nicht gesprochen weil du einen Dickschädel hast und nicht willens bist … deine Schwester Fiammetta wird sich mit Christus vermählen, Agata ist dem Sohn vom Prinzen von Torre Mosca versprochen, du hast die Pflicht den Bräutigam zu nehmen den wir für dich ausgesucht haben, denn wir wollen dein Bestes und lassen dich deshalb nicht von der Familie weg darum geben wir dir deinen Onkel Pietro Ucrìa von Campo Spagnolo zum Mann, Baron von Scannatura, Bosco Grande und Fiume Mendola, Graf von Sala Paruta, Markgraf von Sollazzi und Taya. Der außer dass er mein Bruder ist auch ein Vetter von deinem Vater ist und er ist dir gut gesinnt und nur bei ihm kannst du Heil für deine Seele finden.“
Marianna liest mit finsterem Blick, nicht länger auf die Orthografiefehler der Mutter achtend, ebenso wenig auf die Dialektworte, die sie zuhauf hineingestreut hat. Vor allem die letzten Zeilen liest sie mehrfach: Ihr Onkel Pietro soll also der Auserwählte, der „Bräutigam“ sein? Jener traurige, missmutige Mann, der immer rote Kleider trägt und den sie in der Familie den „Krebs“ nennen?
„Ich werde überhaupt nicht heiraten“, schreibt sie zornig auf die Rückseite des Blattes, das noch feucht ist vom Schreiben der Mutter.
Die Herzogin kehrt geduldig zum Schreibtisch zurück, ihre Stirn ist von kleinen Schweißtropfen bedeckt: Wie ihr diese taubstumme Tochter zu schaffen macht; sie will nicht begreifen, dass sie nur eine Last ist und sonst nichts.
„Dich nimmt sonst keiner meine kleine Marianna. Und fürs Kloster braucht es eine Mitgift, das weißt du ja. Wir müssen schon das Geld für Fiammetta aufbringen, es ist sehr teuer. Dein Onkel Pietro nimmt dich ohne alles weil er dich gerne mag und alle seine Ländereien werden dir gehören, hast du verstanden?“
Nun legt die Frau Mutter die Feder aus der Hand und beginnt, schnell und eindringlich auf sie einzureden, als könne sie sie hören, während sie ihr zerstreut über das essigfeuchte Haar streichelt.
Endlich reißt sie der Tochter, die soeben etwas schreiben will, die Feder aus der Hand und schreibt rasch, voller Stolz, die folgenden Worte nieder:
„Fünfzehntausend Scudi sofort und bar auf die Hand.“
7
Ein Haufen von Tuffsteinziegeln breitet sich auf dem Hof aus. Eimer voll Gips, Berge von aufgeschüttetem Sand. Marianna geht in der Sonne auf und ab, sie hat ihren Rock in der Taille hochgebunden, damit der Saum nicht schmutzig wird.
Die Stiefelchen sind aufgeknöpft, das Haar ist im Nacken hochgesteckt mit den silbernen Nadeln, die sie von ihrem Mann geschenkt bekommen hat. Ringsherum ist ein großes Durcheinander von Holzteilen, Mauerkellen, Schaufeln, Schippen, Schubkarren, Hämmern und Äxten.
Die Rückenschmerzen sind jetzt fast unerträglich; ihre Augen suchen nach einem schattigen Platz, an dem sie sich ein paar Minuten lang ausruhen könnte. Der große Stein neben dem Stall, warum nicht dort, auch wenn man über den Schlamm schlittern muss, um zu ihm zu gelangen. Marianna lässt sich darauf nieder und hält sich den Rücken mit den Händen. Sie sieht auf ihren Bauch; man sieht kaum eine Schwellung, obwohl sie schon im fünften Monat ist, und es ist ihre dritte Schwangerschaft.
Dort vor ihr steht die wunderschöne Villa. Vom „Häuschen“ ist keine Spur geblieben. An seinem Platz steht nun ein dreistöckiger Mittelbau mit einer Treppe, die sich in eleganten Schlangenlinien herabwindet. Vom Mittelbau gehen zwei Flügel mit Kolonnaden ab, die sich erst weiten und dann wieder aufeinander zulaufen, sodass sie einen fast geschlossenen Kreis bilden. Die Fenster wechseln sich in regelmäßigem Rhythmus ab: eins, zwei, drei, eins; eins, zwei, drei, eins; fast wie ein Tanz. Einige sind echt, andere aufgemalt, um das Gleichmaß der Fuge einzuhalten. In eines dieser Fenster wird sie einen roten Vorhang malen lassen und vielleicht einen Frauenkopf, der hinaussieht, vielleicht sie selbst, die hinter der Fensterscheibe steht.
Der Herr Onkel und Gatte wollte das „Häuschen“ so lassen, wie Großvater Mariano es erbaut hatte und wie die Vettern es über so lange Zeit in gutem Einvernehmen untereinander auch geteilt hatten. Sie aber hatte darauf bestanden und ihn endlich davon überzeugt, dass man eine Villa bauen müsse, in der man auch den Winter verbringen könne, mit ausreichend Zimmern für die Kinder, die Dienerschaft, die Freunde, die zu Besuch kommen. Und der Herr Vater hat ohnehin ein anderes Jagdhäuschen in der Umgebung von Santa Flavia erstanden.
Der Herr Onkel und Gatte hat sich nur selten auf der Baustelle blicken lassen. Die Ziegel, der Staub, der Kalk waren ihm lästig. Er blieb lieber in Palermo in seinem Haus in der Via Alloro, während sie sich in Bagheria um die Handwerker und Maler kümmerte. Auch der Architekt kam nur ungern und überließ das meiste dem Maurermeister und der jungen Herzogin.
An Geld hatte die Villa bereits eine Unmenge verschlungen. Allein der Architekt hatte sechshundert Unzen verlangt. Die Sandsteinziegel gingen am laufenden Band zu Bruch, und man musste jede Woche neue kommen lassen; der Maurermeister war vom Gerüst gefallen und hatte sich den Arm gebrochen, so hatte man die Arbeit für zwei Monate liegen lassen müssen.
Als nur noch die Fußböden fehlten, waren in Bagheria die Pocken ausgebrochen, und erneut stand die Arbeit monatelang still. Der Herr Onkel und Gatte war mit den Töchtern Giuseppa und Felice nach Torre Scannatura geflüchtet. Sie aber war geblieben, trotz der schriftlichen Befehle, die ihr der Herzog zukommen ließ: „Verlasst diesen Ort, sonst wird Euch das Übel befallen … Ihr habt die Pflicht, an das Kind zu denken, das Ihr unter dem Busen tragt.“
Sie aber hatte durchgehalten: Sie wollte hierbleiben, und sie hatte nur darum gebeten, Innocenza bei sich behalten zu dürfen. Alle anderen konnten sich ihretwegen auf die Hügel von Scannatura zurückziehen.
Der Herr Onkel und Gatte war erbost über sie gewesen, doch er hatte nicht allzu lange auf seinem Willen beharrt. Nach vier Jahren Ehe hatte er es aufgegeben, Gehorsam von seiner Frau zu verlangen; er respektierte ihre Wünsche, solange sie ihn nicht zu sehr damit behelligte und solange diese nicht seinen Vorstellungen davon widersprachen, wie man die Kinder zu erziehen habe, und solange sie nicht seine Rechte als Ehemann beschnitten.
Er verlangte nicht, wie Agatas Mann, an jedem ihrer alltäglichen Beschlüsse beteiligt zu werden. Schweigsam, einzelgängerisch, den Kopf zwischen die Schultern gepresst wie eine Schildkröte, mit stets unzufriedener und ernster Miene, war der Herr Onkel und Gatte im Grunde viel toleranter als die meisten anderen Ehemänner, die sie kannte.
Sie hatte ihn niemals lächeln sehen, bis auf einmal, als sie sich einen Schuh ausgezogen hatte, um den nackten Fuß in einen Brunnen zu tauchen. Dann niemals wieder. Von der ersten Nacht an behielt dieser kalte und schüchterne Mann die Gewohnheit bei, an der äußersten Kante des Bettes zu schlafen und ihr den Rücken zuzukehren. Eines Morgens aber, während sie noch schlief, hatte er sich auf sie geworfen und sie vergewaltigt.
Der Körper der dreizehnjährigen Ehefrau hatte mit Treten und Kratzen reagiert. Sehr früh am darauffolgenden Morgen war Marianna nach Palermo zu den Eltern geflohen. Und dort hatte ihr die Frau Mutter geschrieben, dass sie sehr schlecht daran getan hätte, ihren Platz als Ehegattin zu verlassen und sich wie ein „Tintenfisch“ zu benehmen, der die ganze Familie mit Schmach und Schande überschüttet.
„Wer sich vermählt und es nicht bereut, kann sich ganz Palermo für nur hundert Unzen kaufen“; und: „Wer aus Liebe heiratet, wird in Schmerzen leben“; und: „Hühner und Frauen verirren sich, wenn sie zu weit laufen“; und: „Eine gute Frau macht einen guten Mann“; mit solchen Sprichwörtern und Vorwürfen wurde sie überhäuft. Auch die fromme Tante Teresa hatte sich auf die Seite der Mutter geschlagen und ihr geschrieben, dass sie eine „Todsünde“ begangen habe, indem sie das eheliche Dach verlassen habe.