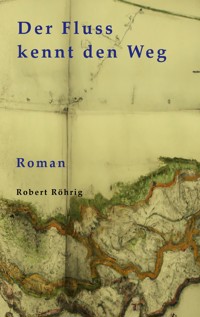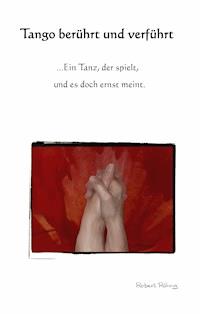
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch will kein weiteres Tangolehrbuch oder Geschichtsbuch sein, sondern eine Bilanz der Erfahrungen mit dem argentinischen Tango und dem damit verbundenen Erleben. Es will Antworten auf die Frage geben, wie sich die Leidenschaft im Tanz und die komplexen Bewegungsabläufe vereinbaren und lernen lassen. Es geht um Verständnis für die Grundlagen dieser besonderen Körpersprache, der Synchronisation innerhalb des Tanzpaares und dem Treiben auf einer typischen Tanzveranstaltung, einer Milonga. Es geht darum, Zugang zur besonderen Subkultur des Tango argentino zu finden, ohne dabei Tanzfiguren zu lehren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tango ist unbeschreiblich.
Unbeschreiblich anrührend und unbeschreiblich widersprüchlich.
In den Liedtexten fliegen dem Zuhörer die Worte „Corazon“ und „Alma“ regelrecht um die Ohren. Der Tango nimmt also für sich in Anspruch, Herz und Seele anzusprechen.
Vorgestellt wird er in der Regel unter dem zweiten Namen „Leidenschaft“ und „Hingabe“, und dann beginnt ein Paar zu tanzen. Es sieht meist elegant aus, aber die erwartete erotische Leidenschaft bleibt unsichtbar, weil man vielleicht auf die Inszenierung eines erotischen Aktes zwischen zwei Menschen wartet.
Man beginnt zu verstehen, dass weniger die Leidenschaft und Hingabe zwischen den Tänzern gemeint ist, sondern die gemeinsame Leidenschaft und Hingabe für diesen Tanz.
Die Improvisation der Bewegung und die Kommunikation mit der Musik ist das, was gezeigt werden kann. Der intime Teil der Erotik bleibt dabei für den Zuschauer im Nebel der Phantasie.
Inhalt
Motivation, Entrada
Das Wesen des Tangos
Das Tanzpaar
Mann und Frau
Musiker, Mittänzer und andere Begleiter des Paares
Milonga: Inszenierung, Verheißung und Realität
Sprache und Körpersprache
Aneignung des Tangos, verkörperlichte Erinnerung
Spiel der Augenblicke oder förmlicher Antrag
Bindung und Verbindung
Musik und Bewegung
Tanzstil
Rückwärts vorwärts gehen
Freiheit, Macht, Narzissmus, Ideal und Enttäuschung
Tangotherapie, Achtsamkeit und Selbstreflexion
Eine kleine Entwicklungsgeschichte des Tangos
Zeit und Entwicklung
Ausklang, Salida
Literatur
Für Gabi
Entdecken heißt sehen, was jeder gesehen hat,
und dabei denken, was niemand gedacht hat.
(Albert von Szent-Györgyi)
Motivation, Entrada
Wie kann ich Menschen dazu verführen, sich an die folgenden Zeilen heranzuwagen und sich auf einen inneren Dialog mit sich selbst und dem Tango einzulassen? Vielleicht ist es gar nicht so schwer, denn diese Seite hätte niemand aufgeschlagen, der sich nicht für Tango interessiert, und beiseite legen würde sie nur jemand, der schon alles über den Tango weiß.
Es gibt viele gute Bücher über den Tango, und ich habe mich ausgiebig damit beschäftigt. Ich habe mir vieles dabei zu eigen gemacht, von dem ich nicht mehr unterscheiden kann, ob es jemand anderes schon gedacht hat, oder ob es mein eigener Gedanke ist.
Jedes Werk ist für sich eine Bereicherung und muss gleichzeitig unvollständig bleiben. Wer kann denn den Tango vollständig beschreiben? Das entspricht dem bisher nicht gelungenen Versuch, die Liebe mit Worten einzufangen.
Das Büchlein ist relativ schmal geblieben, weil ich gar nicht erst den Versuch machem wollte, ein umfassendes Werk zu verfassen. Ich möchte bei dem bleiben, was mir im Laufe der letzten zwölf Jahre als Tangoschüler und Tänzer begegnet ist und was mich beschäftigt hat. Ich will kein Lehrer sein, und doch habe ich das Gefühl, das mir Beobachtungen und Wahrnehmungen zugefallen sind, über die es sich zu schreiben lohnt. Ich habe mich deshalb für eine ganz subjektive Betrachtung entschieden, nachdem ich mit meiner Frau erst jenseits der 50 begonnen habe Tango zu tanzen.
Vielleicht eröffnet die Jahrzehnte dauernde Tätigkeit im ärztlich-psychotherapeutischen Bereich die eine oder andere ungewohnte, aber lohnende Sichtweise. Natürlich geht es mir wie vielen Tangotänzern so, dass sich im Laufe der Jahre ein gewisses Sendungsbewusstsein aus der Begeisterung für diesen Tanz entwickelt hat, und ich hoffe, dass keine moralisierende Haltung daraus geworden ist. Auf jeden Fall möchte ich vermeiden, im Klischee zu landen, sondern dort einen kurzen Besuch zu machen, wo der Tango wirklich wohnt.
Also: Wenig verzettelnde Fakten, wenig Zahlen, möglichst wenig „Lehre“. Möglichst wenig Ausflüge in Welten jenseits des Tangos, aber doch so viel, dass eine nachvollziehbare Geschichte entsteht. Subjektive Wahrnehmung, Verzicht auf wissenschaftliche Beweisführung unter gleichzeitiger Anerkennung der existierenden Literatur über Natur und Geschichte des Tangos, auch mal eine eigene Theorie, Erfahrung, Gedankenspiele, Hinweise und Anregung zum Weiterdenken, und auch manche Umwege, die für mein Gefühl eine enge Beziehung zur Kultur des Tangos haben.
Auch wenn vieles davon schon längst gedacht und aufgeschrieben ist. Ich wollte ein kleines Bekenntnis zum argentinischen Tango ablegen, auch wenn es manchmal gar nicht so klingen mag, weil Tango im Gegensatz zum Klischee nicht ohne Frust denkbar ist.
Der Tango steht für alle nur denkbaren intensiven Gefühle, nicht nur für die erotische Leidenschaft. Mit dieser Leidenschaft ist vermutlich sowieso nicht die Leidenschaft der Tanzpartner füreinander, sondern die Leidenschaft beider Tanzpartner für den Tango als Erlebniswelt gemeint.
Ich möchte versuchen, den Tango zu finden, indem ich die Themen umkreise, wo sich vermutlich all die beteiligten Menschen und archaisch-mythischen Phantasien tummeln. Die Seele hat keinen festen Ort und keine feste Gestalt, auch die des Tangos nicht. Sie wird aber spürbar im Moment einer „Bewegung“, die wiederum emotionale und körperliche Bewegung erzeugt. Sie ist nicht mehr spürbar, wenn die „Bewegung“ aufhört, d.h. wir müssen uns bewegen, damit wir bewegt werden.
Die Seele wird beim Tanz lebendig. Man erkennt vielleicht die Fassade des Tangos an einer charakteristischen Pose, aber die Pose wird zur Posse, bleibt kalt, eingefroren und manchmal komisch, wenn sie für sich alleine steht, wenn die Bewegung fehlt.
Das Gefühl „Tango“ wird nur spürbar, wenn ein bestimmtes Bewegungsmuster das Innere so berührt, dass archaische Emotionen auftauchen und uns einnehmen können. Deshalb ist der Tango auch nicht greifbar und erklärbar.
Er entsteht, ist im nächsten Moment Vergangenheit, und muss durch neue Bewegung wiederbelebt werden. In der Zwischenzeit weht er uns nur als Sehnsucht und blasse Erinnerung an, die uns wieder auf die Tanzfläche treibt, weil wir wieder bewegt werden wollen.
Vieles lässt sich in Bildern und Sprüchen ausdrücken, die uns spontan vermitteln: Ja, so könnte es sein.
In Gedanken an den Tango wurden viele Sprüche geboren, oft von angesehenen Tänzern oder Schriftstellern. Da ich selbst eine große Nähe zwischen Tango und einigen zentralen Lebensthemen spüre, ist mir ein Zitat aus einem Tangolied besonders einprägsam: „La vida es una milonga, y hay que saberla bailar“. Frei übersetzt so viel wie: Das Leben ist eine Tango-Tanzveranstaltung. Es ist gut, dort tanzen zu können.
Ist ein Tango nun eine künstliche (erotische) Inszenierung und ein Theater, das von der Wirklichkeit des Lebens so weit entfernt ist, dass man es nicht mehr ernst nehmen kann? Oder ist er vielleicht das genaue Gegenteil? Auf jeden Fall ist der Tango ein Gaukler, der das reale Leben so auf seiner eigenen Bühne inszeniert, so dass es möglicherweise besser und treffender zu erkennen ist, als wenn wir es im Ernst versuchen.
Aus der Kunst kennen wir die Vorstellung, dass in der symbolischen Verdichtung einer Realität mehr Wahrheit verdichtet sein kann, als in dieser Realität selbst sichtbar wird. Die Welt des Tangos erscheint oft auf ein erotisches Theater reduziert, welches der Tango eigentlich nicht ist.
Die demonstrierte Erotik findet meist nur in der Phantasie der Zuschauer statt, weil die Tänzer selbst viel zu konzentriert mit den komplizierten Bewegungsabläufen beschäftigt sind.
Die empfundene Erotik scheint für die Tänzer meist weniger sexueller Natur zu sein, sondern in der Befriedigung zu bestehen, mit dem Tanzpartner einfach einen guten Tanz improvisiert zu haben. Erotisch wird der Tanz erst, wenn die Zuschauer dies nicht mehr plakativ geliefert bekommen, wenn die äußere Bewegung zurückgenommen wird und dafür die innere Spannung steigt. Es gibt die Befriedigung, gut getanzt zu haben, und die stellt sich vor allem dann ein, wenn man von anderen Tänzern als guter Tänzer wahrgenommen wird. Der wirklich gute Tango ist der, der sich gut anfühlt, den aber außer dem Partner kein Mensch gesehen hat.
Tango bedeutet möglicherweise in seinem ursprünglichen Sinn: Wir finden zusammen und berühren uns. Vermutlich ein Wortstamm aus dem Afrikanischen oder der Karibik. Wir sagen ja auch, dass uns etwas „tangiert“. Alle anderen Worterklärungen geben letztlich eine ähnliche Bedeutung wider. Der Tango als Ereignis trifft die menschlichen und sozialen Bemühungen um Berührung und Überwindung von Einsamkeit, aber auch der damit verbundenen Täuschungen und Inszenierungen. Er bleibt nicht in der viel zitierten Melancholie stecken, sondern versucht, diese im Tanz zu überwinden.
Die Tangowelt ist eine Kulturwelt und eine Spielewelt und eine Welt der Wahrheit. Das kulturelle Schema wird uns als Regelwerk und Mythos historisch und aktuell von einer großen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Vielleicht können wir es nutzen. Eine Tanzlehrerin hat einen beliebten Spruch über den Wein abgewandelt und zum Motto ihrer Tanzschule gemacht: In Tango veritas. Ich glaube so ist es.
Viel Vergnügen dabei, es herauszufinden!
Im Ursprung erscheint der Tango triebhaft,
in seinem Kern aber ist er spirituell.
(Eigentlich müsste das schon jemand so gesagt
haben, aber ich weiß nicht wer.)
Das Wesen des Tangos
Wie sich ein Mensch oder auch ein Gegenstand gefühlsmäßig einordnet, ist oft schon am zugehörigen Geschlechtsartikel zu erkennen. Der Tango ist männlichen Geschlechts, obwohl Frauen oft viel begeistertere Tänzerinnen sind.
Der Tanz als Werbungsritual ist einerseits biologisch eine männliche Angelegenheit, und natürlich der Kriegstanz, während der Tempeltanz jedenfalls in unserer Vorstellung eher eine weibliche Aufgabe ist. Männer und Frauen tanzen, aber jeder auf seine Weise. Für die Anfänge des Tangos sind die traditionellen Rollenzuschreibungen gut nachvollziehbar, aber sie sind in Auflösung begriffen. Sowohl Männer als auch Frauen scheinen heute mit einer inneren Haltung auf die Tanzfläche zu gehen, die für alle gleichzeitig Elemente von Werbungstanz, Kriegstanz und Tempeltanz beinhaltet.
Tango ist aber nicht nur ein Tanz, sondern auch ein weltanschauliches, kulturell ausgeformtes System in ständigem Konflikt zwischen Bewahrung von Tradition und Entwicklung. Das System ist einerseits geschlossen, weil die Erfahrung des Tangos nur „Eingeweihten“ möglich ist, die schon einmal von der Seele des Tangos berührt wurden. Andererseits ist diese Welt offen für Zuschreibungen von außen, mehr oder weniger dem Missbrauch durch Kommerzialisierung und Folklore ausgeliefert. Eine prekäre Identitätsfrage.
Der Tango ist eine Art schillernder Harlekin, der uns vieles vorgaukelt und dabei gleichzeitig eine tiefe Wahrheit transportiert. Er scheint ein Gesicht und eine Gestalt zu haben, auch wenn wir beides nicht konkret vor Augen haben. Vielleicht versteckt sich dahinter das eigene Ideal, das man in diesem Tanz anzutreffen hofft. Auch für die meisten Frauen scheint der Tango männlichen Geschlechts zu sein, während er für die Männer eine wenig beachtete weibliche Seite hat: Die Tänzerin ist im Geheimen möglicherweise eine Art Tempeltänzerin, die Vertretung einer Göttin auf Erden.
Viele Menschen beschäftigen sich mit dem Tango und schreiben wissenschaftliche Abhandlungen über seine Geschichte und zwischenmenschliche Bedeutung. Romanautoren benutzen ihn, um in ihren Büchern Spannung aufzubauen und Leser anzulocken. Filme werden mit ihm aufgepeppt, die Schauspieler müssen Tangounterricht nehmen, um leidlich glaubhaft zu wirken, und kaum eine Filmmusik verzichtet darauf, ein paar Takte Tango in ihre Soundkulisse einzumischen.
Im Internet beschreiben Hunderte von Homepages, was Tango ist und werben für Tanzschulen. Hört man sich im Bekanntenkreis um, gibt es überraschend viele Mitmenschen, die schon Kurse besucht haben. Und kaum eine Frau, die nicht heimlich davon träumt, in den Armen eines guten Tangotänzers zu liegen. Die Sachbücher und DVDs mit Filmen zum Thema Tango füllen Regale.
Das Wesen des Tangos ist unendlich schwer zu beschreiben, denn jeder scheint eine andere Facette zu erkennen. Letztlich muss man ihn spüren, weil die Worte nicht ausreichen. Der Annäherungsprozess verläuft meist in mehreren Stufen: Am Anfang stehen wilde Phantasien, die sich aus den populären existierenden Bildern zusammensetzen und ein Vorurteil prägen, welches schon festlegt, ob Neugier oder Abneigung überwiegen werden. Es gilt also, zunächst einmal eine Tangoschule oder gleich eine Tanzveranstaltung zu besuchen. Dies erzeugt in der Regel eine erste Gefühlswallung: Man spürt etwas Besonderes, das sofort verzaubert. Die Menschen bewegen sich auf eine magische Weise in Verbindung mit einer Musik, die (wenn die richtigen Stücke aufgelegt sind) den ganzen Organismus ergreift. Man will dazugehören, hätte aber nie den Mut, sich dieser Probe sofort zu stellen.
Dann folgt die Phase des Unterrichts, die sich als abwechselnde Wellen von Euphorie, Suchtverhalten und Verzweiflung über die eigene Unfähigkeit entwickelt, und erst nach mehreren Jahren das Gefühl entstehen lässt, die Seele dieses Tanzes erkennen zu können. Nach einigen weiteren Jahren wird daraus häufig ein Sendungsbewusstsein. Oft in der Hoffnung, wenigstens einen Teil der Existenz mit dem Tango zu verbinden und zu unterrichten. Möglicherweise ist man erst dann so weit, dass die Bilder, Gedanken und Emotionen sich im eigenen Körper zuhause fühlen.
In der Regel geht es dabei neben dem Kontakt zu sich selbst eher um die Kommunikation und ein gemeinsames, mit anderen geteiltes Gefühl. Tango ist auch der Mut, das eigene Selbst zu erweitern: Sei jemand, der in die Fremde geht und sich dort nicht selbst begegnen will (H:C: Artmann, zitiert von André Heller). Auch wenn die Begegnung mit dir selbst unvermeidlich ist.
Der Tango ist ein dialogischer Tanz, während andere Gesellschaftstänze Synchrontänze sind. Es gibt natürlich bei allen Paartänzen eine Führung, die sich allerdings auf die korrekte Ausführung einer vorgegebenen „Gestalt“ bezieht. Der Führende führt einen Bewegungsablauf, der „richtig“ ist und so vom Partner erwartet wird, weil es abgesprochen wurde. Die Führung bestimmt bei den klassischen Tänzen sowohl die richtige Richtung als auch den Ablauf der Koordination einer Bewegungssequenz. Der beobachtende Tanzlehrer oder Preisrichter wertet aus, wie nahe der Bewegungsablauf am vorgegebenen Bild des jeweiligen Tanzes abläuft, wobei natürlich auch Bewertungen des emotionalen Einsatzes die Gesamtnote bestimmen.
Der Tango ist deshalb anders, weil er ein anderes Ziel hat. Man erkennt ihn daran, dass die Tanzenden sich gerade eben nicht synchron bewegen. Dort, wo sie es zu tun scheinen, ist nur die Differenz zwischen Anrede und Antwort des Folgenden besonders kurz, so dass es aussieht, als wäre man synchron, weil man ja trotz aller internen Verschiebungen oft gleichzeitig den Takt trifft.
Die Frau, die der Führende nach einem Schritt oder einer Figur in der kurzen Pause vor der nächsten Aktion vor sich hat, ist oft nicht die, die er sich zu Beginn dieser Bewegung gewünscht hat. Sie steht möglicherweise völlig anders als vom Führenden beabsichtigt. Wer sich darauf einstellen kann und dies sogar als Herausforderung betrachten kann, wird diesen „Vorschlag“ für einen Neuanfang von einem anderen Standpunkt aus aufregend finden und neugierig damit umgehen.
Wer aber darauf angewiesen ist, dass ein Ereignis immer die Folge einer Ursache sein muss, kann wohl allein aus diesem Grund wenig mit dem Tango anfangen. Deshalb finden den Tango besonders viele Menschen attraktiv, die auch sonst im sozialen Bereich tätig sind, oder solche, die sich entsprechende Fähigkeiten bewahrt haben, auch wenn sie im Alltag etwas ganz anderes tun.
Getanzt wird der Tango entweder auf der Bühne, als ausschließliche Inszenierung für ein genießendes Publikum oder innerhalb seiner eigenen, relativ geschlossenen Kultur. Die Bühne für den Szenetänzer ist die sog. Milonga, eine Tanzveranstaltung ausschließlich für Tangotänzer. Getanzt wird dort nicht nur der uns vertraute Tango, sondern auch ein Tanz, der ebenfalls Milonga genannt wird und der Vals, ein Walzer im Tangostil. Nur Tango allein ist selbst den Tangueros zu langweilig. Das, was wir unter Tangokultur verstehen, ist die Gesamtheit von Tanz, Musik und Texten.
Menschen, die entweder Tango lernen oder z.B. eine Selbsterfahrung aufsuchen, starten in der Regel von ähnlichen Ausgangsbedingungen. Es sind gewissermaßen vergleichbare Gruppen: Sie befinden sich in einer Krise, verbinden Hoffnungen mit der Lebenswelt des Tangos, und fangen in der Regel ohne Vorwissen über den zu erwartenden Prozess an. Und sie kommen meist nicht wegen der angepriesenen erotischen Möglichkeiten.
Der Tango wird in der Regel zu einem Massenphänomen, wenn auch die Gesellschaften in Krisen sind. Er ist im Grunde seiner Seele subversiv-rebellisch. Obwohl er seine eigenen Gesetze hat, akzeptiert er niemals eine diktatorische Vorgabe von außen. Ein Kampf gegen Unterdrückung jeglicher Art. Vermutlich war die Entstehung des Tangos in Buenos Aires zwar einerseits ein Instrument der Kontaktaufnahme in den Bordellen, aber andererseits mindestens so sehr eine Abgrenzung und ein Aufbegehren gegen gesellschaftliche Entwertung und Ausgrenzung. Gewissermaßen ein erotisierter Überlebenskampf.
Der Tango ist die Adresse, unter der die ihm zugeschriebenen, ansonsten fast unbeschreiblichen Emotionen wohnen. Wenn wir über diese Gefühle sprechen wollen, verweisen wir auf die Adresse, und fast jedermann weiß intuitiv, wovon wir sprechen. Das Zauberwort Tango öffnet wie das „Sesam öffne Dich“ einen geheimen Ort im Inneren und wir können emotional eintreten.
Was wir dort treffen, können wir lieben, aber auch verabscheuen, verachten und verleugnen. Oder wir können so tun, als ob es uns nichts angeht und nichts in uns zum Klingen bringt. Dann verhallt es, und du weißt nicht, was du hättest wahrnehmen können.
Der Tango wabert wie Nebelschwaden durch Literatur, Filme und Gehirne und bringt in den Menschen bestimmte Saiten zum Klingen. Und zwar die Saiten, die für dunkle erotische, dominante, schweißgeschwängerte und überschwemmende, triebhafte Emotionen bestimmt sind. Er macht damit die inneren Orte spürbar, wo diese Gefühle beheimatet sind und hinterlässt seine Spur, welche den Duft dieser Gefühle intensiviert. Tritt er erneut in Erscheinung, öffnet er wie ein Code diese ansonsten nicht benennbaren triebhaften Emotionen und das Hören von Musik und das Betrachten tanzender Paare kann Schauer über den Körper jagen und Tränen der Rührung erzeugen.
Im Streit darüber, wo der Tango seine Heimat hat, möchte ich im Grunde den Argentiniern zustimmen. Sie haben ihn sich am meisten verdient, den Boden und das Klima zur Verfügung gestellt, in welchem der Tango gedeihen konnte. Andererseits gibt es wohl auch keine Frage, dass der Tango an diesem Ort nicht hätte entstehen können, wenn die europäischen Einwanderer nicht ihre Kultur zur Verfügung gestellt hätten.
Der Tango ist zwar ein Tanz, aber in erster Linie ein Prozess. Der Moment des Tangogefühls ist ein einmaliger, nicht wiederholbarer Schöpfungsakt, ähnlich wie der berühmte Aha-Moment der Kommunikation und verdient den einen oder anderen Ausflug in Philosophie und Religion, um diesen Moment besser fassen zu können. Er hat wie gesagt Tradition, befindet sich aber dennoch in ständiger Bewegung, sonst könnte er uns nicht mehr bewegen.
Und: Der Tango tritt in unterschiedlicher Verkleidung auf. Es gibt den Tango für das Paar, den für die Milonga, den für die Bühne und den für die Tanzlehrer am Ende eines Workshops. Dieser Tango ist allein an die Schüler und an das Selbstverständnis der Lehrer gerichtet. Er stellt die tänzerische Weltordnung her, indem er den Schülern einerseits demonstriert, wie leicht und elegant es doch möglich ist, das zu tun, mit dem sie sich gerade selbstzweiflerisch herumgequält haben. Die eine oder andere Extrafigur zeigt auf, dass sich der weitere Unterricht lohnt. Der eine Teil der Schüler staunt, der andere Teil filmt, in der Hoffnung, auf diese Weise etwas mit nach Hause zu nehmen.
Aber woran erkennt man einen Tango? Es gibt ja dieses Gefühl: Ich schaue nur eine Sekunde hin und weiß: Das ist Tango.
Dieser Tanz muss einige Merkmale haben, die sein Bewegungsbild ausmachen. So wie wir einen guten Bekannten allein anhand seines Bewegungsmusters manchmal auf Hunderte Meter Entfernung erkennen.
Wir werden im Weiteren auf die Einzelheiten zurückkommen, ich möchte aber eine Hypothese an den Anfang stellen, wie man Tango so beschreiben kann, dass wirklich nur die Punkte übrig bleiben, die eine Art Alleinstellungsmerkmal darstellen.
Tango ist die Kombination aus einem spezifischen Bewegungsmuster und der empfundenen Zugehörigkeit zu einer spezifischen sozialen Gruppierung, wobei diese Zugehörigkeit durch Können im Tanz und durch Akzeptanz der spezifischen Regeln erworben wird.
Die Körper signalisieren dieses spezifische Bewegungsmuster durch mehrere unverkennbare Besonderheiten:
Gemeinsame Improvisation des gesamten Bewegungsablaufs mit durch die Musik vorgegebenem Wechsel von Bewegungssequenzen und meditativen Pausen und/oder expressiven Posen.
Die asynchrone Führung des Tangos mit einer zeitversetzen Antwort auf den Führungsimpuls, wodurch diese Antwort zur Vorgabe für den nächsten Führungsimpuls wird (der verkörperlichte Dialog).
Das Eindringen der Tänzer in den physischen Raum des Partners (Louis Borges). Verbunden mit der Einladung an den Partner, dies ebenfalls zu tun.
Den gezielten Einsatz von Beschleunigung und Verlangsamung der gemeinsamen Bewegung, ohne dabei den Grundrhythmus der Musik zu verlieren.
Jenseits der sichtbaren Bewegungsmuster existiert ein Muster innerer Haltungen und emotionaler Zugehörigkeiten.
Die stufenlose Duchgängigkeit der Inszenierung zwischen purer Erotik, sozialer Beziehungsdynamik und Regression auf frühe Bindungsqualitäten bis hin zu Erlebnisformen, die religiösen Empfindungen nahe stehen.
Die Einbindung des Tanzes in ein eigenes kulturelles Subsystem mit dazu gehörigem Schöpfungsmythos.
Niemand hätte jemals den Ozean überquert,
wenn er bei Sturm
die Möglichkeit gehabt hätte,
das Schiff zu verlassen.
(Charles F. Kettering)
Das Tanzpaar
Das Paar im Tango ist in dem Moment ein Paar, wo die Umarmung vollständig ist, und es hört auf, ein Paar zu sein, wenn diese Umarmung endet oder unterbrochen wird. Was dazwischen liegt, ist letztlich ein Schöpfungsakt mit Hilfe von Beziehungsarbeit.
Diese Beziehung ist in der Regel eben auch mit dem Ende des Tanzes beendet und macht einer Mischung peinlicher Erinnerung an die erlebte Nähe zu einem möglicherweise fremden Menschen Platz, was dazu führt, sich wiederum im sonstigen öffentlichen Leben kaum noch zu kennen.