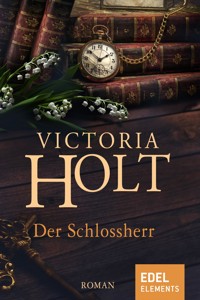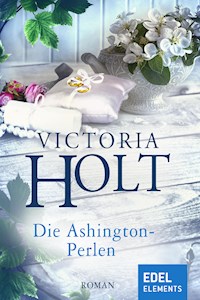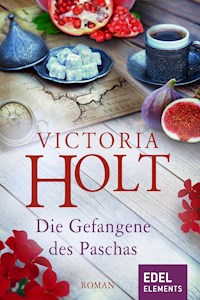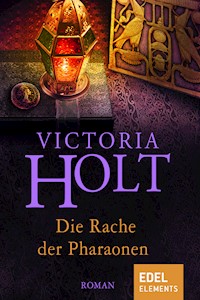4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon immer wollte Suewellyn das Schloss in England sehen, auf dem ihr Vater einst gelebt hatte. Als ein Vulkanausbruch auf der australischen Insel, die ihren Eltern zur zweiten Heimat geworden war, Suewellyns Leben mit einem Schlag verändert, rückt der Besitz des Schlosses in greifbare Nähe. Doch in England wartet auch eine Bluttat aus der Vergangenheit auf ihre Sühne ... Ein spannender Roman menschlicher Irrungen – und die Geschichte eines unseligen Erbes und der alles überwindenden Kraft der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Victoria Holt
Tanz der Masken
Roman
Ins Deutsche übertragen von Margarete Längsfeld
Edel eBooks
Drei Wünsche im Zauberwald
Ich sitze in der Falle. Ich bin in einem Netz gefangen, und es ist nur ein kleiner Trost, daß ich das Netz selbst gesponnen habe. Der Gedanke an die Tragweite dessen, was ich getan habe, erfüllt mich mit lähmender Angst. Ich habe niederträchtig, vielleicht sogar verbrecherisch gehandelt; jeden Morgen, wenn ich aufwache, schwebt eine drohende Wolke über mir, und ich frage mich, welch neues Mißgeschick dieser Tag für mich bereithält. Wie oft habe ich gewünscht, ich hätte nie von Susannah, Esmond und den anderen gehört – besonders aber von Susannah. Ich wünsche, ich hätte nie einen Blick auf Mateland geworfen, dieses stattliche, ehrwürdige Schloß, das mit seinem mächtigen Pförtnerhaus, seinen grauen Mauern und Zinnen wie der Schauplatz eines Ritterromans aus dem Mittelalter wirkte. Dann wäre ich nie in Versuchung geraten.
Am Anfang sah alles so einfach aus, und ich war so verzweifelt. »Dieser alte Teufel packt dich am Ellbogen und verführt dich«, hätte meine alte Freundin Cougaba auf der Vulkaninsel gesagt. Es stimmte. Der Satan hatte mich verführt, und ich war der Versuchung erlegen. Deshalb befinde ich mich hier auf Schloß Mateland und suche, gefangen und verzweifelt nach einem Ausweg aus einer Lage, die mit jedem Tag bedrohlicher wird.
Die Anfänge liegen weit zurück – eigentlich begann alles schon vor meiner Geburt. Es ist die Geschichte meines Vaters und meiner Mutter; es ist die Geschichte Susannahs – und natürlich auch meine. Doch als mir zum erstenmal bewußt wurde, daß es mit mir eine besondere Bewandtnis hatte, war ich gerade erst sechs Jahre alt.
Ich verbrachte die frühen Jahre meiner Kindheit in der Holzapfelhütte am Dorfanger von Cherrington. Der Anger lag im Schatten der Kirche. In seiner Mitte befand sich ein Weiher. An schönen Tagen ließen sich dort die alten Männer auf der Holzbank nieder und verplauderten den Vormittag. Auch ein Maibaum stand auf dem Anger, und am ersten Mai wählten die Dorfbewohner eine Königin. Ich beobachtete die Feierlichkeiten durch die Ritzen der Jalousien vor dem Fenster der guten Stube, sofern es mir gelang, den wachsamen Augen Tante Amelias zu entkommen.
Tante Amelia und Onkel William waren sehr fromm und meinten, der Maibaum sollte entfernt werden und mit diesen heidnischen Bräuchen müsse Schluß sein; doch glücklicherweise waren wir anderen nicht dieser Ansicht.
Wie gerne wäre ich dort draußen gewesen. Ich sehnte mich danach, das junge Grün aus den Wäldern zu holen, eines der Bänder zu ergreifen und mit den ausgelassen Feiernden um den Maibaum zu tanzen. Ich hielt es für den Gipfel der Glückseligkeit, zur Maikönigin gewählt zu werden. Doch für diese Ehre mußte man wenigstens sechzehn Jahre alt sein, und ich war damals noch nicht einmal sechs.
Ich hätte mein seltsames Leben vermutlich noch eine ganze Weile so hingenommen, wären da nicht all diese Winke und Andeutungen gewesen. Einmal hörte ich Tante Amelia sagen: »Ich weiß nicht, ob wir auch das Richtige getan haben, William. Miss Anabel hat mich gebeten, und ich gab einfach nach.«
»Denk doch auch an das Geld«, mahnte Onkel William.
»Aber es bedeutet doch, daß wir eine Sünde billigen.«
Onkel William versicherte ihr, daß niemand behaupten könne, sie hätten gesündigt.
»Wir haben einer Sünderin vergeben, William«, beharrte sie.
William erwiderte, sie hätten keine Schuld auf sich geladen. Sie hätten nur getan, wofür sie bezahlt würden, und womöglich könnten sie damit der Hölle eine Seele entreißen.
»Die Sünden der Väter werden den Kindern vergolten«, erinnerte ihn Tante Amelia.
Er nickte nur und ging hinaus zum Holzschuppen, wo er eine Weihnachtskrippe für die Kirche schnitzte.
Mir wurde allmählich klar, daß Onkel William nicht so ausschließlich danach strebte, gut zu sein, wie Tante Amelia. Er lächelte hin und wieder – zwar ein verschämtes Lächeln, aber es deutete sich doch zuweilen an; und als er mich einmal während der Festlichkeiten am ersten Mai durch die Jalousien spähen sah, ging er ohne etwas zu sagen aus dem Zimmer.
Gewiß, ich schreibe dies erst nach Jahren auf, doch ich glaube mich zu erinnern, daß ich sehr bald merkte, daß in Cherrington gewisse Mutmaßungen über mich geäußert wurden. Onkel William und Tante Amelia waren ein für die Betreuung eines Kindes ungeeignetes Paar.
Matty Grey, die eine der Hütten am Anger bewohnte und an Sommertagen vor ihrer Tür zu sitzen pflegte, galt im Dorf als eine Art Original. Ich plauderte gern mit Matty, wann immer es mir möglich war. Das wußte sie, und wenn ich in ihre Nähe kam, stieß sie seltsame schnaufende Laute aus, und ihr fetter Körper zitterte, was ihre Art zu lachen war. Dann rief sie mich zu sich und lud mich ein, mich zu ihren Füßen niederzusetzen. Sie nannte mich »armes kleines Würmchen« und befahl ihrem Enkel Tom, ja nett zur kleinen Suewellyn zu sein.
Mein Name gefiel mir recht gut. Er war von Susan Ellen abgeleitet. Ich glaube, das »w« hatte man dazwischengeschoben, um die zwei nebeneinanderstehenden »e« zu trennen. Ich fand den Namen hübsch. Ausgefallen. In unserem Dorf gab es eine Menge Ellens und eine Susan, die Sue gerufen wurde. Aber Suewellyn war einmalig.
Tom gehorchte seiner Großmutter. Er sorgte dafür, daß die anderen Kinder aufhörten, mich zu hänseln, weil ich anders war. Ich besuchte die private Elementarschule, deren Vorsteherin eine ehemalige Gouvernante vom Gutshaus war. Sie hatte die Tochter des Gutsherrn unterrichtet. Als die junge Dame ihre Dienste nicht mehr benötigte, hatte sie ein kleines Haus unweit der Kirche bezogen und eine Schule eröffnet, in welche nun die Dorfkinder gingen. Unter ihnen war auch Anthony, der Sohn der Tochter des Gutsherrn. Nach einem Jahr würde er einen Hauslehrer bekommen, und später würde er ins Internat gehen. Es war schon eine buntgemischte Gesellschaft, die sich da in Miss Brents Stube versammelte und mit Holzstäbchen Buchstaben in mit Sand gefüllte flache Kästen kritzelte und das Einmaleins herunterleierte. Wir waren zwanzig, im Alter von fünf bis elf, aus allen Volksschichten; für manche war die Ausbildung mit elf Jahren zu Ende, andere würden sie fortsetzen. Außer dem Erben des Gutsherrn waren da noch die Töchter des Arztes und die drei Kinder eines ortsansässigen Bauern sowie all diejenigen, die so waren wie Tom Grey. Unter ihnen war ich das einzige Kind, das ungewöhnlich war.
Mit mir hatte es nämlich etwas Geheimnisvolles auf sich. Ich war bereits geboren, ehe ich eines Tages im Dorf auftauchte. Die Ankunft der meisten Kinder war sonst ein vielbesprochenes Ereignis, bevor der Neuankömmling wirklich in Erscheinung trat. Mit mir war das anders. Ich lebte bei einem Ehepaar, das für die Betreuung eines Kindes höchst ungeeignet war. Ich war immer gut angezogen und trug zuweilen Kleider, die weit kostspieliger waren, als es der Stand meiner Pflegeeltern erlaubt hätte.
Dann waren da die Besuche. Einmal im Monat kam sie.
Sie war schön. Sie fuhr in der Bahnhofsdroschke vor der Hütte vor, und ich wurde zu ihr in die gute Stube geschickt. Ich wußte, daß es ein bedeutendes Ereignis war. Denn die gute Stube wurde nur zu besonderen Gelegenheiten benutzt etwa wenn der Pfarrer zu Besuch kam. Die Jalousien waren stets heruntergelassen, aus Furcht, die Sonne könnte den Teppich ausbleichen oder den Möbeln schaden. Hier herrschte eine heilige Atmosphäre. Vielleicht lag es an dem Bild von Christus am Kreuz oder an dem Heiligen – ich glaube, es war Sankt Stephan –, in dem lauter Pfeile steckten und aus dessen Wunden Blut tropfte; gleich daneben hing ein Jugendbildnis unserer Königin, die sehr streng, hochmütig und mißbilligend dreinschaute. Das Zimmer wirkte bedrückend auf mich, und nur bei verführerischen Ereignissen, wie es die Festlichkeiten am ersten Mai wären, traute ich mich hinein, um durch die Ritzen auf das übermütige Treiben auf dem Anger zu spähen.
Doch wenn sie da war, war das Zimmer wie verwandelt Sie hatte prachtvolle Kleider. Sie trug stets mit Rüschen und Bändern besetzte Blusen, lange Glockenröcke und kleine, mit Federn und Schleifen verzierte Hüte.
Sie sagte jedesmal: »Hallo, Suewellyn!«, so, als sei sie mir gegenüber ein wenig schüchtern. Dann lief ich auf sie zu und ergriff ihre ausgestreckte Hand. Sie hob mich hoch und musterte mich so eindringlich, daß ich mich ängstlich fragte, ob mein Scheitel gerade war und ob ich nicht vergessen hatte, mich hinter den Ohren zu waschen.
Wir setzten uns nebeneinander auf das Sofa. Eigentlich haßte ich dieses Sofa. Es war aus Roßhaar und pikte sogar durch meine Strümpfe hindurch an den Beinen; doch wenn sie da war, merkte ich nichts davon. Sie stellte mir eine Menge Fragen, die alle mich betrafen. Was aß ich gern? War mir im Winter kalt? Wie ging es mir in der Schule? Waren alle nett zu mir? Als ich lesen lernte, wünschte sie, daß ich ihr zeigte, wie gut ich es beherrschte. Sie drückte mich an sich, und wenn die Droschke wieder vorfuhr, um sie zum Bahnhof zu bringen, umarmte sie mich und machte ein Gesicht als würde sie gleich weinen.
Das war alles sehr schmeichelhaft. Denn wenn sie sich auch eine Weile mit Tante Amelia unterhielt und ich unterdessen aus der guten Stube geschickt wurde, schien es doch, als ob ihre Besuche vornehmlich mir galten.
Wenn sie fort war, kam es mir vor, als habe sich im Haus etwas verändert Onkel William sah aus, als strenge er sich mächtig an, damit seine Miene sich zu einem Lächeln verzog, und Tante Amelia ging umher und murmelte vor sich hin: »Ich weiß nicht, ich weiß nicht.«
Natürlich wurden die Besuche im Dorf bemerkt. James, der Droschkenkutscher, und der Stationsvorsteher flüsterten über sie. Später wurde mir klar, daß sie ihre eigenen Schlüsse aus der eigentlich gar nicht so geheimnisvollen Angelegenheit zogen, und ich bezweifle nicht, daß ich schon viel früher davon erfahren hätte, wenn Matty Grey ihrem Enkel nicht eingeschärft hätte, sich meiner anzunehmen. Tom hatte klar zu verstehen gegeben, daß ich mich unter seinem Schutz befand und daß jeder, der mich beleidigte, es mit ihm zu tun bekäme. Ich liebte Tom, obgleich er sich nie herabließ, viele Worte mit mir zu wechseln. Doch für mich war er mein Beschützer, mein Ritter in schimmernder Rüstung, mein Lohengrin.
Aber selbst Tom konnte nicht verhindern, daß die Kinder die Köpfe zusammensteckten und über mich tuschelten, und eines Tages bemerkte Anthony den Leberfleck rechts an meinem Kinn, unmittelbar unter meinem Mund.
»Seht mal, Suewellyn hat ein Zeichen im Gesicht«, rief er da. »Da hat sie der Teufel geküßt.«
Alle lauschten mit weit aufgerissenen Augen, als er ihnen erzählte, daß der Teufel um Mitternacht komme und sich die Seinen auserwähle. Dann küsse er sie, und wo er sie berührt hätte, hinterlasse er ein Mal.
»Unsinn«, sagte ich. »Eine Menge Leute haben Leberflecke, das weiß doch jeder.«
»Dies ist eine ganz bestimmte Sorte«, sagte Anthony düster. »Die erkenne ich auf den ersten Blick. Ich habʼ einmal eine Hexe gesehen, die hatte genau so einen Fleck wie den da an ihrem Mund ... versteht ihr?«
Alle starrten mich entgeistert an.
»Sie sieht aber nicht wie eine Hexe aus«, meinte Jane Motley, und ich war sicher, daß sie recht hatte. In meinem braven Kattunkleid und mit meinem streng aus der Stirn gekämmten Haar, das zu zwei mit marineblauen Samtbändern zusammengehaltenen Zöpfen geflochten war, sah ich ganz gewiß nicht wie eine Hexe aus. Eine ordentliche, saubere, anständige Haartracht sei das, wie Tante Amelia oft betonte, wenn ich mein Haar offen tragen wollte.
»Hexen können ihre Gestalt verwandeln«, erklärte Anthony.
»Ich habʼja immer gewußt, daß Suewellyn irgendwie anders ist«, sagte Gill, die Tochter des Schmieds.
»Wie schaut er denn aus, der ... Teufel?« fragte jemand.
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich. »Ich habʼ ihn nie gesehen.«
»Glaubt ihr kein Wort«, sagte Anthony Felton. »Sie hat das Teufelsmal.«
»Du bist ja blöde«, sagte ich zu ihm, »und niemand würde auf dich hören, wenn du nicht der Enkel des Gutsherrn wärst.«
»Hexe«, sagte Anthony.
Tom war an diesem Tag nicht in der Schule. Er mußte seinem Vater bei der Kartoffelernte helfen.
Ich hatte Angst. Die sahen mich alle so merkwürdig an, und auf einmal wurde mir bewußt, daß es mit mir eine besondere Bewandtnis hatte, daß ich anders war als die Masse.
Es war ein seltsames Gefühl – einerseits frohlockte ich, weil ich anders war, andererseits war mir bange.
Dann kam Miss Brent herein, und es wurde nicht mehr geflüstert; doch als der Unterricht zu Ende war, rannte ich schleunigst aus der Schule. Ich fürchtete mich vor diesen Kindern. Ich hatte es ihren Augen angesehen, daß sie wirklich glaubten, der Teufel habe mich des Nachts heimgesucht und mir sein Mal aufgeprägt.
Ich lief über den Anger zu Matty Grey, die vor ihrer Tür saß, einen Halbliterkrug neben sich, die Hände im Schoß gefaltet Sie rief mir entgegen: »Wo rennst du denn hin ... als wäre dir der Teufel auf den Fersen.«
Kalte Furcht ergriff mich. Ich blickte über meine Schulter.
Matty brach in Gelächter aus. »Ist doch bloß so ʼne Redensart Kein Teufel ist hinter dir her. Aber du siehst ja wirklich zu Tode erschrocken aus.«
Ich ließ mich zu ihren Füßen nieder.
»Wo ist Tom?« fragte ich.
»Der buddelt noch immer Kartoffeln aus. Ist ʼne gute Ernte dieses Jahr.« Sie leckte sich die Lippen, »ʼs geht nichts über ʼne gute Kartoffel. Schön heiß und mehlig, mit ʼner leckeren braunen Pelle. Was Besseres gibtʼs nicht Suewellyn.«
Ich sagte: »Es ist wegen meines Leberflecks im Gesicht.«
Matty beäugte mich, ohne sich zu rühren. »Was ist damit?« fragte sie. »Das ist doch bloß ein Schönheitsfleck, weiter nichts.«
»Da hat mich der Teufel geküßt haben sie gesagt.«
»Wer hat das gesagt?«
»Die in der Schule.«
»Sie haben kein Recht so etwas zu sagen. Ich werdʼs Tom erzählen, und dann sorgt er dafür, daß sie aufhören.«
»Warum ist der Fleck dann da, Matty?«
»Oh, manchmal wird man damit geboren. Die Menschen kommen mit allen möglichen Sachen auf die Welt. Die Cousine meiner Tante sah bei ihrer Geburt aus, als hätte sie einen Büschel Erdbeeren im Gesicht ... bloß weil ihre Mutter ʼne Vorliebe für Erdbeeren hatte, bevor sie auf die Welt kam.«
»Und was für eine Vorliebe hatte meine Mutter, daß ich mit so einem Fleck auf die Welt kam?«
Ich dachte: Und wo ist meine Mutter? Das war eine weitere Merkwürdigkeit an mir: Ich hatte keine Mutter. Ich hatte keinen Vater. Es gab Waisen im Dorf, aber die wußten wenigstens, wer ihre Eltern gewesen waren. Ich dagegen wußte es nicht.
»Je nun, das kann man nie wissen, Mäuschen«, sagte Matty begütigend. »Solche Dinger kriegt man eben ab und zu. Ich kannte mal ein Mädchen, das kam mit sechs Fingern auf die Welt Na, das ließ sich schwerlich verheimlichen. Was ist schon ein Leberfleck, der bisher niemandem aufgefallen ist? Ich will dir was sagen. Ich finde, der ist richtig hübsch. Manche Leute machen ein Riesengetue um so ʼn Ding. Sie malen es sogar dunkler, damit manʼs besser sieht. Du brauchst dir deswegen wirklich keine Sorgen zu machen.«
Matty war einer der gütigsten Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind. Sie war mit ihrem Los zufrieden, obwohl es aus wenig mehr bestand als einem Dasein in der dunklen kleinen Hütte – »eins rauf, eins runter, ein Eckchen zum Waschen und Kochen und ein Abtritt hinten im Garten«, so beschrieb sie ihre Behausung. Ihr Sohn, Toms Vater, wohnte in der Hütte gleich nebenan. »Nahe, aber nicht zu dicht«, pflegte sie zu sagen, »just wie es sein soll.« Und wenn sie an trockenen Tagen draußen sitzen und das Geschehen beobachten konnte, dann begehrte sie nichts weiter.
Mochte Tante Amelia auch mißbilligend bemerken, daß Matty, wenn sie vor ihrer Tür saß, das harmonische Bild des Angers störe – Matty lebte ihr Leben nach ihrem eigenen Willen und hatte einen Zustand der Zufriedenheit erreicht, wie es nur wenigen Menschen gelingt.
Als ich am nächsten Tag zur Schule kam, flüsterte mir Anthony Felton ins Ohr: »Du bist ein Bastard.«
Ich starrte ihn an. Ich hatte diesen Ausdruck als Schimpfwort gehört und setzte dazu an, Anthony zu sagen, was ich von ihm hielt; aber da kam Tom hinzu, und Anthony verzog sich sofort. »Tom«, flüsterte ich, »er hat Bastard zu mir gesagt.«
»Mach dir nichts draus«, meinte Tom und fügte geheimnisvoll hinzu: »Bastard nicht in dem Sinn, wie du denkst.« Ich fand das damals sehr verwirrend.
Zwei oder drei Tage vor meinem sechsten Geburtstag befahl Tante Amelia mich in die gute Stube, um etwas mit mir zu besprechen. Sie tat sehr feierlich, und ich wartete auf das, was sie mir zu sagen hatte.
Es war der erste September, und einem Sonnenstrahl war es gelungen, durch eine Ritze der nicht ganz geschlossenen Jalousien hereinzudringen. Ich sehe heute noch alles ganz deutlich vor min das Roßhaarsofa, die passenden Roßhaarsessel, die gottlob nur selten benutzt wurden, mit ihren säuberlich über die Rückenlehnen gestreiften Schonbezügen; die Etagere in der Ecke mit ihren Verzierungen, die zweimal in der Woche abgestaubt wurde; die Heiligenbilder an der Wand und das Konterfei der jungen Königin mit dem mißbilligenden Blick, den verschränkten Armen und dem Hosenbandorden über der Schulter. In diesem Zimmer gab es nichts Heiteres, und deshalb wirkte der Sonnenstrahl so fehl am Platz. Ich war sicher, daß Tante Amelia ihn bald bemerken und die Jalousien vollends schließen würde.
Aber sie tat zu meiner großen Überraschung nichts dergleichen. Sie war offensichtlich mit ihren Gedanken ganz woanders und schien recht besorgt.
»Miss Anabel kommt am Dritten«, sagte sie. Der dritte September war mein Geburtstag.
Ich faltete die Hände und wartete. Miss Anabel war stets an meinem Geburtstag gekommen.
»Sie denkt an ein kleines Fest für dich.«
Mein Herz klopfte schneller. Ich wartete atemlos.
»Wenn du brav bist ...«, sprach Tante Amelia weiter. Es war die übliche Einschränkung, und ich achtete kaum darauf. Sie fuhr fort: »... kannst du dein Sonntagskleid anziehen, obwohl es ein Donnerstag ist.«
An einem Donnerstag Sonntagskleider zu tragen, das erschien mir wahrhaft ungeheuerlich.
Tante Amelia hatte die Lippen fest zusammengepreßt. Ich sah ihr an, daß ihr das Vorhaben mißfiel.
»Sie will an diesem Tag mit dir ausgehen.«
Ich war fassungslos. Ich konnte mich kaum beherrschen. Am liebsten wäre ich auf dem Roßhaarsessel auf und nieder gehüpft.
»Wir müssen darauf achten, daß du nichts falsch machst«, sagte Tante Amelia. »Ich möchte nicht, daß Miss Anabel denkt, wir erziehen dich nicht wie eine Dame.«
Ich platzte heraus, daß ich alles recht machen würde. Ich wollte nichts vergessen, was man mich gelehrt hatte. Ich würde nicht mit vollem Mund sprechen. Ich wollte mein Taschentuch bereithalten, falls es gebraucht würde. Ich wollte nicht vor mich hin summen. Ich wollte immer erst reden, wenn ich gefragt würde.
»Sehr gut«, sagte Tante Amelia, und später hörte ich Onkel William bemerken: »Was denkt sie sich nur dabei? Mir gefallt das nicht Es setzt dem Kind Flausen in den Kopf.«
Der große Tag kam. Mein sechster Geburtstag. Ich hatte meine schwarzen Knöpfstiefel an und meine dunkelblaue Jacke, darunter nur ein Kleid aus glänzender Baumwolle. Ich trug dunkelblaue Handschuhe und einen Strohhut mit einem Gummiband unter dem Kinn, damit er nicht fortfliegen konnte.
Miss Anabel kam mit einer Droschke vom Bahnhof, und als sie zurückfuhr, saß ich mit darin.
Miss Anabel wirkte an diesem Tag verändert. Ich hatte den Eindruck, daß sie sich in Tante Amelias Gegenwart ein wenig fürchtete. Sie lachte unentwegt umklammerte meine Hände und sagte zwei- oder dreimal: »Ist das schön, Suewellyn!«
Unter den neugierigen Blicken des Stationsvorstehers stiegen wir in den Zug, und kurz darauf dampften wir davon. Ich konnte mich nicht erinnern, zuvor schon einmal mit der Eisenbahn gefahren zu sein, und ich wußte nicht, was ich aufregender fand, das Geräusch der Räder, die ein munteres Lied zu singen schienen, oder die vorübersausenden Felder und Wälder; das größte Vergnügen jedoch war die Gegenwart von Miss Anabel, die ganz dicht neben mir saß und ab und zu meine Hand drückte.
Ich hätte Miss Anabel gern so viele Fragen gestellt doch ich besann mich, daß ich Tante Amelia gelobt hatte, mich wie ein wohlerzogenes Mädchen zu benehmen.
»Du bist so still, Suewellyn«, sagte Miss Anabel, und ich erklärte ihr, daß ich nur reden dürfe, wenn ich gefragt würde.
Sie lachte; sie hatte ein glucksendes Lachen, das mich jedesmal, wenn ich es hörte, zum Mitlachen reizte.
»Oh, das kannst du vergessen«, sagte sie. »Ich möchte, daß du mit mir sprichst, wann immer du Lust dazu hast. Du sollst mir alles erzählen, was dir in den Sinn kommt.«
Seltsam, als der Bann gebrochen war, fiel mir nichts mehr ein. Ich sagte: »Fragen Sie mich was.«
Sie legte den Arm um mich und drückte mich an sich. »Ich möchte, daß du mir sagst, daß du glücklich bist. Du hast Onkel William und Tante Amelia doch gern, nicht wahr?«
»Sie sind alle beide sehr gut«, erwiderte ich, »besonders Tante Amelia.«
»Ist Onkel William nicht nett zu dir?« fragte sie rasch.
»Doch, doch. Sogar netter. Tante Amelia ist nämlich so schrecklich gut, daß sie selten nett sein kann. Sie lacht nie ...« Ich brach ab, weil Miss Anabel furchtbar lachen mußte und es so aussah, als behauptete ich, sie sei nicht nett.
Sie umarmte mich und sagte: »O Suewellyn ... was bist du doch für ein kleines Mädchen.«
»Bin ich nicht«, widersprach ich. »Ich bin größer als Clara Feen und Jane Motley. Und die sind älter als ich.«
Sie drückte mich an sich, so daß ich ihr Gesicht nicht sehen konnte, und ich hatte den Eindruck, daß sie es absichtlich vor mir verbarg. Der Zug hielt und sie sprang auf. »Hier steigen wir aus«, sagte sie. Sie nahm mich bei der Hand, und wir verließen den Zug. Wir rannten fast den Bahnsteig entlang. Draußen stand ein zweirädriger Einspänner. Eine Frau saß darin.
»O Janet«, rief Miss Anabel, »ich wußte, daß du kommen würdest.«
»ʼs ist nicht recht«, sagte die Frau mit einem Blick auf mich. Sie hatte ein blasses Gesicht und braunes, im Nacken zu einem Knoten zusammengefaßtes Haar. Sie trug eine braune Haube, die mit Bändern unter dem Kinn befestigt war, und ich mußte plötzlich an Onkel William denken, weil ich merkte, daß sie sich bemühte, ein Lächeln zu unterdrücken.
»Das ist also das Kind, Miss«, sagte sie.
»Ja, das ist Suewellyn«, erwiderte Miss Anabel.
Janet schnalzte mit der Zunge. »Ich weiß nicht, warum ich ...«, begann sie.
»Janet, das wird ein wundervoller Tag. Ist der Korb da?«
»Alles wie befohlen, Miss.«
»Komm, Suewellyn«, sagte Miss Anabel. »Steig in die Kutsche. Wir machen eine Spazierfahrt.«
Janet saß vorn und hielt die Zügel. Miss Anabel und ich nahmen hinter ihr Platz. Miss Anabel umklammerte meine Hand. Sie lachte wieder.
Der Einspänner setzte sich in Bewegung, und bald fuhren wir über baumgesäumte Feldwege. Ich wünschte, es würde ewig so weitergehen. Es war, als betrete ich eine verzauberte Welt. Die Bäume begannen gerade, sich bunt zu färben; ein schwacher Dunst lag in der Luft, und der diesige Sonnenschein verlieh der Landschaft etwas Geheimnisvolles.
»Ist dir warm genug, Suewellyn?« erkundigte sich Miss Anabel. Ich nickte glücklich. Ich wollte nicht sprechen. Ich hatte Angst den Zauber zu brechen; ich fürchtete, ich würde in meinem Bett aufwachen und feststellen, daß ich alles nur geträumt hatte. Ich versuchte, jeden Augenblick einzufangen und festzuhalten; jetzt, sagte ich zu mir. Es ist freilich immer jetzt, aber ich wünschte, dieser Augenblick des Jetzt bliebe mir ewig erhalten.
Ich war nahezu unerträglich aufgeregt nahezu unerträglich glücklich.
Als der Einspänner plötzlich anhielt, stieß ich einen Seufzer der Enttäuschung aus. Aber es sollte noch mehr kommen.
»Das ist die Stelle«, sagte Janet »Aber, Miss Anabel, ich finde, es ist viel zu nahe, um sich hier so sorglos niederzulassen.«
»Ach was, Janet. Es ist vollkommen sicher. Wie spät ist es?«
Janet blickte auf die Uhr, die sie an ihrer schwarzen Bluse befestigt hatte.
»Halb zwölf«, sagte sie.
Miss Anabel nickte. »Nimm den Korb«, sagte sie. »Mach alles bereit. Suewellyn und ich machen einen kleinen Spaziergang. Das ist dir doch recht, Suewellyn, oder?«
Ich nickte. Mir wäre alles recht gewesen, was ich mit Miss Anabel zusammen tat.
»Geben Sie nur acht, Miss«, sagte Janet »Wenn man Sie sieht ...«
»Man wird uns schon nicht sehen. Bestimmt nicht. So nahe gehen wir nicht heran.«
»Das will ich auch nicht hoffen.«
Miss Anabel nahm mich bei der Hand, und wir spazierten davon.
»Ist die aber schlecht aufgelegt«, sagte ich.
»Sie ist auf der Hut.«
»Was heißt das?«
»Sie will nichts riskieren.«
Ich verstand zwar nicht, wovon Miss Anabel sprach, war aber zu glücklich, um mir darüber den Kopf zu zerbrechen.
»Laß uns in den Wald gehen«, sagte sie. »Ich möchte dir etwas zeigen. Los, komm!«
Wir sausten zwischen den Bäumen hindurch über das Gras. »Fang mich doch«, rief Miss Anabel.
Es gelang mir beinahe; sie lachte und entwischte mir wieder. Ich geriet außer Atem und war noch glücklicher als im Zug und in der Kutsche. Die Bäume hatten sich gelichtet; wir waren am Waldrand angelangt.
»Suewellyn«, sagte Miss Anabel mit sanfter Stimme. »Schau.« Und dort, ungefähr eine Viertelmeile von uns entfernt stand es, von einem Graben umgeben, auf einem kleinen Hügel. Ich konnte es deutlich sehen. Es war wie ein Schloß aus einem Märchen.
»Was sagst du nun?« fragte Miss Anabel.
»Ist das ... echt?« wollte ich wissen.
»Aber ja ... es ist echt.«
Ich besaß schon immer ein ausgeprägtes Erinnerungsvermögen. Hatte ich nur ein- oder zweimal einen Blick auf etwas geworfen, konnte ich mir alle Einzelheiten merken. Deshalb war es mir auch möglich, das Bild von Schloß Mateland in den kommenden Jahren im Gedächtnis zu bewahren. Ich beschreibe es jetzt so, wie ich es kenne.
Als ich es mit sechs Jahren zum erstenmal erblickte, war der Tag von einem Zauber verklärt, und es blieb mir für einige Jahre in Erinnerung wie ein Traum.
Das Schloß war prächtig und geheimnisvoll. Es war von hohen Mauern umringt, mit mächtigen Rundtürmen an den vier Ecken; an jeder Mauerseite stand ein eckiger Turm, und auch das traditionelle, mit Pechnasen bewehrte Pförtnerhaus fehlte nicht. Lange, schmale Fensterschlitze waren in die Quadermauern eingelassen. Die Brüstung des seitlichen Wachturms, der das darunterliegende Portal schützte, erinnerte mich auf schaurige Weise daran, daß einst siedendes Öl auf jeden herabgegossen wurde, der den Versuch wagte, die Befestigungen zu überwinden. Hinter den Zinnen auf den Mauern befanden sich Wandelgänge, von denen die Verteidiger ihre Pfeile niederprasseln ließen. Dies alles und noch viel mehr erfuhr ich erst später, als ich jeden Kragstein, jede Pechnase, jede Biegung der Wendeltreppen kennenlernen sollte. Doch das Schloß zog mich bereits von jenem ersten Augenblick an in seinen Bann; es war fast, als ergreife es Besitz von mir. Später gefiel ich mir in der Vorstellung, daß es mir meine Handlungsweise aufzwang.
Damals aber vermochte ich nur neben Miss Anabel zu stehen, sprachlos vor Staunen.
Ich hörte sie lachen, und sie flüsterte: »Gefällt es dir?«
Ob es mir gefiel? Dies schien mir ein viel zu schwaches Wort, um auszudrücken, welche Gefühle der Anblick des Schlosses in mir erweckte. Es war das Herrlichste, was ich je gesehen hatte.
In Miss Brents Schulzimmer hing ein Bild von Schloß Windsor. Es war wunderschön. Aber das hier war etwas anderes. Das hier war echt. Die Septembersonne ließ die kleinen scharfen Quarzstückchen im Mauerwerk funkeln.
Miss Anabel wartete auf meine Antwort.
»Es ist schön ... Es ist echt.«
»O ja, es ist echt«, wiederholte Miss Anabel. »Es steht schon seit siebenhundert Jahren dort.«
»Siebenhundert Jahre«, echote ich.
»Eine lange Zeit, hm? Und denk nur, du bist erst seit sechs Jahren auf dieser Erde. Ich freue mich, daß es dir gefällt.«
»Wohnt da auch jemand?«
»O ja, da wohnen Leute.«
»Ritter ...«, flüsterte ich. »Vielleicht die Königin.«
»Nein, nicht die Königin, und es gibt heutzutage auch keine Ritter in Rüstungen mehr ... nicht einmal in siebenhundert Jahre alten Schlössern.«
Plötzlich erschienen vier Leute – ein Mädchen und drei Knaben. Sie ritten über den Rasen vor dem Schloßgraben. Das Mädchen hatte ein Pony; sie fiel mir besonders auf, weil sie ungefähr in meinem Alter sein mußte. Die Knaben waren älter.
Miss Anabel hielt den Atem an. Sie legte ihre Hand auf meinen Arm und zog mich ins Gebüsch.
»Kein Grund zur Aufregung«, flüsterte sie wie zu sich selbst »Sie gehen hinein.«
»Wohnen sie dort?« fragte ich.
»Nicht alle. Nur Susannah und Esmond. Malcolm und Garth sind zu Besuch.«
»Susannah«, sagte ich. »Das klingt ein bißchen wie mein Name.«
»O ja, gewiß.«
Ich beobachtete, wie die Reiter die Brücke, die über den Graben führte, überquerten und durch das Pförtnerhaus im Schloß verschwanden.
Ihr Erscheinen hatte Miss Anabel tief bewegt. Sie ergriff plötzlich meine Hand, und ich erinnerte mich an Tante Amelias Geheiß, nicht zu reden, wenn ich nicht gefragt wurde.
Miss Anabel lief zurück unter die Bäume. Ich versuchte sie zu fangen, und wir lachten wieder.
Wir kamen zu einer Lichtung; dort hatte Janet den Korb ausgepackt und ein Tuch auf dem Gras ausgebreitet; sie legte Besteck und Teller auf.
»Wir wollen noch etwas warten«, sagte Miss Anabel.
Janet nickte mit verkniffenen Lippen, als halte sie eine unfreundliche Bemerkung zurück.
Miss Anabel schien ihre Gedanken zu erraten, denn sie sagte: »Es ist nicht deine Sache, Janet.«
»O nein«, erwiderte Janet mit einem Gesicht wie eine Henne, der sich die Haare sträuben, »das weiß ich sehr gut. Ich tuʼ nur, was man mir aufträgt.«
Miss Anabel gab ihr einen leichten Schubs. Dann sagte sie; »Horcht!«
Wir lauschten. Ich hörte das unverkennbare Geräusch von Pferdehufen.
»Er ist es«, sagte Miss Anabel.
»Seien Sie vorsichtig, Miss«, warnte Janet »Es könnte jemand anders sein.«
Ein Reiter kam in Sicht. Anabel stieß einen Freudenschrei aus und lief ihm entgegen.
Er sprang vom Pferd und band es an einen Baum. Miss Anabel, die für eine Frau recht groß gewachsen war, wirkte neben dem Mann mit einemmal sehr klein. Er legte ihr seine Hände auf die Schultern und blickte sie ein paar Sekunden lang an. Dann fragte er: »Wo ist sie?«
Miss Anabel streckte ihre Hand aus, und ich lief zu ihr.
»Das ist Suewellyn«, sagte sie.
Ich machte einen Knicks, wie ich es vor dem Gutsherrn und dem Pfarrer zu tun pflegte, weil man es mich so gelehrt hatte. Der Mann hob mich hoch, hielt mich in seinen Armen und sah mich prüfend an.
»O je«, sagte er, »wie klein sie noch ist.«
»Vergiß nicht, sie ist erst sechs«, erwiderte Miss Anabel. »Was hast du denn erwartet? Eine Amazone? Dabei ist sie sehr groß für ihr Alter, nicht wahr, Suewellyn?«
Ich sagte, ich sei größer als Clara Feen und Jane Motley, und die seien älter als ich.
»Fein«, sagte er, »das ist ein Glück. Ich bin froh, daß du die zwei überholt hast.«
»Aber Sie kennen sie doch gar nicht«, meinte ich.
Da mußten sie beide lachen.
Er ließ mich hinunter und strich mir übers Haar. Ich trug es heute offen, denn Miss Anabel konnte Zöpfe nicht leiden.
»Jetzt wollen wir essen«, verkündete Miss Anabel. »Janet hat alles vorbereitet.« Sie flüsterte dem Mann zu: »Höchst widerwillig, das kann ich dir versichern.«
»Das brauchst du mir nicht eigens zu versichern«, erwiderte er. »Sie glaubt, dies sei wieder einer von meinen verrückten Plänen.«
»Na und, ist es das nicht?«
»Oh, du hast es genauso gewollt wie ich.«
Seine Hand lag noch immer auf meinem Kopf. Er zerzauste mein Haar und sagte: »Ich glaube schon.«
Anfangs war ich ziemlich enttäuscht, daß er und Janet zugegen waren. Ich hätte Miss Anabel lieber für mich allein gehabt. Doch nach einer Weile änderte ich meine Meinung. Jetzt war es nur noch Janet, die ich nicht dabeihaben wollte. Sie saß ein Stück von uns entfernt und ihre Miene gemahnte mich an Tante Amelia. Das wiederum erinnerte mich an die unerfreuliche Tatsache, daß dieser märchenhafte Tag einmal enden würde, ich in das Haus am Anger zurückkehren mußte und mir nur die Erinnerung blieb. Doch vorerst war jetzt, und das Jetzt war wunderbar.
Wir setzten uns zum Essen nieder, ich saß zwischen Miss Anabel und dem Herrn. Ein- oder zweimal sprach sie ihn mit seinem Vornamen an. Er hieß Joel. Man sagte mir nicht, wie ich ihn nennen sollte, was mich ein wenig verlegen machte. Er hatte etwas Besonderes an sich, und es war unmöglich, sich diesem Flair zu entziehen. Ich spürte, daß Janet Achtung vor ihm hatte. Mit ihm sprach sie nicht so wie mit Anabel. Wenn sie ihn anredete, nannte sie ihn Sir.
Er hatte dunkelbraune Augen, und sein Haar war von etwas hellerem Braun. Er hatte tiefe Grübchen im Kinn und strahlend weiße Zähne. Seine Hände waren kräftig und gepflegt. Sie fielen mir besonders auf; am kleinen Finger trug er einen Siegelring. Mir schien, daß er mich und Miss Anabel beobachtete, und Miss Anabel ihrerseits beobachtete ihn und mich. Janet, die ein wenig abseits saß, hatte ihr Strickzeug hervorgeholt, und ihre klappernden Nadeln schienen ebenso von ihrer Mißbilligung zu künden wie ihr verkniffener Mund.
Miss Anabel erkundigte sich bei mir nach dem Leben in der Hütte bei Tante Amelia und Onkel William. Sie hatte mich das meiste schon vorher gefragt, und mir wurde klar, daß sie die Fragen wiederholte, damit Joel die Antworten hören konnte. Er lauschte aufmerksam, und hin und wieder nickte er.
Das Mahl war köstlich; vielleicht war ich aber auch so verzaubert, daß mir alles anders vorkam als im Alltagsleben. Es gab Hähnchen, knuspriges Brot und eine Art Gewürzgurken, die ich noch nie gekostet hatte.
»Oh«, sagte Miss Anabel, »Suewellyn hat den Wunschknochen.« Sie nahm den Knochen von meinem Teller und hielt ihn in die Höhe.
»Komm, Suewellyn, wir müssen ziehen. Wenn du die größere Hälfte erwischst, hast du einen Wunsch frei.«
»Drei Wünsche«, sagte der Mann.
»Nein, nur einen, Joel, das weißt du doch«, widersprach Miss Anabel.
»Heute sind es drei«, erwiderte er. »Es ist ein besonderer Geburtstag, hast du das vergessen?«
»Natürlich ist es ein besonderer Tag.«
»Also gibt es auch besondere Wünsche. Und jetzt gehtʼs los.«
»Du weißt, was du zu tun hast, Suewellyn«, sagte Miss Anabel. Sie nahm den Knochen. »Du legst deinen kleinen Finger um dieses Ende, und ich lege meinen kleinen Finger um das andere Ende, und dann ziehen wir. Wer das größere Stück bekommt, darf sich etwas wünschen.«
»Dreimal«, sagte Joel.
»Eine Bedingung ist dabei«, erklärte Miss Anabel. »Du darfst deine Wünsche nicht verraten. Fertig?«
Wir legten unsere kleinen Finger um den Knochen. Es knackte. Der Knochen war durchgebrochen, und ich schrie entzückt auf, weil ich das größere Stück in der Hand hielt.
»Suewellyn hat gewonnen!« rief Miss Anabel.
»Mach die Augen zu, und denk dir deine Wünsche«, sagte Joel und lächelte dabei.
Ich hielt den Knochen in der Hand und überlegte, was ich mir am liebsten wünschte. Ich wollte, daß dieser Tag nie endete, aber das wäre ein törichter Wunsch gewesen, denn nichts, nicht einmal ein Hühnerknochen, könnte ihn erfüllen. Ich dachte angestrengt nach. Ich hatte mir immer einen Vater und eine Mutter gewünscht, und ehe ich mich versah, war der Wunsch gedacht – aber ich wollte nicht irgendwelche Eltern. Ich wollte einen Vater wie Joel und eine Mutter wie Miss Anabel. Damit war der zweite Wunsch gedacht. Ich wollte nicht in der Holzapfelhütte leben müssen. Ich wollte bei meinen Eltern wohnen. Die drei Wünsche waren gedacht.
Ich öffnete die Augen. Die beiden beobachteten mich eindringlich.
»Bist du fertig mit deinen Wünschen?« fragte Miss Anabel.
Ich nickte und preßte die Lippen zusammen. Es war sehr wichtig, daß die Wünsche in Erfüllung gingen.
Danach aßen wir köstliche, mit Kirschmarmelade gefüllte Törtchen, und als ich in den süßen Kuchen biß, dachte ich: Eine größere Seligkeit kann es nicht geben.
Joel fragte mich, ob ich reiten könne.
Ich verneinte.
»Das sollte sie aber«, sagte er mit einem Blick auf Miss Anabel.
»Darüber müßte ich mit deiner Tante Amelia sprechen«, meinte Miss Anabel.
Joel erhob sich und reichte mir seine Hand. »Komm, laß uns sehen, ob es dir Spaß macht«, sagte er.
Ich ging mit ihm zu seinem Pferd, und er hob mich in den Sattel. Er führte das Pferd zwischen den Bäumen herum. Ich fand, dies sei der aufregendste Augenblick meines Lebens. Plötzlich sprang Joel hinter mir auf, und schon preschten wir davon, aus dem Wald hinaus auf ein Feld. Das Pferd verfiel in Galopp, immer schneller, und einen Moment dachte ich: Vielleicht ist er der Teufel und will mich entführen.
Doch seltsamerweise hatte ich nichts dagegen. Ich wollte, daß er mich entführte. Ich wollte mein ganzes Leben lang bei ihm und Miss Anabel bleiben. Es war mir einerlei, ob er der Teufel war. Wenn Tante Amelia und Onkel William Heilige waren, dann war mir der Teufel lieber. Ich hatte das Gefühl, das Miss Anabel stets in seiner Nähe war, und wenn ich mit einem von ihnen zusammen wäre, so wäre auch der andere nicht weit.
Doch der aufregende Ritt ging zu Ende, und das Pferd schritt wieder langsam durch die Bäume zu der Lichtung, wo Janet die Picknickreste zusammenpackte und den Korb in dem Einspänner verstaute.
Joel stieg ab und hob mich herunter.
Ich war unbeschreiblich traurig, denn ich wußte, daß mein Besuch im Zauberwald mit dem fernen Schloß vorüber war. Es war wie ein schöner Traum, und ich sträubte mich heftig, daraus zu erwachen. Doch ich wußte, es half nichts.
Joel hob mich auf seine Arme und gab mir einen Kuß. Ich legte meine Arme um seinen Hals. Ich sagte: »Oh, war das schön.«
»Nie habe ich einen Ritt mehr genossen«, erwiderte er.
Miss Anabel sah uns mit einem Blick an, als wüßte sie nicht, ob sie lachen oder weinen sollte; da sie nun einmal Miss Anabel war, lachte sie.
Joel stieg auf sein Pferd und folgte uns zur Kutsche. Miss Anabel und ich kletterten hinein. Er verschwand in die eine Richtung, und wir fuhren in die andere Richtung zum Bahnhof. Dort stiegen wir aus.
»Vergiß nicht, mich vom Zug abzuholen, Janet«, sagte Miss Anabel. Dies gemahnte mich auf traurige Weise daran, daß der Tag fast vorüber war, daß ich bald wieder in die Hütte zurückkehrte und daß die Erlebnisse dieses Tages der Vergangenheit angehörten. Wir saßen nebeneinander im Zug und hielten uns fest an den Händen, als wollten wir uns nie wieder loslassen. Wie der Zug raste! Wie gern hätte ich ihn aufgehalten! Die Räder lachten mich aus: »Bist bald zurück! Bist bald zurück!« sagten sie wieder und wieder.
Kurz vor der Ankunft legte Miss Anabel ihren Arm um mich und fragte: »Was hast du dir gewünscht, Suewellyn?«
»Oh, das darf ich nicht verraten«, rief ich. »Sonst geht es nicht in Erfüllung, und das wäre schrecklich.«
»Waren deine Wünsche denn so dringend?«
Ich nickte.
Sie schwieg eine Weile, und dann sagte sie: »Es stimmt nicht ganz, daß du sie niemandem verraten darfst. Einem Menschen darfst duʼs erzählen, wenn du willst ... und wenn du flüsterst, gehen die Wünsche trotzdem in Erfüllung.«
Ich war selig. Es ist sehr tröstlich, wenn man seine Erlebnisse mit jemandem teilen kann, und mit niemandem hätte ich sie lieber geteilt als mit Miss Anabel.
Also sagte ich: »Zuerst habe ich mir einen Vater und eine Mutter gewünscht. Dann wünschte ich, daß es Sie und Joel sind; und danach wünschte ich, daß wir alle zusammensein könnten.«
Sie sprach lange kein Wort, und ich hätte gern gewußt, ob es ihr leid tat, daß sie es erfahren hatte.
Wir waren am Bahnhof angelangt. Die Droschke erwartete uns, und in wenigen Minuten kamen wir zur Holzapfelhütte. Sie wirkte trostloser denn je, nachdem ich in dem wundersamen Wald gewesen und das Zauberschloß gesehen hatte.
Miss Anabel küßte mich und sagte: »Ich muß mich beeilen, sonst versäume ich meinen Zug.« Sie sah immer noch so aus, als fange sie gleich an zu weinen, obwohl sie lächelte. Ich lauschte auf das Klappern der Pferdehufe, die sie davontrugen.
In meinem Zimmer lagen zwei Päckchen, die Miss Anabel für mich dagelassen hatte. Das eine enthielt ein mit Bändern verziertes Kleid aus blauer Seide. Es war das hübscheste Kleid, das ich je gesehen hatte. Das war Miss Anabels Geburtstagsgeschenk. In dem anderen Päckchen war ein Buch über Pferde, und ich wußte, daß es von Joel war.
Was für ein herrlicher Geburtstag! Doch das Traurige an herrlichen Erlebnissen ist, daß sie die folgenden Tage um so trüber erscheinen lassen.
Tante Amelia bemerkte zu Onkel William über den Ausflug: »So was setzt ihr nur Flausen in den Kopf!«
Möglicherweise hatte sie recht.
In den folgenden Wochen lebte ich wie in einem Traum. Immer wieder betrachtete ich das blaue Kleid, das in meinem Schrank hing. Ich zog es nie an. Es sei höchst unangemessen, meinte Tante Amelia, und ich sah ein, daß sie recht hatte. Es war zu schade, um getragen zu werden. Es war nur zum Anschauen da. In der Schule sagte Miss Brent: »Was ist in dich gefahren, Suewellyn? Du bist neuerdings sehr unaufmerksam.«
Anthony Felton behauptete, ich ginge nachts zum Hexensabbat; dort zöge ich alle meine Kleider aus, tanzte immer im Kreis herum und küßte Bauer Mills Ziege.
»Sei nicht albern«, sagte ich zu ihm, und ich glaube, die anderen stimmten mit mir überein, daß er phantasierte. Tante Amelia hätte nie zugelassen, daß ich nachts fortging und meine Kleider auszog, weil es sich nicht schickte; und Ziegen zu küssen war ungesund. Ich las, soviel ich vermochte, in dem Buch über Pferde. Zwar begriff ich nicht alles, aber ich hoffte unentwegt, daß Miss Anabel eines Tages wiederkäme, um mich in den Zauberwald zu bringen. Ich wollte unbedingt etwas über Pferde wissen, wenn ich Joel wieder begegnete. Ich dachte, wie töricht ich doch war, weil ich mir nichts gewünscht hatte, das leichter zu erfüllen wäre – etwa noch so einen Tag im Wald anstatt Eltern. Väter und Mütter mußten schließlich verheiratet sein. Sie glichen nicht im geringsten Miss Anabel und Joel.
Ich fing an, mich für Pferde zu interessieren. Anthony Felton hatte ein Pony, und ich bat ihn, mich darauf reiten zu lassen. Zuerst lachte er mich aus, doch dann fiel ihm wohl ein, daß ich, wenn ich zu reiten versuchte, bestimmt hinunterfallen würde; und das gäbe einen Heidenspaß. Wir gingen also zur Pferdekoppel beim Gutshaus; ich stieg auf Anthonys Pony und ritt eine Runde durch die Koppel. Es war ein Wunder, daß ich nicht abgeworfen wurde. Ich dachte immerfort an Joel und bildete mir ein, daß er mich beobachtete. Ich wollte vor seinen Augen bestehen.
Anthony war sehr enttäuscht und ließ mich danach nie wieder auf seinem Pony reiten.
Im November kam Miss Anabel wieder. Sie war blasser und magerer geworden. Sie erzählte mir, daß sie krank gewesen sei; sie habe eine Rippenfellentzündung gehabt und deshalb nicht früher kommen können.
»Gehen wir wieder in den Wald?« fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf, und ich fand, daß sie sehr traurig aussah.
»Hat es dir dort gefallen?« fragte sie gespannt.
Ich faltete die Hände und nickte. Es war nicht in Worten auszudrücken, wie sehr es mir gefallen hatte.
Sie schwieg mit traurigem Blick, und ich sagte: »Es war ein wunderbares Schloß. Es sah gar nicht echt aus, und ich glaube, es ist nicht immer da. Obwohl – das Mädchen und die Jungen sind hineingegangen. Und das Pferd war auch da. Ich bin auf einem Pferd geritten ... wir sind galoppiert. Das war aufregend.«
»Es hat dir also sehr gefallen, Suewellyn.«
»Ja, besser als alles, was ich bisher erlebt habe.«
Später hörte ich sie mit Tante Amelia sprechen.
»Nein«, sagte Tante Amelia, »das geht nicht, Miss Anabel. Wo sollten wir es denn lassen? So etwas können wir uns nicht leisten. Das gäbe nur noch mehr Gerede. Und ich versichere Ihnen – es wird bereits mehr als genug geklatscht.«
»Es wäre doch aber gut für sie.«
»Die Leute tuscheln schon. Ich glaube nicht, daß Mister Planter damit einverstanden wäre. Es gibt Grenzen, Miss Anabel. Und in so einem Dorf ... Ihre Besuche zum Beispiel. Die sind doch schon ungewöhnlich genug.«
»O ja, ich weiß, ich weiß, Amelia. Aber ihr würdet gut bezahlt ...«
»Es geht dabei nicht um Geld. Es geht um den äußeren Anschein. In so einem Dorf ...«
»Schon gut. Lassen wir das vorerst. Es wäre mir nur lieb gewesen, wenn sie reiten würde, und ihr hätte es Freude gemacht.« Das war alles sehr geheimnisvoll. Ich wußte, daß Miss Anabel mir zu Weihnachten ein Pony schenken wollte, und Tante Amelia war dagegen.
Ich war sehr zornig. Ich hätte mir ein Pony wünschen sollen. Das wäre etwas Vernünftiges gewesen. Aber ich war so töricht gewesen und hatte mir etwas Unmögliches gewünscht.
Miss Anabel ging, doch ich wußte, daß sie wiederkommen würde, obwohl ich Tante Amelia zu ihr hatte sagen hören, sie möge nicht allzu oft kommen. Das waren böse Aussichten.
Ich bat Anthony Felton, mich noch einmal auf seinem Pony reiten zu lassen, doch er weigerte sich. »Warum sollte ich?« fragte er.
»Weil ich beinahe auch eins bekommen hätte«, erklärte ich ihm stolz.
»Was soll das heißen? Wieso hättest ausgerechnet du ein Pony bekommen sollen?«
»Aber ich hätte wirklich beinahe eins bekommen«, beharrte ich.
Ich malte mir aus, wie ich auf einem Pony, das viel hübscher war als Anthonys, an der Pferdekoppel der Feltons vorüberritt, und war so zornig und enttäuscht, daß ich Anthony und Tante Amelia haßte. Das konnte ich Tante Amelia natürlich nicht sagen, aber Anthony bekam es von mir zu hören.
»Du bist eine Hexe und ein Bastard«, schrie er zurück, »und beides zusammen ist das Allerschlimmste auf der Welt.«
Matty Grey saß nicht mehr draußen vor ihrer Hütte. Es war zu kalt.
»Der Wind, der da über den Anger fegt, fährt mir in die Knochen«, sagte sie. »Tut meinem Zipperlein nicht gut.« Ihr Zipperlein war ihr Rheumatismus, und im Winter war er so schlimm, daß sie sich nicht vom Feuer entfernen konnte. »Das alte Zipperlein macht mir heute den Garaus«, pflegte sie zu sagen. »Aber Scherz beiseite, so weit ist es noch nicht mit mir. Tom macht mir ein schönes Feuerchen, und was gibt es Schöneres als ein gemütliches Holzfeuer? Und wenn dann noch ein Kessel auf dem Herd summt ... dann hat manʼs fast so gut wie die Engel im Himmel.«
Ich machte es mir zur Gewohnheit, auf dem Heimweg von der Schule bei Matty hereinzuschauen. Ich konnte nie lange bleiben, weil Tante Amelia nichts davon wissen durfte. Sie hätte es nicht gebilligt. Wir waren »bessere Leute« als Matty. Ich begriff das nicht ganz. Wenn ich auch nicht zum Stand des Arztes oder des Pfarrers gehörte, die ihrerseits nicht den Rang des Gutsherrn erreichten, so waren wir doch etwas »Besseres« als Matty.
Matty hieß mich eine Scheibe von dem großen Weißbrotlaib herunterschneiden. »Von der unteren Seite, Mäuschen.« Und ich spießte das Brot auf eine lange Röstgabel, die Toms Onkel in der Schmiede gefertigt hatte, und hielt es ans Feuer, bis es goldbraun war.
»Eine Tasse voll gutem starkem Tee und eine Scheibe guter brauner Toast; ein eigener Herd, und wenn draußen der Wind heult und nicht hereinkann ... ich wette, was Besseres kannʼs nicht geben.«
Da war ich anderer Meinung. Ich wußte, was es noch geben konnte: einen Zauberwald, ein Tuch auf dem Gras; Wunschknochen vom Huhn und zwei schöne Menschen, die anders waren als alle, die ich kannte; ein Zauberschloß, das man durch die Bäume erspähte, und ein Pferd, auf dem man galoppieren konnte.
»Woran denkst du, Suewellyn?« fragte Matty.
»Es kommt drauf an«, meinte ich. »Manche Leute wollen vielleicht keinen Toast und keinen starken Tee. Sie mögen vielleicht lieber ein Picknick im Wald.«
»Nun, das meine ich ja. Auf die Phantasie kommt es an. Von meinen Träumen habe ich nun erzählt, jetzt bist du dran.«
Und ehe ich mich versah, schilderte ich ihr, was ich erlebt hatte. Sie hörte zu. »Und du hast den Wald wirklich gesehen? Und das Schloß? Und jemand hat dich mitgenommen, hm? Ich weiß schon, die Dame, die immer kommt.«
»Matty«, fragte ich aufgeregt, »hast du gewußt, daß man drei Wünsche hat, wenn man einen Hühnerknochen durchbricht und die größere Hälfte erwischt?«
»O ja, das ist ein altes Spielchen. Als ich klein war, gab es ab und zu ein Rebhuhn bei uns, ein richtiger Festschmaus war das. Erst wurde es gerupft und gefüllt ... und wenn es aufgefuttert war, haben wir Kinder uns um den Wunschknochen gebalgt.«
»Hast du dir auch mal was gewünscht? Sind deine Wünsche in Erfüllung gegangen?«
Sie schwieg eine Weile, dann sagte sie: »Ja. Ich denke, ich hatte ein schönes Leben. Ja, meine Wünsche sind wahr geworden.«
»Glaubst du, daß meine auch in Erfüllung gehen?«
»Ja, ganz bestimmt. Eines Tages wirst duʼs richtig gut haben.
Das ist eine sehr hübsche Dame, die dich immer besuchen kommt.«
»Sie ist schön«, sagte ich. »Und er ...«
»Wer ist er, Liebes?«
Ich dachte: Ich rede zuviel. Das darf ich nicht ... nicht einmal mit Matty. Ich hatte Angst darüber zu sprechen, weil ich dann womöglich entdecken würde, daß alles gar nicht wirklich geschehen war, sondern daß ich nur geträumt hatte.
»Ach niemand«, sagte ich.
»Du verbrennst den Toast Macht nichts. Kratz das Schwarze über dem Ausguß ab.«
Ich kratzte das Verbrannte vom Brot herunter und strich Butter darauf. Ich bereitete Tee und schenkte ein. Dann saß ich eine Weile und starrte in die Flammen. Das Holz glühte rot, blau und gelb. Jetzt glaubte ich sogar, das Schloß zu sehen.
Plötzlich fiel die Glut zusammen, und das Bild erlosch.
Es wurde Zeit, daß ich heimging. Sonst würde Tante Amelia mich vermissen und peinliche Fragen stellen.
Weihnachten rückte näher. Die Kinder sammelten im Wald Efeu und Stechpalmenzweige, um das Schulzimmer zu schmücken. Miss Brent stellte in ihrer Diele einen Briefkasten auf, in den wir die Karten an unsere Freunde steckten. Am Tag vor Heiligabend, dem letzten Schultag, spielte Miss Brent den Postboten; sie öffnete den Briefkasten und nahm die Karten heraus; dann setzte sie sich an ihr Pult. Sie rief uns einzeln zu sich, und wir nahmen die für uns bestimmten Karten in Empfang.
Wir waren alle sehr aufgeregt. Die Karten hatten wir im Klassenzimmer selbst gebastelt, und es gab dabei viel Geflüster und Gekicher. Wir bemalten das Papier, falteten es mit großer Geheimnistuerei zusammen, schrieben dann die Namen derjenigen, an die der Gruß gerichtet war, darauf und steckten die Karten in den Kasten.
Nachmittags sollte ein Konzert stattfinden. Miss Brent würde Klavier spielen, und wir würden alle im Chor singen; diejenigen unter uns, die eine gute Stimme hatten, sollten ein Lied vortragen, andere Gedichte aufsagen.
Es war für uns alle ein großer Tag, und wir freuten uns schon Wochen vor Weihnachten darauf.
Noch aufregender aber war für mich Miss Anabels Besuch. Sie kam am Tag vor der Schulfeier. Sie brachte mir einige Päckchen mit, auf die sie »Am Weihnachtstag öffnen« geschrieben hatte. Doch ich fand Miss Anabel selbst immer viel aufregender als ihre Mitbringsel.
»Im Frühling«, sagte sie, »machen wir wieder ein Picknick.«
Ich war begeistert »An derselben Stelle!« rief ich. »Gibt es dann auch wieder Hühnerknochen?«
»Ja«, versprach sie. »Dann darfst du dir wieder etwas wünschen.«
»Aber vielleicht erwische ich diesmal gar nicht das größere Stück vom Knochen.«
»Ich denke doch«, meinte sie lächelnd.
»Miss Anabel, kommt er ... kommt Joel auch?«
»Ich glaube schon«, sagte sie. »Du mochtest ihn gern, nicht wahr, Suewellyn?«
Ich zögerte. Gern haben war nicht ganz das richtige Wort, um es auf Götter anzuwenden.
Sie wirkte beunruhigt. »Er hat dich doch nicht ... erschreckt?« Wieder schwieg ich, und sie fuhr fort »Möchtest du ihn wiedersehen?«
»O ja«, rief ich begeistert, und sie schien zufrieden.
Ich war traurig, als die Droschke kam, um sie zum Bahnhof zu bringen, aber nicht so traurig wie sonst; denn war der Frühling auch noch weit, er würde doch gewiß kommen, und ich freute mich heute schon auf den herrlichen Ausflug in den Wald.
Onkel William hatte die Weihnachtskrippe in seinem Holzschuppen fertiggeschnitzt, und nun stand sie mit dem Abbild des Christkindes in der Kirche. Drei Jungen von der Schule sollten die drei Weisen darstellen. Einer war der Sohn des Vikars, und ich fand es ganz natürlich, daß sein Vater ihn dabeihaben wollte. Der zweite war Anthony Felton, denn er war der Enkel des Gutsherrn; seine Familie spendete großzügig für die Kirche und stellte ihre Gartenanlagen oder, wenn es regnete, die große Halle für Feste und Wohltätigkeitsbasare zur Verfügung. Tom war der dritte, weil er eine schöne Stimme hatte. Es war kaum zu glauben, daß so ein schlampiger Bengel eine so wunderbare Stimme besaß. Ich freute mich für Tom, denn es war eine Ehre für ihn. Matty war entzückt. »Sein Vater hatte eine gute Stimme. Und mein Großvater auch«, erzählte sie mir. »So was vererbt sich in der Familie.«
Tom hatte einen riesigen Stechpalmenzweig über der Heimkehr des Seemanns in Mattys Stube befestigt, was dem Bild einen nahezu heiteren Anstrich verlieh. Ich hatte die Heimkehr des Seemanns oft betrachtet; denn dies war ein Bild, das ich in Mattys Besitz eigentlich nicht vermutet hätte. Es hatte etwas Schwermütiges an sich. Aber das lag vielleicht auch daran, daß es kein farbiger Druck war. Der Seemann stand mit einem Bündel über der Schulter in der Hüttentür. Seine Frau starrte entgeistert vor sich hin, als sähe sie etwas Entsetzliches und erlebe nicht die Rückkehr eines geliebten Menschen. Matty hatte mit Tränen in den Augen über das Bild gesprochen. Seltsam, daß jemand, der sich über die Heimsuchungen des wirklichen Lebens lustig machen konnte, über die scheinbaren Probleme einer Person auf einem Bild Tränen vergoß.
Ich hatte sie bedrängt, mir die Geschichte zu erzählen. »Also«, sagte sie, »das war so: Du siehst das Bettchen mit dem kleinen Kind. Dieses Kind dürfte aber gar nicht dasein, weil der Seemann drei Jahre fort war, und sie hat das Baby bekommen, während er weg war. Das gefällt ihm nicht ... und ihr auch nicht.«
»Warum gefällt es ihm nicht? Er sollte doch froh sein, wenn er heimkommt und ein kleines Kind findet.«
»Nun, es ist eben nicht seins, und darum gefällt es ihm nicht.«
»Warum nicht?«
»Na ja, er ist – nun, sagen wir – eifersüchtig. Eigentlich waren es zwei Bilder; sie gehörten zusammen. Meine Mama hat sie aufgeteilt, als sie starb. Sie sagte, die Heimkehr ist für dich, Matty, und der Abschied ist für Emma. Emma ist meine Schwester. Sie ist nach ihrer Heirat in den Norden gezogen.«
»Und den Abschied hat sie mitgenommen?«
»Ja. Dabei hat sie sich gar nicht viel daraus gemacht. Und ich hätte so gern beide Bilder gehabt. Obwohl der Abschied sehr traurig war. Der Mann hat die Frau umgebracht, weißt du, und die Polizei holte ihn ab, um ihn aufzuhängen. Das war mit Abschied gemeint. Oh, wie gern hätte ich den Abschied auch besessen.«
»Matty«, fragte ich, »was ist aus dem kleinen Kind in dem Bettchen geworden?«
»Jemand hat es in seine Obhut genommen«, sagte sie.
»Das arme Kind! Jetzt hat es keinen Vater und keine Mutter mehr.«
Matty sagte schnell: »Tom hat mir von eurem Briefkasten in der Schule erzählt. Ich hoffe, du hast eine hübsche Karte für Tom gemacht. Er ist ein guter Junge, unser Tom.«
»Ich habʼ ihm eine ganz schöne Karte gemalt«, erwiderte ich, »mit einem Pferd.«
»Da wird er sich aber freuen. Er ist ganz vernarrt in Pferde. Wir wollen ihn zu Schmied Jolly in die Lehre geben, denn Schmiede haben schließlich viel mit Pferden zu tun.«
Meine Besuche bei Matty gingen immer viel zu schnell zu Ende. Außerdem waren sie stets davon überschattet, daß Tante Amelia zu Hause auf mich wartete.
Die Holzapfelhütte wirkte nach den Besuchen bei Matty immer besonders freudlos. Das Linoleum auf dem Fußboden war gefährlich glatt gebohnert, und an den Bildern von Christus und Sankt Stephan steckten keine Stechpalmen. Die hätten dort auch völlig deplaciert gewirkt, und die mißmutige Königin mit einem Zweig zu schmücken hätte an Majestätsbeleidigung gegrenzt.
»Dreckzeug«, hatte Tante Amelia einmal darüber geäußert.
»Rieselt bloß runter, und die Beeren treten sich überall fest.«
Der Tag der Schulfeier war gekommen. Wir stimmten unseren Gesang an, und die Begabteren unter uns – zu denen ich nicht gehörte – trugen ihre Gedichte und Lieder vor. Der Briefkasten wurde geöffnet. Von Tom bekam ich eine wunderschöne Pferdezeichnung, und auf der Karte stand geschrieben: »Fröhliche Weihnachten, immer Dein Tom Grey.« Jeder in der Schule hatte jedem eine Karte geschenkt, und das Austeilen dauerte sehr lange. Anthony Felton wollte mich mit seiner Karte wohl eher verletzen als mir gute Wünsche übermitteln. Er hatte eine Hexe gemalt, die auf einem Besenstiel ritt. Ihr offenes, dunkles Haar schien im Wind zu flattern, und sie hatte ein schwarzes Mal am Kinn. »Zauberhafte Weihnachten« hatte Anthony darauf geschrieben. Es war eine schlechte Zeichnung, und ich stellte schadenfroh fest, daß die Hexe Miss Brent wesentlich ähnlicher war als mir. Ich rächte mich mit dem Bild eines ungeheuer fetten Jungen (Anthony war nämlich ausgesprochen gefräßig und deshalb ganz schön pummelig) mit einem Plumpudding in der Hand. »Werde Weihnachten nicht zu fett, sonst kannst du nicht mehr reiten«, hatte ich dazu geschrieben, und er würde wissen, daß ich ihm das genaue Gegenteil wünschte.
Am Heiligen Abend fielen ein paar Schneeflocken, und alle hofften, sie würden liegenbleiben. Doch sie schmolzen, kaum daß sie den Boden berührten, und gingen bald in Regen über.
Ich besuchte mit Tante Amelia und Onkel William die Christmette; dieser nächtliche Ausflug hätte ein Erlebnis werden können; aber leider konnte mich nichts freuen, wenn ich zwischen meinen zwei strengen Wächtern einherschreiten und steif mit ihnen in der Kirchenbank sitzen mußte.
Ich schlief während des Gottesdienstes fast ein und war froh, als ich endlich wieder ins Bett schlüpfen konnte. Dann kam der Weihnachtsmorgen, und ich war sehr aufgeregt, obwohl es für mich keinen Weihnachtsstrumpf gab. Ich wußte, daß andere Kinder solche Strümpfe bekamen, und stellte es mir wundervoll vor, meinen Strumpf vor lauter guten Dingen ausgebeult vorzufinden und mit einer Hand hineinzufahren, um die Köstlichkeiten hervorzuziehen.
»Das ist kindisch«, sagte Tante Amelia, »und nicht gut für die Strümpfe. Du bist schon zu alt für solchen Firlefanz, Suewellyn.« Aber ich hatte ja Anabels Geschenke. Wieder war es etwas zum Anziehen – zwei Kleider, von denen eines besonders schön war. Ich hatte das blaue, das sie mir geschenkt hatte, nur ein einziges Mal getragen, und zwar als sie kam. Jetzt besaß ich noch ein zweites Seidenkleid; dazu noch ein wollenes und einen hübschen Muff aus Seehundsfell; außerdem bekam ich drei Bücher. Ich war von den Geschenken entzückt und bedauerte nur, daß Anabel nicht da war, um sie mir persönlich zu überreichen.
Von Tante Amelia erhielt ich eine Schürze und von Onkel William ein Paar Strümpfe. Das waren keine besonders aufregenden Geschenke.
Am Morgen gingen wir in die Kirche, und dann nahmen wir zu Hause das Festmahl ein. Es gab Huhn, was in mir Erinnerungen weckte, aber von Wunschknochen war nicht die Rede. Danach folgte der Plumpudding.
Am Nachmittag las ich in meinen Büchern. Der Tag wurde mir sehr lang. Wie gern wäre ich zu den Greys hinübergelaufen. Matty war zur Feier des Tages nach nebenan gegangen, und fröhlicher Lärm drang auf den Anger hinaus. Tante Amelia hörte das und meinte kopfschüttelnd, Weihnachten sei doch eigentlich ein ernstes Fest. Es sei Christi Geburtstag. Die Menschen sollten Würde zeigen und sich nicht wie die Heiden aufführen.
»Ich finde, es sollte ein Freudenfest sein«, hielt ich ihr entgegen, »gerade weil Christus geboren wurde.«
Tante Amelia sagte: »Ich hoffe nicht, daß du dir komische Ideen in den Kopf setzt, Suewellyn.«
Ich hörte sie zu Onkel William bemerken, daß es in unserer Schule alle möglichen Kreaturen gebe und es bedauerlich sei, daß Leute wie die Greys ihre Kinder zusammen mit denen aus besseren Kreisen dorthin schicken durften.
Ich hätte fast herausgeschrien, daß die Greys die besten Menschen seien, die ich kannte, doch ich wußte, daß jegliche Mühe umsonst sei, Tante Amelia davon zu überzeugen.
Der zweite Weihnachtsfeiertag war noch stiller als der erste. Es regnete, und der Südwestwind fegte über den Anger.
Es war ein endlos langer Tag. Ich konnte mich nur an meinen Geschenken ergötzen und mich fragen, wann ich wohl das Seidenkleid anziehen könnte.
Im neuen Jahr kam Anabel wieder. Tante Amelia hatte in der guten Stube Feuer gemacht – ein seltenes Ereignis – und die Jalousien hochgezogen, weil sie sich ja nun nicht mehr beklagen konnte, daß die Sonne den Möbeln schadete.
Selbst im Schein der Wintersonne sah das Zimmer immer noch recht trostlos aus. Keines der Bilder wurde durch das Licht freundlicher. Sankt Stephan blickte noch gequälter in die Stube, die Königin noch mißbilligender, und Christus hatte sich überhaupt nicht verändert.
Miss Anabel kam wie gewöhnlich kurz nach dem Mittagessen. Sie sah wunderschön aus in ihrem pelzverbrämten Mantel mit einem Muff aus Seehundsfell, der mir wie der große Bruder von meinem erschien.
Ich umarmte sie und bedankte mich für die Geschenke.
»Eines Tages«, sagte sie, »bekommst du ein Pony. Ich bestehe darauf.«