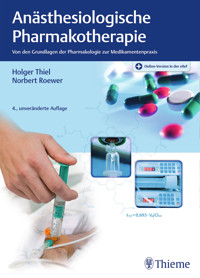64,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Taschenatlas Anästhesie bietet Ihnen alle grundlegenden und notwendigen Einblicke in das spannende Tätigkeitsfeld Anästhesie. Sie erfahren alles Wissenswerte für die präoperative Visite, die perioperative Begleitung bis zur Entlassung des Patienten aus dem Aufwachraum.
- Wie wirkt eine Narkose? Was passiert dabei im ganzen Körper?
- Was ist im Vorfeld einer Anästhesie zu beachten?
- Welche Narkosestadien gibt es und was muss man in welcher Phase besonders bedenken
- Wie muss man bei der Narkoseeinleitung- bzw. Narkoseausleitung vorgehen?
- Was muss man bei Patienten mit Begleiterkrankungen berücksichtigen?
- Welche Komplikationen können in der Anästhesie auftreten? Und wie lassen Sie sich verhindern?
Mit diesem Buch sind Sie bestens für die Herausforderungen des klinischen Alltags gerüstet!
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Taschenatlas Anästhesie
Norbert Roewer, Holger Thiel
6., aktualisierte und erweiterte Auflage
497 Abbildungen
Widmung
Dem Wahrhaftigen
Vorwort zur sechsten Auflage
Sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst!
Matthias Claudius
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir wollen Sie ermutigen – ermutigen, die Anästhesie für sich zu entdecken, und dieses Büchlein soll Ihnen ein wenig dabei helfen, die Schleier zu lüften. Vielleicht kann es Ihnen auf Ihrer „Entdeckungsreise“ ein Wegweiser und ein verlässlicher Begleiter sein.
Der Taschenatlas der Anästhesie will Ihnen einen grundlegenden, zusammenhängenden Einblick in die Anästhesie und damit in das zentrale Tätigkeitsfeld des Anästhesisten verschaffen. Wichtige Aspekte der Schmerz- und Notfalltherapie werden natürlich auch berührt, die Intensivtherapie lässt sich aber nicht angemessen darstellen, ohne das Format eines Taschenbuches zu sprengen. Der Taschenatlas der Anästhesie richtet sich vornehmlich an folgende Zielgruppen: Medizinstudenten, anästhesiologische Berufsanfänger, das anästhesiologische Fachpflegepersonal und Ärzte anderer Fachrichtungen.
Inhaltlich im Mittelpunkt steht die Erläuterung der Grundlagen der Anästhesie. Was ist Narkose? Wie entsteht sie? Was passiert dabei im Körper und in den inneren Organen? Was ist zu beachten im Vorfeld einer Anästhesie? Wie läuft eine Prämedikationsvisite ab? Welche anästhesievorbereitenden Maßnahmen sind erforderlich? Was ist bei der Narkoseeinleitung und -ausleitung, während der Operation und in der frühen postoperativen Phase zu beachten? Wie reagieren Patienten mit Begleiterkrankungen auf Narkotika? Welche Komplikationen können bei einer Anästhesie eintreten, wie lassen sie sich (meist) verhindern, und wie werden sie behandelt? Antworten auf diese Fragen (und weitere) dürfen Sie erwarten, und zwar in dem Maße, wie es nach dem gegenwärtigen Stand der medizinischen Erkenntnis möglich ist.
Während es im ersten Kapitel vor allem darum geht, was heutzutage eine Narkose ausmacht, lassen sich die darauf folgenden als eine „kleine Reise durch den Alltag der Anästhesie“ ansehen, gleichsam wie aus dem Blickwinkel eines fiktiven, zu operierenden Patienten betrachtet. Sie beginnt typischerweise mit der präoperativen Visite und endet mit seiner Entlassung aus dem Aufwachraum bzw. der perioperativen Anästhesiestation. Man muss zwar mit dem Lesen nicht unbedingt vorn beginnen, aber die Kapitel bauen aufeinander auf, d.h., das, was am Anfang erklärt wird, wird im Weiteren natürlich vorausgesetzt. Den Sprachstil haben wir übrigens versucht einfach und anschaulich zu halten, um Ihnen das Warum und Wie der Anästhesie so klar, eindeutig und einprägsam wie möglich nahezubringen.
Was ist neu in dieser Auflage? Überarbeitet, ergänzt und erweitert wurden vor allem die Abschnitte zum Flüssigkeitsersatz (u.a. balancierte Vollelektrolytlösungen), zu den Volumenersatzmitteln (Neubewertung von Hydroxyethylstärke und Gelatine), zur postoperativen Schmerztherapie (u.a. patientenkontrollierte Analgesie) und zum Monitoring (u.a. Pulskonturanalyse). Der Medikamententeil im Anhang wurde nochmals ausgebaut und an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Ganz neu hinzugekommen ist der Abschnitt „Transösophageale Echokardiografie“. Er soll Ihnen einen kurzen Überblick verschaffen über dieses während einer Anästhesie bei kardialen Risikopatienten nützliche und wichtige Monitoringverfahren und Ihr Interesse daran wecken, denn natürlich kann das Thema hier nur angerissen werden. Für die fachkompetente Mitwirkung und Unterstützung bei der Umsetzung und Veranschaulichung dieser anspruchsvollen Materie gebührt Herrn Professor Dr. Jörg Brederlau, Chefarzt der Klinik für Intensivmedizin am HELIOS Klinikum Berlin-Buch, als ausgewiesenem TEE-Experten ein besonders großes Dankeschön. – Danke, Jörg!
Bevor Ihre „Entdeckungsreise“ durch die Anästhesie nun beginnen kann, sei uns noch ein Wort in eigener Sache gestattet. Diese Auflage wird wohl die letzte sein, die noch unter dieser gemeinsamen Autorenschaft erscheint. Wir möchten uns deshalb ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Thieme-Verlages für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren bedanken. Es ist uns fernerhin ein ganz besonderes Bedürfnis, unserer Freude Ausdruck zu geben, dass dieses Buch über die Jahre hinweg solch einen großen Zuspruch bei Ihnen, den Leserinnen und Lesern, gefunden hat. Nehmen Sie dafür bitte unseren aufrichtigen Dank entgegen!
Würzburg im November 2016Norbert RoewerHolger Thiel
Vorwort zur ersten und zweiten Auflage
Das wirklich Spannende an der Anästhesie ist die enge Verzahnung von Theorie und Praxis mit Bezug zu vielen klinischen und vorklinischen Fächern. Die theoretischen Grundlagen umfassen dabei neben der Kunde der Anästhesie die Physiologie und Pathophysiologie, die Pharmakologie, die Nosologie und die anästhesiespezifischen Besonderheiten der einzelnen operativen Fachgebiete.
Die Anästhesie hat sich von ihren Anfängen, der „bloßen Narkose“, mittlerweile zu einem herausragenden Faktor in der „perioperativen Medizin“ entwickelt und hat wesentlichen Anteil an der Durchführbarkeit und dem Erfolg invasiver medizinischer Eingriffe. Das bedingt für den klinisch tätigen Anästhesisten während seiner Ausbildung neben dem Erwerb diverser praktisch-manueller Fähigkeiten die Aneignung profunder Detailkenntnisse in den oben erwähnten Teilgebieten. Hier setzt nun der vorliegende Taschenatlas an. Er ordnet und selektiert die inzwischen überbordende stoffliche Fülle des Fachgebiets Anästhesie und bereitet sie so auf, dass der theoretische Einstieg für den Anfänger erleichtert, ja erst ermöglicht wird.
In diesem Buch werden nicht nur die komplexen Grundlagen der Anästhesie Schritt für Schritt herausgearbeitet und anschaulich dargestellt, mehr noch wurde größter Wert auf eine eingehende, differenzierte Beleuchtung der für rationales Handeln wesentlichen Hintergründe gelegt – mit dem Ziel, so eine möglichst verständliche Präsentation der entsprechenden Wissensinhalte zu erreichen. Deshalb findet sich auch hier das bewährte Thieme-Prinzip der „dualen Didaktik“ wieder, das sich wie ein roter Faden durch die gesamte Reihe der Taschenatlanten zieht. Gemeint ist die enge Verknüpfung von „Wort und Bild“ auf jeweils einer Doppelseite. An dieser Stelle gebührt unser ganz besonderer Dank Jürgen Wirth für die grafische Gestaltung und mehr noch für die kreativ-konstruktive Illustration zuweilen doch recht abstrakter Inhalte. Gleichwohl kaum minder richten wir das Dankeswort an Susanne Schimmer als der Projektplanerin vom Georg Thieme Verlag für die produktiven, fast schon „mäeutischen“ Diskussionsstunden, die uns auch der Antwort auf die klassische philosophische Streitfrage näherbrachten, ob denn nun am Anfang das Wort oder das Bild war ... Mag hier die Antwort strittig sein – unstrittig war die Beibehaltung der alten Rechtschreibregelung.
Der Taschenatlas der Anästhesie richtet sich in erster Linie an Studenten und AIPs bzw. Berufsanfänger, daneben aber auch an das anästhesiologische Fachpflegepersonal sowie interessierte Ärzte anderer Fachrichtungen. Er soll diesen Leserkreisen die grundlegenden Zusammenhänge erschließen, die das Fundament eines ganzheitlichen Verständnisses der Anästhesie bilden.
Würzburg im August 2004Norbert RoewerHolger Thiel
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort zur sechsten Auflage
Vorwort zur ersten und zweiten Auflage
1 Grundlagen von Anästhesie und Narkose
1.1 Begriffsbestimmungen
1.1.1 Anästhesie
1.1.2 Kombinationsanästhesie
1.2 Eigenschaften der Narkose
1.2.1 Komponenten der Narkose
1.2.2 Dämpfung zerebraler Funktionen
1.2.3 Klinische Bedeutung
1.2.4 ZNS-Wirkungen von Anästhetika
1.3 Narkosestadien
1.3.1 Ausbreitung einer Narkose
1.3.2 Monoinhalationsanästhesie
1.3.3 Klinische Narkosestadien und korrespondierende Hirnfunktion
1.3.4 Unterschiede zwischen physiologischem Schlaf und Narkose
1.4 Topografie der Narkosewirkungen
1.4.1 Hypnose
1.4.2 Analgesie
1.4.3 Muskelrelaxation
1.5 Wirkungsmechanismen der Narkose
1.5.1 Anästhetika
1.5.2 Biophysikalische Theorie („Lipidtheorie“)
1.5.3 Biochemische Theorie („Protein- oder Rezeptortheorie“)
1.5.4 Zusammenfassung
1.5.5 Fazit der Narkosetheorien
1.6 Anästhetikagruppen und ihre typischen Wirkungsweisen
2 Präoperative Visite
2.1 Grundsätzliches und Anamnese
2.1.1 Inhalte und Ablauf
2.1.2 Prämedikationsambulanz
2.1.3 Anamnese
2.2 Voruntersuchungen
2.2.1 Systematik der klinischen Untersuchung
2.2.2 EKG
2.2.3 Radiologische Untersuchung
2.2.4 Laboruntersuchungen
2.2.5 Spezielle Untersuchungen
2.2.6 Voruntersuchungen im Notfall
2.3 Anästhesierisiko
2.3.1 Einflussfaktoren
2.3.2 Klassifizierung
2.4 Operative Dringlichkeit und Auswahl des Anästhesieverfahrens
2.4.1 Operative Dringlichkeit
2.4.2 Auswahl des Anästhesieverfahrens
2.5 Aufklärung und Einwilligung
2.5.1 Selbstbestimmungsrecht des Patienten
2.5.2 Einwilligungsfähigkeit und Aufklärungsart
2.5.3 Anästhesieaufklärung
3 Prämedikation
3.1 Prämedikationsziele und Substanzübersicht
3.1.1 Prämedikationsziele
3.1.2 Substanzübersicht
3.2 Pharmaka und Applikationsprinzipien
3.2.1 Pharmaka
3.2.2 Applikationsprinzipien
3.3 Begleitmedikation
4 Pharmakologie der Allgemeinanästhesie
4.1 Substanzgruppen und Verfahrensarten
4.1.1 Inhalationsanästhesie
4.1.2 Intravenöse Anästhesie
4.1.3 Balancierte Anästhesie
4.1.4 Künstlicher Atemweg
4.2 Inhalationsanästhetika
4.2.1 Pharmakokinetik
4.2.2 Minimale alveoläre Konzentration
4.2.3 Klinische Bedeutung der Inhalationsanästhesie
4.2.4 Stellenwert gebräuchlicher Substanzen
4.3 Hypnotika und Sedativa
4.3.1 Pharmakokinetik
4.3.2 Pharmakodynamik
4.3.3 Klinische Bedeutung der intravenösen Anästhesie
4.3.4 Stellenwert gebräuchlicher Substanzen
4.4 Opioide
4.4.1 Pharmakodynamik
4.4.2 Pharmakokinetik
4.4.3 Nebenwirkungen
4.4.4 Stellenwert der „Narkose-Opioide“
4.4.5 Opioidantagonisten
4.5 Muskelrelaxanzien
4.5.1 Pharmakodynamik
4.5.2 Pharmakologische Kenngrößen
4.5.3 Elimination der Muskelrelaxanzien
4.5.4 Interaktionen
4.5.5 Nebenwirkungen
4.5.6 Stellenwert der Muskelrelaxanzien
4.5.7 Antagonisten
5 Praxis der Allgemeinanästhesie
5.1 Anästhesievorbereitung
5.1.1 Arbeitsplatz
5.1.2 Patient
5.2 Narkoseeinleitung
5.2.1 Verfahren
5.2.2 Präoxygenierung
5.2.3 Gefahren und Komplikationen
5.2.4 Nicht-nüchtern-Einleitung
5.3 Narkoseführung
5.3.1 Maskennarkose
5.3.2 Intubationsnarkose
5.3.3 Steuerung der Narkosetiefe
5.3.4 Intraoperative Wachphänomene
5.4 Narkoseausleitung
5.4.1 Vorbereitung
5.4.2 Extubation
5.4.3 Besonderes Vorgehen
6 Künstlicher Atemweg
6.1 Masken und Atemwegshilfen
6.1.1 Gesichtsmaske
6.1.2 Atemwegshilfen
6.1.3 Kehlkopfmaske
6.2 Endotracheale Intubation
6.2.1 Indikationen
6.2.2 Abschätzen der Intubationsbedingungen
6.2.3 Endotrachealtuben
6.2.4 Hilfsmittel
6.2.5 Intubationstechniken
6.2.6 Erschwerte und fiberendoskopische Intubation
6.2.7 Intubationskomplikationen
7 Narkosebeatmung
7.1 Narkoserespiratoren
7.1.1 Bestandteile
7.1.2 Gasquellen
7.1.3 Gasdosierung
7.1.4 CO2-Absorber
7.1.5 Narkosegaselimination
7.1.6 Atemventile
7.1.7 Atemschläuche
7.1.8 Atembeutel
7.1.9 Atemfilter
7.1.10 Sekretabsauger
7.2 Narkosesysteme
7.2.1 Halbgeschlossenes System
7.2.2 Geschlossenes System
7.2.3 Halboffene Systeme
7.2.4 Offene Systeme
7.3 Beatmungsformen
7.3.1 Grundprinzipien
7.3.2 Narkosebeatmung
7.3.3 Maschinelle Beatmung
7.4 Praxis der Beatmung
7.4.1 Einstellung der Beatmung
7.4.2 Monitoring
7.5 Auswirkungen und Komplikationen der Beatmung
7.5.1 Lunge
7.5.2 Herz
7.5.3 Andere Organe
8 Gefäßzugänge
8.1 Venöse Zugänge
8.1.1 Periphervenöser Zugang
8.1.2 Zentralvenöser Katheter
8.2 Arterieller Zugang
8.2.1 Punktionsorte
8.2.2 Punktionsnadeln
8.2.3 Punktionstechnik
8.2.4 Komplikationen
8.3 Pulmonaliskatheter
8.3.1 Indikationen
8.3.2 Kathetertypen
8.3.3 Einführtechnik
8.3.4 Spezielle Komplikationen
9 Monitoring und perioperative Homöostase
9.1 Kardiopulmonale Funktion
9.1.1 Überblick
9.1.2 Oberflächen-EKG
9.1.3 Nicht invasive Blutdruckmessung
9.1.4 Pulsoxymetrie
9.1.5 Kapnometrie/-grafie
9.1.6 Zentralvenöser Druck
9.1.7 Gemischt-/zentralvenöse O2-Sättigung
9.1.8 Invasive Blutdruckmessung
9.1.9 Pulmonalkapillarer Verschlussdruck
9.1.10 Herzzeitvolumen
9.1.11 Transösophageale Echokardiografie
9.2 Zentrales Nervensystem
9.2.1 Möglichkeiten des zerebralen Monitorings
9.2.2 Zerebrale Homöostase
9.2.3 Elektrophysiologische Verfahren
9.3 Neuromuskuläre Übertragung
9.3.1 Klinische Beurteilung
9.3.2 Relaxometrie/-grafie
9.4 Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt
9.4.1 Physiologie
9.4.2 Pathophysiologie
9.4.3 Prophylaxe und Therapie
9.4.4 Gebrauch von Kolloiden
9.4.5 Primärer Volumenersatz bei ausgeprägter Hypovolämie
9.5 Säure-Base-Haushalt
9.5.1 Grundlagen
9.5.2 pH-regulierende Mechanismen
9.5.3 Überwachungsparameter
9.5.4 Störungen des Säure-Base-Haushalts
9.5.5 Therapie
9.6 Blut und Bluttransfusion
9.6.1 Rechtsgrundlage
9.6.2 Transfusionsvorbereitung und -durchführung
9.6.3 Blutkomponenten
9.6.4 Indikation für eine Bluttransfusion
9.6.5 Praxis der Transfusion
9.6.6 Massivtransfusion
9.6.7 Autologe Transfusion
9.7 Blutgerinnung
9.7.1 Grundlagen
9.7.2 Labordiagnostik
9.7.3 Häufige Gerinnungsstörungen und ihre Therapie
9.7.4 Perioperative Hämostase
9.8 Thermoregulation und Urinausscheidung
9.8.1 Thermoregulation
9.8.2 Urinausscheidung
10 Regionalanästhesien
10.1 Lokalanästhetika
10.1.1 Chemie
10.1.2 Wirkungsweise
10.1.3 Physikochemische Eigenschaften
10.1.4 Allgemeine Nebenwirkungen
10.2 Rückenmarknahe Regionalanästhesien
10.2.1 Anatomische Grundlagen
10.2.2 Methodische Grundlagen
10.2.3 Spinalanästhesie
10.2.4 Epiduralanästhesie
10.3 Plexus-brachialis-Anästhesie
10.3.1 Anatomische Grundlagen
10.3.2 Methodische Grundlagen
10.3.3 Axilläre Blockade
10.3.4 Vertikale infraklavikuläre Blockade
10.3.5 Interskalenäre Blockade
11 Operationslagerung
11.1 Lagerungsformen
11.1.1 Rückenlage
11.1.2 Bauchlage
11.1.3 Seitenlage
11.1.4 Steinschnittlage
11.1.5 Sitzende Position
11.1.6 Physiologische Veränderungen
11.2 Lagerungsschäden
11.2.1 Nervenschäden
11.2.2 Prävention und Therapie von Nervenschäden
12 Bedeutung häufiger Begleiterscheinungen
12.1 Lunge
12.1.1 Nosologie
12.1.2 Präoperative Diagnostik und Behandlung
12.1.3 Perioperative Komplikationen
12.1.4 Anästhesiologisches Vorgehen
12.2 Herz und Kreislauf
12.2.1 Arterielle Hypertonie
12.2.2 Koronare Herzkrankheit
12.2.3 Herzinsuffizienz
12.2.4 Herzrhythmusstörungen
12.2.5 Präoperative Diagnostik und ihr Stellenwert
12.2.6 Anästhesiologisches Vorgehen
12.3 Chronische Niereninsuffizienz
12.3.1 Ursachen und Einteilung
12.3.2 Auswirkungen und ihre perioperative Bedeutung
12.3.3 Perioperative Einflüsse auf die Nierenfunktion
12.3.4 Anästhesiologisches Vorgehen
12.4 Leber
12.4.1 Präoperative Diagnostik
12.4.2 Leberzirrhose
12.4.3 Perioperative Einflüsse auf die Leberfunktion
12.4.4 Anästhesiologisches Vorgehen
12.5 Stoffwechsel und Endokrinium
12.5.1 Ernährungsstörungen
12.5.2 Diabetes mellitus
12.5.3 Erkrankungen der Schilddrüse
12.5.4 Erkrankungen der Nebennieren
12.5.5 Akromegalie
12.6 Nervensystem und Muskulatur
12.6.1 Zerebraler Insult
12.6.2 Zerebrales Anfallsleiden (Epilepsie)
12.6.3 Morbus Parkinson
12.6.4 Myasthenia gravis
13 Komplikationen in der Anästhesie
13.1 Einführung und Überblick
13.2 Respiratorisches System
13.2.1 Laryngospasmus und Larynxödem
13.2.2 Akute bronchiale Obstruktion
13.2.3 Atelektasen
13.2.4 Pneumothorax
13.2.5 Pleuraerguss
13.2.6 Pleurapunktion und Pleuradrainage
13.2.7 Pneumomediastinum
13.2.8 Lungenödem
13.3 Herz-Kreislauf-System
13.3.1 Pathophysiologie
13.3.2 Myokardischämie und Myokardinfarkt
13.3.3 Linksherzdekompensation
13.3.4 Lungenembolie
13.3.5 Perikardtamponade
13.3.6 Herzrhythmusstörungen
13.3.7 Hypovolämischer Schock
13.3.8 Hämodynamische Therapie
13.4 Unverträglichkeitsreaktionen
13.4.1 Mechanismen
13.4.2 Symptomatik
13.4.3 Therapie
13.4.4 Prophylaxe
13.4.5 Latexallergien
13.5 Verzögertes Aufwachen aus der Narkose
13.5.1 Ursachen
13.5.2 Prophylaxe, Diagnose und Therapie
13.6 Maligne Hyperthermie
13.6.1 Epidemiologie
13.6.2 Pathophysiologie
13.6.3 Symptomatik der MH-Krise
13.6.4 Therapie der MH-Krise
13.6.5 Anästhesie bei MH-Disposition oder MH-Verdacht
14 Postoperative Versorgung
14.1 Aufwachraum
14.1.1 Funktionen
14.1.2 Organisation
14.1.3 Allgemeine Maßnahmen
14.2 Monitoring
14.2.1 Überblick
14.2.2 Einzelne Maßnahmen
14.3 Komplikationen
14.3.1 Respiratorisches System
14.3.2 Herz-Kreislauf-System
14.3.3 Zentrales Nervensystem
14.3.4 Übelkeit und Erbrechen
14.3.5 Spezielle chirurgische Aspekte
14.4 Schmerztherapie
14.4.1 Postoperativer Wundschmerz
14.4.2 Möglichkeiten der Schmerztherapie
14.4.3 Analgetika
14.4.4 Patientenkontrollierte Analgesie
14.5 Patientenverlegung
14.5.1 Verlegung auf eine Allgemeinstation
14.5.2 Verlegung auf eine Intensivstation
14.5.3 Entlassung nach ambulanten Operationen
15 Kardiopulmonale Reanimation
15.1 Kreislaufstillstand
15.1.1 Wiederbelebungszeit
15.1.2 Primärer Kreislaufstillstand
15.1.3 Sekundärer Kreislaufstillstand
15.1.4 Diagnose
15.2 Basismaßnahmen
15.2.1 Universalalgorithmus
15.2.2 Externe Herzmassage
15.2.3 Beatmung
15.2.4 Verhältnis Herzmassage zu Beatmung
15.3 Erweiterte Maßnahmen
15.3.1 Endotracheale Intubation
15.3.2 Venöser Zugang
15.3.3 Pharmakotherapie
15.3.4 Elektrotherapie
15.4 Verlauf und Prognose
15.4.1 Irreversibler Herztod
15.4.2 Erfolgreiche Reanimation
15.4.3 Nachbehandlung
16 Anhang
16.1 Tabellen und Formeln
16.2 Normalwerte anästhesiologisch wichtiger Daten
16.3 Kurzprofil anästhesiologisch wichtiger Medikamente
16.4 Zeittafel zur Geschichte der Anästhesie
16.5 Abkürzungsverzeichnis
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
1 Grundlagen von Anästhesie und Narkose
1.1 Begriffsbestimmungen
1.1.1 Anästhesie
Der Begriff „Anästhesie“ leitet sich vom griechischen „αναισθησια“ ab, was soviel bedeutet wie „Unempfindlichkeit eines Organismus“ oder „Empfindungslähmung“. Man versteht darunter die Aufhebung sämtlicher peripherer Sinnesqualitäten wie Berührungs-, Tast-, Temperatur- und Schmerzempfinden. Der Teil- oder Unterbegriff „Analgesie“ bezeichnet dagegen lediglich die Schmerzlosigkeit.
Im Zentrum der anästhesiologischen Tätigkeit steht, allgemein gesagt, die Ermöglichung schmerzloser Eingriffe in die Körperintegrität. Hierbei handelt es sowohl um die klassischen, d.h. offenen Operationen als auch um die sog. minimalinvasiven (videoassistierten) Eingriffe, daneben um invasive diagnostische Maßnahmen und zunehmend um interventionelle Eingriffe, also solche, die mithilfe bildgebender (radiologischer) Verfahren durchgeführt werden. Das anästhesiologische Hauptziel bei derartigen Eingriffen, die Schmerzfreiheit, kann grundsätzlich auf zweierlei Art erreicht werden ( ▶ Abb. 1.1):
mit der klassischen Narkose oder
mit einer Regionalanästhesie.
Synonym für „Narkose“ steht semantisch die Allgemeinanästhesie. Sie unterscheidet sich von den regionalanästhesiologischen Methoden unter anderem durch die Ausschaltung des Bewusstseins.
Eine Allgemeinanästhesie umfasst die Anästhesie des gesamten Körpers. Sie geht immer mit der Aufhebung, zumindest aber mit einer deutlichen Einschränkung des Bewusstseins einher. Der hierfür umgangssprachlich benutzte Begriff „Vollnarkose“ ist ein Pleonasmus und sollte deshalb in der Fachsprache nicht angewendet werden. Für eine Allgemeinanästhesie können
inhalative, d.h. über die Lungen zugeführte Gase oder
intravenöse, d.h. in Wasser gelöste Stoffe
eingesetzt werden. Sie alle haben ihre Hauptwirkorte im zentralen Nervensystem (ZNS: Gehirn und Rückenmark). Begrifflich werden die
Inhalations-,
intravenöse und
balancierte Anästhesie
voneinander unterschieden, wobei unter einer balancierten Anästhesie der kombinierte Einsatz von Inhalations- und intravenösen Anästhetika verstanden wird. Da eine Allgemeinanästhesie stets zu einer Beeinträchtigung oder Ausschaltung der Atemtätigkeit führt, werden hierbei künstliche Atemwegshilfen und außerdem maschinelle Systeme benötigt, die die Atmung unterstützen oder ersetzen.
Bei einer Regional- oder Lokalanästhesie kann die Anästhesie auf bestimmte Körperareale begrenzt werden („topische Anästhesie“). Man unterscheidet folgende Formen:
rückenmarknahe Regionalanästhesien (=zentrale Nervenblockaden: Spinalanästhesie, Epi- oder Periduralanästhesie, Kaudal- oder Sakralanästhesie)
periphere Nervenblockaden (z.B. Anästhesie des Plexus brachialis, Anästhesie einzelner Nerven)
Infiltrationsanästhesie (z.B. sub- oder intrakutan)
Oberflächenanästhesie (z.B. epikutane Anästhesie, Schleimhautanästhesie)
Bei all diesen Verfahren werden spezielle Wirkstoffe, die sog. Lokalanästhetika, nicht systemisch (z.B. inhalativ oder intravenös) appliziert, sondern – abgesehen von der Oberflächenanästhesie – in die unmittelbare Nähe von nervalen Strukturen injiziert, um dort die Erregungsentstehung und -fortleitung selektiv auszuschalten. Bewusstsein und Spontanatmung bleiben so erhalten. Rückenmarknahe Regionalanästhesien und Plexus-brachialis-Anästhesien liegen – wie die Allgemeinanästhesie – ausschließlich in der Hand des Anästhesisten.
Anästhesieverfahren.
Abb. 1.1
1.1.2 Kombinationsanästhesie
Unter gewissen Umständen oder bei bestimmten Eingriffen können Allgemein- und Regionalanästhesieverfahren auch vorteilhaft miteinander kombiniert werden („Kombinationsanästhesie“) ( ▶ Abb. 1.2). Ein solches Vorgehen empfiehlt sich besonders dann, wenn Regionalanästhesiekatheter als Bestandteil eines gesamtheitlichen perioperativen Anästhesiekonzepts postoperativ zur selektiven Analgesie genutzt werden sollen. Die Kombinationsanästhesie muss semantisch von der Kombinationsnarkose abgegrenzt werden. Unter letzterer versteht man die gemeinsame Verwendung zentral wirksamer Pharmaka, z.B.
i. v. Hypnotikum zur Narkoseeinleitung und Inhalationsanästhetikum zur Aufrechterhaltung
i. v. Hypnotikum zur Bewusstseinsausschaltung, Opioid zur Analgesie und Relaxans zur Muskelerschlaffung
Kombinationsanästhesie.
Abb. 1.2
1.2 Eigenschaften der Narkose
Unter „Narkose“ (Syn.: Allgemeinanästhesie) versteht man eine zur Durchführung operativer, diagnostischer oder interventioneller Eingriffe pharmakologisch induzierte, reversible Verminderung der Aktivität des ZNS. Im Vordergrund steht dabei die komplette Aufhebung der Sinneswahrnehmung.
1.2.1 Komponenten der Narkose
Der Zustand der Narkose ist geprägt durch den Verlust des Bewusstseins(Hypnose) und der Schmerzwahrnehmung(Analgesie). Für die Dauer der Hypnose und in der Regel noch für einige Zeit danach ist die Wahrnehmung blockiert, sodass die Erinnerung fehlt (anterograde Amnesie). Meist geht aber auch die Erinnerung an Sinneseindrücke verloren, die in die Phase unmittelbar vor Eintritt der Hypnose fallen(retrograde Amnesie). Mit der Analgesie verschwinden nicht nur die willkürlichen, sondern auch die unwillkürlichen Schmerzreaktionen (Reflexe). Durch die Unterdrückung der Reflexaktivität werden Abwehrbewegungen verhindert, der Skelettmuskeltonus wird vermindert, das vegetative Nervensystem gedämpft (vorrangig Sympathikushemmung). In tieferen Narkosestadien kommt es dann zu einer wirklichen Erschlaffung (Relaxation) der Skelettmuskulatur, in diesem Fall hervorgerufen durch eine Hemmung der motorischen Aktivität auf Rückenmarkebene ( ▶ Abb. 1.3).
Komponenten der Narkose.
Abb. 1.3
1.2.2 Dämpfung zerebraler Funktionen
Die Narkose ist das Ergebnis einer generalisierten Dämpfung der Aktivität des ZNS. Sie kann durch Pharmaka unterschiedlichster chemischer Struktur und Herkunft erzeugt werden ( ▶ Abb. 1.4). Die Vorstufen sind dieSedierung, ein Zustand psychomotorischer Indifferenz, in dem Schlaf ermöglicht wird, der Patient aber ansprechbar oder weckbar bleibt, und dieHypnose, ein Zustand erzwungenen Schlafs, während dessen der Patient nicht mehr durch äußere Reize geweckt werden kann ( ▶ Abb. 1.5). Beiden Zuständen fehlt im Unterschied zur Narkose die somatische Komponente der Analgesie. Durch eine Sedierung wird der psychische, angstbezogene Schmerzanteil ausgeschaltet („der Schmerz tut nicht mehr so weh“), durch eine Hypnose geht auch das an das Bewusstsein gekoppelte Schmerzempfinden verloren. Schmerzinduzierte Abwehrbewegungen und Kreislaufreaktionen können aber in beiden Fällen weiterhin auftreten. Sedierung oder Hypnose lässt sich sowohl durch spezifisch wirkende Substanzen herbeiführen als auch durch Narkotika im engeren Sinn. Narkotika wirken nämlich dosisabhängig und erzeugen zunächst Sedierung, dann Hypnose und schließlich Narkose, wobei die Übergänge fließend sind. Umgekehrt gilt dies allerdings nicht, d.h., reine Sedativa oder Hypnotika haben keine narkotische Wirkung! Die Fähigkeit gewisser Stoffe, eine Narkose auszulösen, ist also in erster Linie eine Substanzeigenschaft.
Narkotika zur Dämpfung zerebraler Funktionen.
Abb. 1.4
Dämpfung des Bewusstseins.
Abb. 1.5
1.2.3 Klinische Bedeutung
Die erforderliche Intensität einer Narkose hängt vom Ausmaß der (chirurgischen) Stimulation des „Schmerzapparates“ (nozizeptives System) ab. Da sich während einer Operation unterschiedlich schmerzhafte Phasen miteinander abwechseln, muss eine Narkose vom Anästhesisten dynamisch gesteuert werden.
Rückblick Bis weit ins 20. Jahrhundert konnten Narkosen jeweils nur mit einer Substanz durchgeführt werden. Für diese „Mononarkosen“ ( ▶ Abb. 1.6) standen ausschließlich Inhalationsanästhetika zur Verfügung: anfangs „Äther“ (Diethylether), Chloroform und Lachgas. Da Chloroform aber zu toxisch und Lachgas nicht potent genug war, wurden sie rasch durch Äther verdrängt, der dann lange Zeit das Narkosemittel schlechthin blieb. Die erste öffentlich demonstrierte (und auch publizierte) Narkose war eine Äthernarkose, 1846 von W. T. G. Morton in Boston vorgenommen. Doch auch Äther war alles andere als frei von Nebenwirkungen. Neben der Tatsache, dass er zusammen mit Luft ein explosibles Gasgemisch bildet, ist die Einschlaf- und Aufwachphase mit einer ausgeprägten, lang dauernden Exzitation belastet. Äther reizt stark die Schleimhäute (→ Hustenanfälle, vermehrte Schleimsekretion) und ist ausgesprochen emetogen (→ Übelkeit und Erbrechen). Zudem sind – typisch für eine Mononarkose – z.T. sehr hohe Dosen zum Unterdrücken der Abwehrreflexe und zum Erreichen einer adäquaten Muskelrelaxation nötig (→ Atem- und Kreislaufstörungen).
Klinische Bedeutung der Narkose.
Abb. 1.6
Aus heutiger Sicht unvorstellbar, aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts gängige Praxis war die Durchführung großer Oberbaucheingriffe, z.B. der Billroth-Operationen, in Äthertropfnarkose am nicht intubierten, spontan atmenden Patienten. Auf einem Drahtgestell, das Mund und Nase überspannte, befand sich eine Gaze, auf die Äther geträufelt wurde ( ▶ Kap.7.2). Er verdunstete und der Patient atmete ätherangereicherte Raumluft ein. Die Narkosetiefe wurde ausschließlich anhand klinischer Zeichen bestimmt ( ▶ Kap.1.3), den EKG-Monitor gab es noch nicht, eine Blutdruckmessung war noch nicht üblich. Schnell wird einem klar, dass nur kardiopulmonal Gesunde in gutem Allgemeinzustand größere Operationen in Narkose ohne Komplikationen überstehen konnten. Höheres Lebensalter galt damals als Ausschlusskriterium, wobei das bereits für den etwa 50-Jährigen galt.
Moderne Narkose Zur Verminderung von Nebenwirkungen werden bei der modernen Narkose verschiedenartig wirkende Pharmaka wie Sedativa oder Hypnotika, Opioide und Muskelrelaxanzien miteinander kombiniert ( ▶ Abb. 1.6). Auf diese Weise lassen sich die Teilqualitäten der Narkose selektiv verwirklichen („Kombinationsnarkose“). Von den ursprünglichen Inhalationsanästhetika wird heute nur noch Lachgas (Distickstoff[mon]oxid, Stickoxydul, N2O) verwendet, was auf seiner guten analgetischen Wirkung beruht. Äther und Chloroform sind dagegen durch neuere dampfförmige (=volatile) Substanzen, wie z.B. Isofluran oder Sevofluran, ersetzt worden. Diese sind deutlich besser verträglich und zudem nicht explosibel. Volatile Anästhetika zeichnen sich durch gute hypnotische Eigenschaften aus, während die analgetische Komponente um einiges geringer ausfällt. Sie werden daher in der Regel zusammen mit N2O und intravenösen Substanzen verabreicht („balancierte Anästhesie“).
1.2.4 ZNS-Wirkungen von Anästhetika
Im Gegensatz zu den volatilen Anästhetika kann die narkotische Wirkung von N2O klinisch nicht genutzt werden. Die maximal mögliche Beimischung zum Atemgas ist auf 79% begrenzt, damit ein minimaler inspiratorischer Sauerstoffanteil (FIO2) von 21% (bzw. 0,21 als „Fraktion“) gewährleistet bleibt. In der Praxis wird allerdings aus Sicherheitsgründen eine FIO2 von 0,3 nicht unterschritten und ein N2O-Anteil von 0,7 nicht überschritten. In dieser Konzentration wirkt N2O analgetisch und meist nur sedierend; es führt aber nicht sicher zu einer Bewusstseinsausschaltung.
Das Edelgas Xenon ist in einer Konzentration von ca. 70% anästhetisch wirksam, es erzeugt Hypnose und Analgesie. Dem Vorteil der chemischen Inertheit stehen jedoch als Nachteile die geringe Verfügbarkeit und die hohen Kosten gegenüber.
Barbiturate werden in der Regel nur als Hypnotika eingesetzt, weil höhere, narkotisch wirksame Dosen eine zu starke Kreislaufdepression hervorrufen. In subanästhetischer Dosierung können sie die Schmerzempfindung sogar verstärken („Hyperalgesie“).
Propofol undEtomidat sind keine Narkotika! Sie wirken sedierend und in höherer Dosis hypnotisch; eine Analgesie im Sinne einer Unterdrückung der willkürlichen und unwillkürlichen Schmerzreaktionen gelingt jedoch mit diesen Substanzen nicht.
Während die meisten oral angewendeten Benzodiazepine nur anxiolytisch und sedierend wirken, ist mit Midazolam oder Flunitrazepam bei intravenöser Applikation auch ein hypnotischer Effekt zu erzielen. Diese beiden Substanzen eignen sich daher zur Einleitung einer Narkose, wobei Midazolam wegen seiner deutlich kürzeren Wirkung bevorzugt wird.
Ketamin hat eine Sonderstellung. Es bewirkt weniger eine Dämpfung des Bewusstseins als vielmehr eine Veränderung der Bewusstseinsinhalte (z.B. Halluzinationen) und gilt daher im engeren Sinne nicht als Hypnotikum oder Narkotikum. Man kann sich aber die guten analgetischen Eigenschaften von Ketamin zunutze machen, indem man es mit einem Sedativum oder Hypnotikum, meist Midazolam, kombiniert.
Die hypnotische Wirkung von Opioiden kommt nur in sehr hoher Dosierung zum Tragen und ist daher klinisch kaum von Bedeutung. Früher wurde Fentanyl mit hochdosiertem Droperidol, einem Neuroleptikum aus der Gruppe der Butyrophenone, kombiniert („Neuroleptanalgesie“). Da allerdings auch so das Bewusstsein nicht sicher auszuschalten war und nicht selten Nebenwirkungen, vor allem Bewegungsstörungen, auftraten, wird dieses Verfahren schon lange nicht mehr angewendet. Statt mit Droperidol oder anderen Neuroleptika werden Opioide heute gemeinsam mit intravenösen Hypnotika („total intravenöse Anästhesie“) oder Inhalationsanästhetika („balancierte Anästhesie“) eingesetzt, wodurch das Bewusstsein verlässlich unterdrückt wird ( ▶ Abb. 1.7).
ZNS-Wirkungen von Anästhetika.
Abb. 1.7
1.3 Narkosestadien
Narkotika wirken nicht isoliert auf das ZNS, sondern beeinflussen grundsätzlich alle Zellen des Organismus. Hirnzellen reagieren jedoch am empfindlichsten, sodass narkotische Wirkungen in der Regel vor relevanten Störungen der Funktion anderer Organe auftreten. Doch auch unter den Hirnzellen bzw. Zellverbänden bestehen Unterschiede in der Empfindlichkeit auf Narkosemittel, was im Folgenden detailliert erläutert wird und was es ermöglicht, die Entwicklung einer Narkose in verschiedene Stadien einzuteilen.
1.3.1 Ausbreitung einer Narkose
Als erstes werden die Zellen der Großhirnrinde (zerebraler [Neo-]Kortex) in ihrer Aktivität gehemmt (Stadium I), dann die in subkortikalen Arealen (Stadium II), danach die des Rückenmarks (Stadium III) und zuletzt die der vegetativen Steuerzentren im Hirnstamm (Stadium IV) ( ▶ Abb. 1.8). So ist gewährleistet, dass die lebenswichtigen Mechanismen der Atem- und Kreislaufregulation auch in tiefer Narkose erhalten bleiben. Es lässt sich als Regel erkennen, dass die entwicklungsgeschichtlich jüngsten, endständigen neuronalen Strukturen (Großhirn [Telenzephalon] mit Neokortex) am empfindlichsten auf Narkotika reagieren, während sich die älteren und ältesten, tiefer gelegenen Zellformationen deutlich resistenter verhalten (z.B. Zwischenhirn [Dienzephalon], Mittelhirn [Mesenzephalon], Hinterhirn [Metenzephalon]; verlängertes Rückenmark [Myelenzephalon oder Medulla oblongata]).
Die unterschiedliche Narkotikaempfindlichkeit der einzelnen Hirnanteile korrespondiert auch mit der ebenfalls unterschiedlichen Stoffwechselrate. So ist der als Gradmesser der metabolischen Aktivität fungierende Sauerstoffverbrauch in den (neo-)kortikalen Zellen am höchsten und in den pontinomedullären Zellen (Hirnstamm) am geringsten. Dies lässt den Rückschluss zu, dass Narkotika ihre zellulären Wirkungen am besten in den Geweben mit dem höchsten Energiebedarf entfalten können. Aus der Reihenfolge der von kortikal nach medullär fortschreitenden Ausschaltung zentralnervöser Strukturen lässt sich eine Narkose in Stadien einteilen, und jedes Stadium lässt sich grob dem Ausfall bestimmter Regionen des ZNS zuordnen (→ „Topografie der Narkosewirkungen“).
Ausbreitung einer Narkose.
Abb. 1.8
1.3.2 Monoinhalationsanästhesie
Die einzelnen Narkosestadien sind nur bei einer Monoinhalationsanästhesie deutlich voneinander zu unterscheiden ( ▶ Abb. 1.9). Sie werden sowohl beim Anfluten als auch (in umgekehrter Reihenfolge) beim Abfluten des Anästhetikums durchlaufen (Narkoseeinleitung und -ausleitung). Die Übergänge von einem Stadium ins nächste sind eigentlich fließend – die im Folgenden vorgenommene Einteilung in diskrete Stufen hat klinisch-pragmatische und an dieser Stelle auch didaktische Gründe.
Die exakte Differenzierung der Narkosestadien anhand klinischer Symptome geht auf Guedel zurück. Das von ihm zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte Schema gilt streng genommen allerdings nur für die Mononarkose mit Diethylether. Außerdem berücksichtigt es nicht die Einflüsse der Narkose auf die Herz-Kreislauf-Funktion. Zum damaligen Zeitpunkt war nämlich die EKG- und Blutdrucküberwachung wegen fehlender technischer Voraussetzungen klinisch noch nicht etabliert oder wurde in ihrer Bedeutung noch nicht richtig eingeschätzt. So standen zur Beurteilung der Narkosetiefe die klinisch gut zu beobachtenden Veränderungen der Spontanatmung ganz im Vordergrund, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Spontanatmung bis in tiefe Narkosestadien zumindest in abgeschwächter Form, zuletzt als reine Zwerchfellatmung, aufrechterhalten bleibt (s.u.). Daneben wurden die typischen Auswirkungen der Narkose auf die Augenmotorik und die Pupillenweite sowie der allmähliche Ausfall bestimmter Hirnnervenreflexe als Kriterien für die Narkosetiefe herangezogen. Noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war es in Deutschland alltägliche Praxis, große Oberbaucheingriffe wie die Billroth-Operationen in tiefer Äthermononarkose am nicht intubierten, spontan atmenden Patienten auszuführen ( ▶ Kap. 1.2).
Bei den modernen Allgemeinanästhesien mit Einleitung durch intravenöse Substanzen werden die einzelnen Stadien der Narkose zwar prinzipiell genauso durchlaufen; dies geht in der Regel jedoch zu rasch, als dass es klinisch gleichermaßen beobachtet werden könnte.
Monoinhalationsanästhesie.
Abb. 1.9 Zeichen der Narkosetiefe nach Guedel.
1.3.3 Klinische Narkosestadien und korrespondierende Hirnfunktion
Im Stadium I wird nur die kortikale Schmerzwahrnehmung herabgesetzt, genauer gesagt geht der angstbesetzte Schmerzcharakter verloren („Anxiolyse“) und die Fähigkeit zur Identifizierung von Schmerzen (das Erkennen des Schmerzes als Schmerz) verschlechtert sich. Die irreführende Bezeichnung als Stadium der Analgesie hat historische Gründe und geht auf die ersten Zahnextraktionen unter Lachgasinhalation im 19. Jahrhundert zurück. Der eigentliche, d.h. der somatische Schmerz bleibt erhalten und dementsprechend laufen auch die subkortikal verschalteten Schmerzantworten des Organismus, die Schmerzreaktionen und -reflexe, unbewusst weiter ab. Mit dem Eintritt der Bewusstlosigkeit folgt der Übergang ins zweite Stadium, erkennbar daran, dass der Patient nicht mehr auf Ansprache reagiert und beim Berühren der Augenwimpern kein Lidreflex mehr auslösbar ist.
Kortikale und subkortikale neuronale Netze sind so miteinander verbunden, dass wechselseitig aktivierende und hemmende Impulse gleichzeitig verarbeitet und integriert werden müssen. Im Wachzustand dominiert der hemmende Einfluss des Kortex auf tiefer gelegene Hirnschichten. Dieser Einfluss entfällt im Exzitationsstadium (Stadium II). Mit der Ausschaltung der kortikalen Aktivität können nun die aktivierenden Impulse aus dem Subkortex ungefiltert auf die somatischen und vegetativen Hirnzentren Einfluss nehmen, was sich in typischen klinischen Symptomen äußert ( ▶ Abb. 1.10). Das Exzitationsstadium geht mit einer potenziellen Gefährdung des Patienten einher und gilt deshalb als die kritische Narkosephase.
Herausragendes Charakteristikum des sich daran anschließendenToleranzstadiums (Stadium III) ist die somatische Analgesie. Erst hiermit wird die Durchführung chirurgischer Eingriffe ohne störende Abwehrbewegungen möglich. Deswegen ist das Toleranzstadium das eigentlich angestrebte Narkosestadium. Es wird, was heutzutage aber keine praktische Bedeutung mehr hat, in ein sog. Planum 1 – 4 unterteilt. Maßgeblich dafür ist eine zunehmende Automatisierung der Atemtätigkeit, die schließlich unabhängig vom Einfluss äußerer Reize abläuft. Außerdem nimmt als Folge einer Hemmung der Vorderhornzellaktivität im Rückenmark der Skelettmuskeltonus ab, wodurch zwar einerseits das operative Vorgehen in der Körpertiefe erleichtert wird (z.B. Verlust der Bauchdeckenspannung für abdominale Eingriffe), andererseits aber eine fortschreitende Lähmung der Atemmuskulatur ausgelöst wird. So besteht im Planum 3 nur noch eine reine Zwerchfellatmung, die Atemhilfsmuskulatur aber ist bereits vollständig erschlafft.
Das Intoxikationsstadium (Stadium IV) schließlich beginnt mit dem Stillstand der Atmung (periphere Atemlähmung als Folge des Ausfalls der Zwerchfellmuskulatur). Zusammen mit der zentral bedingten Aufhebung des Gefäßtonus (Vasoparalyse oder Vasoplegie) mündet dies in einen hypoxisch-ischämischen Zusammenbruch auch der Herztätigkeit.
1.3.4 Unterschiede zwischen physiologischem Schlaf und Narkose
Der Zustand des physiologischen Schlafs unterscheidet sich ganz erheblich von dem der Narkose ( ▶ Abb. 1.11). Entscheidend ist, dass in Narkose die elektrische Aktivität des Gehirns fast völlig zum Erliegen kommt, während im Schlaf lediglich der kortikale Anteil gedrosselt wird. Der Funktionsstoffwechsel der Hirnzellen ist in tiefer Narkose aufgehoben und es bleibt nur noch der zum Überleben unbedingt nötige Strukturstoffwechsel übrig. Das hat – ähnlich wie beim tiefen Koma – zur Folge, dass keine äußeren Sinneseindrücke mehr wahrgenommen oder verarbeitet werden können; potenzielle Weckreize verlieren also ihre Wirksamkeit. Der Verlust des Skelettmuskeltonus führt im Falle der Mundbodenmuskulatur dazu, dass die Zunge in Rückenlage nach hinten fällt und die oberen Atemwege verlegt (→ Erstickungsgefahr). Dies und der Ausfall der Schutzreflexe lassen die Narkose zu einem potenziell lebensbedrohlichen Zustand werden, was eine Sicherung und Überwachung der Vitalfunktionen durch geeignete Maßnahmen unentbehrlich macht.
Klinische Narkosestadien und korrespondierende Hirnfunktion.
Abb. 1.10
Unterschiede zwischen physiologischem Schlaf und Narkose.
Abb. 1.11
1.4 Topografie der Narkosewirkungen
Die Hauptbestandteile einer Narkose,
Hypnose,
Analgesie und
Muskelrelaxation,
sind das Ergebnis eines pharmakologischen Eingriffs in unterschiedliche Regionen und Strukturen des zentralen Nervensystems.
1.4.1 Hypnose
Neurophysiologisch ist nach wie vor nicht genau geklärt, auf welche Weise in neuronalen Netzen Bewusstsein im Sinne von Wachheit (=Wachbewusstsein [nicht zu verwechseln mit dem Ich-Bewusstsein]) entsteht. Gesicherte Erkenntnis ist allerdings, dass das Wachbewusstsein kein Zustand per se ist, der sich einem einzelnen, klar abzugrenzenden Hirnanteil zuordnen ließe, sondern in überaus komplexer Weise von der kontinuierlichen Aktivierung des assoziativen Kortex durch subkortikale Afferenzen abhängt. Darüber hinaus können kortikale Neuronenfelder über rückgekoppelte Verbindungen mit subkortikalen Zellverbänden ihren eigenen Aktivitätszustand aber auch selbst beeinflussen. Das Wachbewusstsein entwickelt sich also aus speziellen Interaktionen verschiedener Zentren im Gehirn und könnte als das Resultat eines dynamischen Gleichgewichts zwischen kortikalem Input und Output aufgefasst werden.
Schlaf entsteht, mechanistisch betrachtet, durch direkte oder indirekte Ausschaltung des Neokortex. Hierbei können zwei Arten des Schlafs unterschieden werden:
der physiologische Schlaf (z.B. „Nachtschlaf“) und
der artifizielle, d.h. pharmakologisch induzierte Schlaf („Hypnose“)
Die indirekte schlaferzeugende Wirkung kommt durch eine Hemmung afferenter Bahnen in den medialen Kerngebieten der Formatio reticularis zustande („retikulärer Schlaf“). Auf diese Weise wird der Fluss von Signalen zum Kortex reduziert. Die Formatio reticularis zieht sich als neuronales Netz durch den gesamten Hirnstamm und bestimmt unter anderem den kortikalen Aktivitätszustand und damit den Wachheits- oder Vigilanzgrad („aufsteigendes retikuläres aktivierendes System“). Sie ist maßgeblich an der Steuerung des physiologischen Schlaf-wach-Rhythmus beteiligt. Eine Zerstörung der Formatio reticularis, z.B. durch Trauma, führt zu einem Bewusstseinsverlust, d.h. zum Koma. In dieses System greifen auch die Sedativa, Hypnotika und Narkotika ein. Sie unterbinden die Fortleitung der aufsteigenden „Weckimpulse“ in unterschiedlicher Ausprägung („Deafferenzierung“). Im Unterschied zu Sedativa können Hypnotika und Narkotika das Bewusstsein aber auch durch eine direkte Wirkung auf den Kortex ausschalten („kortikaler Schlaf“). Im Gegensatz zum kortikalen Schlaf, der auf einer Suppression der Informationsverarbeitung beruht, entsteht der physiologische Schlaf immer retikulär durch Unterdrückung der Informationsweiterleitung. Für den Zeitraum des artifiziellen Schlafs besteht in der Regel eineAmnesie, d.h. äußere Reize gelangen nicht mehr bis ins Bewusstsein und entziehen sich so der Erinnerung. Die Amnesie ist integraler Bestandteil einer Narkose ( ▶ Abb. 1.12).
Narkosewirkungen: Hypnose.
Abb. 1.12
1.4.2 Analgesie
Schmerzen sind Ausdruck eines für den Organismus potenziell bedrohlichen Eingriffs in die körperliche Integrität und erfüllen von Natur aus eine Warnfunktion. Phylogenetisch hat sich ein fein abgestimmtes System herausgebildet, das die Schmerzleitung, die Schmerzverarbeitung und die Schmerzantwort umfasst („nozizeptives System“).
Der Schmerz durchläuft auf seinem afferenten Weg von den peripheren Schmerzrezeptoren zum Kortex, d.h. bis zur Bewusstwerdung, spinomedulläre und subkortikale Umschaltstationen ( ▶ Abb. 1.13). Die erste ist das Hinterhorn des Rückenmarks. Hier werden die aus schnell leitenden Aδ- und langsam leitenden C-Fasern stammenden Schmerzrohsignale auf das jeweilige zweite Neuron umgeschaltet. Dessen Fasern bilden den nach kranial verlaufenden Tractus spinothalamicus. Zentrale und wichtigste subkortikale Durchgangsstation ist derThalamus. Erst an dieser Stelle werden die Rohsignale zum Schmerz, d.h., der Schmerz wird als solcher auch erkannt („Schmerzidentifikation“). Vom Thalamus aus existieren Verbindungen zum Neokortex und im Nebenschluss zum limbischen System. Das limbische System, ein Grenzgebiet zwischen Groß- und Stammhirn, verleiht dem Schmerz seinen emotionalen Charakter („Schmerzaffektion“).
Narkosewirkungen: Analgesie.
Abb. 1.13 Topografie der Schmerzverarbeitung.
Kortikale Areale im Gyrus postcentralis dienen zur Schmerzlokalisierung und vor allem zur Schmerzwahrnehmung; hier werden die Schmerzimpulse zum bewussten Sinneseindruck verknüpft, hier wird der Schmerz „erlebt“ („bewusste Schmerzintegration“). Unterhalb der Thalamusebene werden die Schmerzimpulse durch die Formatio reticularis des Mittelhirns geleitet und erreichen über Kollateralen auch die motorischen Kerne im Hirnstamm sowie den Hypothalamus. Unter dem Einfluss der in derFormatio reticularis eintreffenden Schmerzreize erhöht sich die Vigilanz (für eine Narkose bedeutet dies, dass sie flacher wird). Die motorischen Hirnstammkerne vermitteln über efferente Bahnen die schmerzinduzierten Fluchtreflexe und Abwehrbewegungen. Vom Hypothalamus aus werden über afferent-efferente Verbindungen die autonomen Schmerzreflexe kontrolliert. Schmerzen aktivieren hier das sympathoadrenerge System, und es kommt unter anderem zu Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg, Steigerung der Stoffwechselaktivität, Schwitzen, Pupillenerweiterung und unter Spontanatmung auch zu einer Intensivierung der Atemtätigkeit („Stressreaktion“). Als Folge der Stoffwechselsteigerung können der Energiebedarf und damit der Sauerstoffverbrauch des Organismus ganz erheblich zunehmen.
Das überaus komplexe System von Schmerzerzeugung und -verarbeitung macht deutlich, dass die alleinige Ausschaltung des Bewusstseins keinesfalls genügt, um eine klinisch suffiziente, d.h. eine auch die Schmerzreflexe ausschaltende Analgesie hervorzurufen. Erst Pharmaka, die die zentralnervöse Schmerzintegration beeinflussen, können eine adäquate, umfassende Analgesie bewirken, was durch den Begriff „somatische Analgesie“ gekennzeichnet werden soll. Ihre Wirkung kann dabei umfassend sein (Narkotika) oder selektiv, d.h. auf die Schlüsselpositionen der Schmerzverschaltung beschränkt (z.B. Opioide) ( ▶ Abb. 1.14). Überdies können Lokalanästhetika die Impulsfortleitung im Bereich peripherer Nerven bzw. Nervengeflechte oder auch auf Rückenmarkebene (z.B. Hinterhornzellen) regional unterbrechen.
1.4.3 Muskelrelaxation
Die durch Narkotika induzierte Relaxation der Skelettmuskulatur ( ▶ Abb. 1.14) entsteht zunächst durch eine Suppression der übergeordneten motorischen Zentren, vor allem der Basalganglien des Endhirns, die wesentlichen Anteil an der Vermittlung des Muskeltonus haben, und außerdem durch eine Hemmung der im Rückenmark verlaufenden absteigenden motorischen Bahnen. In tiefen Narkosestadien wird die Aktivität der Vorderhornzellen im Rückenmark auch direkt vermindert. Das Zusammenwirken dieser Mechanismen wird als zentrale Muskelrelaxation bezeichnet. Sie umfasst also die Absenkung des Muskeltonus und die Hemmung polysynaptischer Reflexe. Letzteres findet sich nicht nur bei den eigentlichen Narkotika, sondern interessanterweise und als Nebeneffekt auch bei den ja nur sedierend wirkenden Benzodiazepinen.
Im Gegensatz dazu stehen die Wirkungen der spezifischenMuskelrelaxanzien ( ▶ Abb. 1.14). Sie greifen nicht zentral an, sondern selektiv an Rezeptoren, die im Bereich der motorischen Endplatte liegen und deren Blockade die neuromuskuläre Übertragung aufhebt. Dies bezeichnet man als periphere Muskelrelaxation. Der Vorteil, der sich aus der Anwendung spezifischer Muskelrelaxanzien ergibt, besteht darin, dass keine tiefe Narkose mehr benötigt wird, um eine vollständige Relaxation zu erreichen. Durch den verringerten Bedarf an Narkosemitteln lassen sich deren negative Auswirkungen, vor allem auf das Herz-Kreislauf-System, deutlich reduzieren. Die Wirkung peripherer Muskelrelaxanzien kann außerdem wenn nötig in gewissen Grenzen pharmakologisch antagonisiert werden. Aufgrund der unterschiedlichen Ansatzpunkte kommt es, wenn zentral relaxierende Narkotika mit peripher wirkenden Muskelrelaxanzien kombiniert werden, zu einer intraoperativ günstigen Wirkungsverstärkung („Synergismus“).
Narkosewirkungen: Analgesie und Muskelrelaxation
Abb. 1.14
1.5 Wirkungsmechanismen der Narkose
1.5.1 Anästhetika
Bei genauer Betrachtung der einzelnen Anästhetika fällt auf, dass es sich nicht um eine homogene Gruppe handelt. Vielmehr können pharmakologische Substanzen mit ganz unterschiedlicher chemischer Struktur und entsprechend unterschiedlichen physikochemischen Eigenschaften eine Narkose auslösen ( ▶ Abb. 1.15). Als eigentliche Narkotika gelten jedoch nur
volatile (dampfförmige) Etherverbindungen wie Diethylether, Isofluran, Sevofluran und Desfluran,
Gase wie Stickoxydul und Xenon (Edelgas) sowie
die Injektionsbarbiturate Thiopental und Methohexital.
Das Cyclohexanonderivat Ketamin nimmt wegen seiner halluzinogenen Wirkung eine Sonderstellung ein und wird höchstens im erweiterten Sinn zu den Narkotika gezählt.
Lediglich alsHypnotika (ohne analgetische und damit streng genommen auch ohne anästhetische Potenz) sind anzusehen:
das Alkylphenolderivat Propofol
das Imidazolderivat Etomidat
die Benzodiazepine Midazolam und Flunitrazepam
Bei der Beschäftigung mit der Frage, wie sich narkotische Wirkungen pharmakologisch erklären lassen, stößt man auf folgende Gesetzmäßigkeiten:
Prinzipiell wirkt jedes ausreichend hoch dosierte, kleine, lipophile organische oder anorganische Molekül narkotisch.
Die Wirksamkeit von Narkotika in Zellverbänden ist umso besser, je höher deren Stoffwechselrate ist. Demgemäß reagieren die einzelnen Hirnanteile unterschiedlich stark auf Narkotika, was überhaupt erst eine Narkose ermöglicht.
Die narkotische Potenz von stereospezifischen Isomeren unterscheidet sich interessanterweise in der Regel recht deutlich, d.h., es bestehen im Hinblick auf die erforderliche Dosis ausgeprägte Unterschiede zwischen den Enantiomeren eines Razemats.
Aufgrund der Tatsache, dass Narkotika pharmakologisch ausgesprochen verschieden sind, erscheint es eher unwahrscheinlich, jemals eine einheitliche, konsistente Theorie zum Wirkungsmechanismus der Narkose entwickeln zu können. Aus experimentellen Untersuchungen haben sich zwei unterschiedliche Erklärungsansätze herauskristallisiert, die biophysikalische und die biochemische Theorie.
Strukturformeln von Anästhetika.
Abb. 1.15
1.5.2 Biophysikalische Theorie („Lipidtheorie“)
Im Mittelpunkt dieser Theorie steht die unspezifische Beeinflussung biologischer Membranen durch Narkotika ( ▶ Abb. 1.16). Es ist bekannt, dass kleine organische (wie auch anorganische) Moleküle sich abhängig vom Grad ihrer Lipophilie in die (hydrophoben) Phospholipid-Doppelschichten von Zellmembranen einlagern. Hierdurch wird der Ordnungszustand der Membran verändert. Die geordnete Gelfraktion der Lipoproteine wird aufgeweicht und geht in einen mehr flüssig-ungeordneten Zustand über. Die Flüssigkeits- und die damit einhergehende Volumenzunahme beeinflussen die Membranpermeabilität, indem sie die Öffnung von Ionenkanälen beeinträchtigen und so transmembranale Ionenströme hemmen. Dies führt zu Änderungen der elektrischen Ladung der betroffenen Zellen und folglich auch zu Änderungen der Zellerregbarkeit. Die Membranexpansion in Nervenzellen, d.h. die Zunahme der „Unordnung“, ist durch eine Erhöhung des Umgebungsdruckes reversibel, was klinisch mit der Beobachtung wieder abflachender oder aufgehobener Anästhesie korrespondiert („pressure reversal of anaesthesia“). Ab einer kritischen Molekülgröße lässt sich kein anästhetischer Effekt mehr ausmachen („Cut-off-Effekt“). Das liegt daran, dass Moleküle eine bestimmte Länge nicht überschreiten dürfen, um sich „stabil“ in die apolare Membraninnenschicht einlagern zu können.
Die biophysikalische Theorie liefert aus thermodynamischer Sicht ein Erklärungsmodell für holenzephal, also auf das gesamte Gehirn einwirkende Anästhetika (z.B. Inhalationsanästhetika, mit Einschränkung auch Barbiturate). Typisch für solche Substanzen ist, dass sie sich ubiquitär in neuronale (und auch nicht neuronale) Membranen einlagern. Dabei wird deutlich, dass bei gasförmigen und volatilen Anästhetika die narkotische Potenz mit steigender Lipophilie oder Lipidaffinität zunimmt (Meyer/Overton, 1901). Auch die Wirksamkeit der chemisch inerten Edelgase ließe sich durch rein physikalische Veränderungen im Bereich der Zellmembran erklären.
Biophysikalische Theorie der Narkose.
Abb. 1.16
1.5.3 Biochemische Theorie („Protein- oder Rezeptortheorie“)
Die anästhesiologische Grundlagenforschung konzentriert sich heutzutage in erster Linie auf die vielfältigen Interaktionen von Anästhetika mit spezifischen neuronalen Bindungsstellen. Der biochemischen Theorie liegt die Vorstellung zugrunde, dass bestimmte, vor allem die intravenösen Anästhetika mitProteinrezeptoren der Zellmembran und der Zellorganellen reagieren und dadurch die Funktion von Neurotransmittern beeinflussen, was Auswirkungen auf den transmembranalen Ionentransport und zellulären Stoffwechsel hat ( ▶ Abb. 1.17). Potenzielle Angriffspunkte im Bereich der Zellmembran sind
die Kanalproteine,
Modulatoren der Kanalproteine oder
die umgebende Lipidmembran.
Durch Pharmakon-Rezeptor-Interaktionen werden in Abhängigkeit von dem Rezeptortyp, der Rezeptordichte und -verteilung spezifische Wirkungen vermittelt. Hiermit lassen sich z.B. die anxiolytisch-sedierenden Eigenschaften der Benzodiazepine, die hypnotische Wirksamkeit von Propofol und Etomidat, aber auch die Analgesie durch Opioide sowie einige Wirkungen von Ketamin erklären. All diesen Substanzen ist gemeinsam, dass sie nicht holenzephal wirken. Ihre Effekte beschränken sich auf diejenigen ZNS-Regionen, in denen die typischen Bindungsstellen und Zielstrukturen vorhanden sind. So verwundert es nicht, dass diese Stoffe keine Narkose mit allen erforderlichen Qualitäten auslösen können, sondern lediglich Teilqualitäten. Erst die sinnvolle Kombination mehrerer Substanzen führt zu einer Narkose. Dies bildet die rationale Grundlage der modernen Narkose, bei der möglichst spezifische, selektiv wirkende Pharmaka bedarfsabhängig eingesetzt werden sollen.
Biochemische Theorie der Narkose.
Abb. 1.17
1.5.4 Zusammenfassung
Im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses an der Entstehung von Narkose stehen heutzutage
der Natriumkanal (Auslösung des Aktionspotenzials, Membrandepolarisation),
der Kalium- und der Chloridkanal (Membranhyperpolarisation und -repolarisation),
der GABAA- und der NMDA-Rezeptorkanal als Ansatzpunkte für inhibitorische und exzitatorische Neurotransmitter,
Opioid-, cholinerge und adrenerge Rezeptoren,
Second-Messenger-Systeme und
die Zelllipidmembran selbst.
Trotz großer Forschungsaktivitäten ist das Wissen über die Wirkungsmechanismen der Narkose nach wie vor recht lückenhaft. Wahrscheinlich ist, dass der Entwicklung von Narkose ein multimechanistisches Prinzip zugrunde liegt, d.h., es existieren auf molekularer Ebene verschiedene Angriffspunkte für Narkosemittel. Deren Wirksamkeit ist offenbar an reversible Veränderungen der Zellmembranstruktur und -funktion gekoppelt. Gemeinsame Endstrecke ist schließlich die Beeinträchtigung der synaptischen Signaltransmission, der Impulsweiterleitung und der neuronalen Signalintegration in bestimmten subkortikalen Hirnzentren sowie im (Neo-)Kortex, was dann zu einer Verminderung der zerebralen Aktivität führt ( ▶ Abb. 1.18). Die Tatsache, dass es sich bei der Narkose um eine Form der zerebralen Dämpfung handelt, zeigt sich in der Unterdrückung der hirnelektrischen Aktivität im spontanen und evozierten Elektroenzephalogramm sowie in einer Abnahme des Hirnstoffwechsels. Nach heutiger Auffassung ist die Stoffwechselreduktion aber nicht die Ursache der Narkose, sondern deren Folge.
Biophysikalische und biochemische Theorie der Narkose im Vergleich.
Abb. 1.18
1.5.5 Fazit der Narkosetheorien
Da chemisch völlig verschiedenartige Pharmaka eine Narkose hervorrufen können, kann Narkose neurophysiologisch als uniforme, unspezifische Reaktion auf eine reversible Hemmung der neuronalen Signalübertragung und -verarbeitung verstanden werden. In klinisch-pragmatischer Hinsicht aber ist Narkose kein absoluter, statischer Zustand, d.h. keine „Alles-oder-nichts-Antwort“ auf die Wirkung zentral dämpfender Substanzen, sondern muss immer in Bezug zur jeweiligen operativen oder manipulativen Reizkonstellation gesehen werden. Eine flache Narkose kann bei fehlender operativer Stimulation zu tief, eine tiefe Narkose bei starker Stimulation zu flach sein.
1.6 Anästhetikagruppen und ihre typischen Wirkungsweisen
Holenzephale Wirkung Holenzephal wirkende Anästhetika hemmen dosisabhängig nacheinander die Funktionen des Groß- oder Endhirns (Telenzephalon), des limbischen Systems, des Zwischenhirns (Dienzephalon), Mittelhirns (Mesenzephalon), Hinterhirns (Metenzephalon), Nach- oder Markhirns (Myelenzephalon oder auch Medulla oblongata) und des Rückenmarks (Medulla spinalis). Sie bewirken eine „assoziierte Anästhesie“. Da hierin alle Teilqualitäten einer Narkose enthalten sind, werden solche Wirkstoffe als Narkotika bezeichnet. In hohen Dosen beeinträchtigen sie die vegetativen Steuerungsfunktionen im Hirnstamm (→ Atem- und Kreislaufstillstand). Zu dieser Gruppe gehören die Inhalationsanästhetika und dieBarbiturate ( ▶ Abb. 1.19).
Telenzephale Wirkung Substanzen mit überwiegend telenzephaler Wirkung unterdrücken die kortikale Aktivität, ohne tiefere Hirnanteile wesentlich zu beeinflussen. Sie werden wegen der fehlenden analgetischen Komponente Hypnotika genannt und müssen für chirurgische Eingriffe mit Opioiden kombiniert werden. Die vegetativen Hirnstammfunktionen bleiben intakt. Die kortikale Hemmung hat eine subkortikale Enthemmung zur Folge, was sich klinisch in unwillkürlichen Bewegungen bis hin zu Myoklonien äußern kann („Exzitationsäquivalente“). Typische Vertreter dieser Gruppe sind Propofol und Etomidat ( ▶ Abb. 1.19).
Einteilung der Anästhetika nach wirktopografischen Gesichtspunkten.
Abb. 1.19
Telemesenzephale Wirkung Zu den telemesenzephal wirkenden Pharmaka zählen die Benzodiazepine. Sie sind in erster LinieSedativa. Ihre Angriffspunkte liegen in der Formatio reticularis, im limbischen System und im Neokortex. Dort setzen sie an spezifischen Stellen des GABAA-Rezeptorkanals an ( ▶ Abb. 1.20), des wichtigsten Pfeilers im System der Regulation physiologischer Hemmmechanismen („inhibitorisches neuronales System“). Benzodiazepine aktivieren dieses System, indem sie die Wirkungen des körpereigenen Transmitters γ-Aminobuttersäure (GABA) verstärken und beschleunigen (wie bei einer Servobremse). Hiermit erklärt man ihre anxiolytisch-sedierenden und auch die z.T. vorhandenen hypnotischen Eigenschaften. Der Unterschied zu Barbituraten ist folgender ( ▶ Abb. 1.21): Benzodiazepine unterliegen einem Sättigungseffekt (Ceiling-Phänomen), weil physiologische Hemmmechanismen naturgemäß nicht mehr als maximal verstärkt werden können. Das bedeutet, dass eine darüber hinausgehende Dosissteigerung nicht zu einer weiteren Zunahme der Wirkung führt. Barbiturate hingegen unterdrücken dosisabhängig auch exzitatorische Mechanismen. Bei ihnen verläuft die Dosis-Wirkungs-Kurve daher nahezu linear, mit dem Ergebnis, dass „höchste“ Barbituratdosen eine totale Hemmung hervorrufen, was mit dem Leben nicht vereinbar ist.
Angriff der Benzodiazepine am GABAA-Rezeptorkanal.
Abb. 1.20
Dosis-Wirkungs-Beziehung von Benzodiazepinen und Barbituraten.
Abb. 1.21
Teledienzephale Wirkung Eine Substanz wie Ketamin reduziert vor allem die Schmerzwahrnehmung. Dies geschieht in tieferen, thalamischen Hirnschichten. Die kortikalen Funktionen und damit das Bewusstsein werden dagegen nur mäßig gedämpft. Bei diesem Zustand, auch als „dissoziierte Anästhesie“ bezeichnet, handelt es sich nicht um eine Narkose im eigentlichen Sinn. Man kann ihn, was die Bewusstseinsveränderung angeht, mit der Katalepsie des psychotischen Patienten vergleichen. Aufgrund einer Stimulation subkortikaler Areale können abnorme traumhafte Erlebnisse (Halluzinationen), ein erhöhter Skelettmuskeltonus und eine ungesteuerte motorische Aktivität auftreten. Ferner werden hirnstammabhängige Funktionen wie die Kreislauftätigkeit aktiviert („zentrale Sympathikusstimulation“), der Atemantrieb wird in der Regel nicht oder nur mäßig gedämpft. Die pharyngolaryngealen Schutzreflexe bleiben meist erhalten und können sogar gesteigert sein. Einige Wirkungen des Ketamins (u.a. Amnesie, „Sedierung“ und Analgesie) werden auf Interaktionen mit NMDA-(N-Methyl-D-Aspartat-)Rezeptorkanälen zurückgeführt. NMDA-Rezeptoren sind maßgeblich an der Steuerung zentral erregender Impulse beteiligt („exzitatorisches neuronales System“). In dieses System greift Ketamin als Antagonist an der Phencyclidinbindungsstelle ein.
Mesodienzephale, medulläre und periphere Wirkungen Wirkstoffe wie die Opioide vermindern durch Stimulation spezieller Rezeptoren sowohl die Schmerzentstehung an den peripheren Nervenendigungen als auch die Erregungsübertragung und -verarbeitung im ZNS ( ▶ Abb. 1.22). Die Analgesie soll supraspinal wie spinal hauptsächlich über µ-Rezeptoren und schwächer über κ-Rezeptoren vermittelt werden. In höheren Dosen entwickeln Opioide unter Beteiligung von κ-Rezeptoren zudem direkte kortikal dämpfende Wirkungen und führen zu einer Bewusstseinseinschränkung (Somnolenz).
Angriff der Opioide an Opioidrezeptoren.
Abb. 1.22
2 Präoperative Visite
2.1 Grundsätzliches und Anamnese
Der präoperativen anästhesiologischen Visite, auch Prämedikationsvisite genannt, kommt entscheidende Bedeutung zu, weil hier der Grundstein für den erfolgreichen Ablauf der Anästhesie gelegt wird. Die Visite hat zwei wesentliche Ziele: Dem Patienten muss neben den nötigen Sachinformationen das Gefühl von Sicherheit und bestmöglicher medizinischer Versorgung gegeben werden; der Anästhesist dagegen muss sich ein möglichst objektives Bild vom physischen und psychischen Zustand des Patienten verschaffen. Diese von sich aus nicht immer kongruenten Ziele gilt es im präoperativen Gespräch miteinander in Einklang zu bringen.
2.1.1 Inhalte und Ablauf
Die Prämedikationsvisite sollte vor planbaren Eingriffen spätestens am Vortag der Operation in angenehmer, entspannter Atmosphäre stattfinden, um dem Patienten genügend Zeit und Freiheit für seine Entscheidungsfindung und Einwilligungserklärung zu lassen. Nach Möglichkeit sollte sie der Anästhesist durchführen, der auch die Anästhesie vornimmt. Eine Anästhesieaufklärung am Operationstag ist, abgesehen von dringlichen oder notfallmäßigen Eingriffen, nur in Ausnahmefällen zulässig, z.B. im ambulanten Bereich. Während des Gesprächs ist es wichtig, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen Anästhesist und Patient zustande kommt, um dessen Ängste zu verringern und so den Ablauf für beide Seiten zu erleichtern. Demselben Ziel dient auch die zusätzliche Verordnung einer geeigneten Prämedikation. Sie soll in der Regel am Vorabend und am Tag der Operation verabreicht werden ( ▶ Abb. 2.1).
Vor elektiven Eingriffen (das sind Eingriffe, bei denen der Eingriffszeitpunkt frei wählbar ist) gelten ethisch und forensisch die höchsten Qualitätsanforderungen an die medizinische Vorbereitung, d.h., anästhesierelevante krankhafte Befunde dürfen nicht übersehen und reversible Funktionsstörungen lebenswichtiger Organe müssen präoperativ unbedingt korrigiert werden, damit sich der Patient zum Zeitpunkt von Eingriff und Anästhesie im bestmöglichen Zustand befindet. Außerdem müssen eventuelle Begleiterkrankungen bei der Auswahl des Anästhesieverfahrens berücksichtigt werden.
Präoperative Visite.
Abb. 2.1 Inhalte und Ablauf.
2.1.2 Prämedikationsambulanz
Zur optimalen Vorbereitung des Patienten auf die Anästhesie sind gewisse Untersuchungen erforderlich. Deren Umfang hängt vom Gesundheitszustand und Alter des Patienten sowie von eingriffsspezifischen Faktoren wie Lokalisation und Ausmaß der operativen Maßnahmen ab. Um den Ablauf zu vereinfachen, wird, was Laboranalysen, das EKG und das Thoraxröntgen betrifft, meist nach kliniküblichen Schemata verfahren. Die Ergebnisse sollten idealerweise bereits zur anästhesiologischen Visite vorliegen. Mitunter ergeben sich Aspekte, die eine weiterführende Diagnostik notwendig machen, mit der möglichen Konsequenz, dass der Operationstermin verschoben und neu geplant werden muss. Um generell die Operationsplanung zu verbessern, aber auch um den Komfort der Patienten zu erhöhen, sind inzwischen vielerorts anästhesiologische Ambulanzen („Prämedikationsambulanzen“) eingerichtet worden. Hier stellt sich der Patient deutlich vor dem Eingriffstermin dem Anästhesisten vor. Gerade bei längerfristig planbaren stationären wie auch bei ambulant durchführbaren Eingriffen hat sich dieses Vorgehen überaus gut bewährt, weil es die Entwicklung individueller patientenorientierter Strategien erheblich erleichtert ( ▶ Abb. 2.2).
Prämedikationsambulanz.
Abb. 2.2 Ablaufschema.
2.1.3 Anamnese
Nach der Kontaktaufnahme mit dem Patienten steht zunächst die Erhebung der Anamnese im Vordergrund. Hierfür ist es sinnvoll, anhand eines schematisierten Erfassungsbogens, der dem Patienten am besten schon vorher ausgehändigt wurde, die wichtigsten anästhesierelevanten Punkte nacheinander durchzugehen. Wichtig ist dabei vor allem die Beantwortung der Fragen nach Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herz-Kreislauf-Systems und des zentralen Nervensystems, da naturgemäß der Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen bei jeder Anästhesie die größte Bedeutung zukommt ( ▶ Abb. 2.3). Ergeben sich bereits aus der Anamnese Hinweise auf präexistente Störungen, sollte der Arzt versuchen, diese Auffälligkeiten während der körperlichen Untersuchung zu objektivieren. Gegebenenfalls muss ihr Ausmaß aber auch durch weiterführende apparative und/oder laborchemische Untersuchungen abgeklärt werden, um die richtigen Konsequenzen für Operation und Anästhesie ziehen zu können.
Anamnese.
Abb. 2.3
2.2 Voruntersuchungen
Das Hauptziel präoperativer Diagnostik ist aus anästhesiologischer Sicht, die Faktoren, die das perioperative Risiko erhöhen, zu erkennen, um sie dann durch gezielte therapeutische Maßnahmen soweit wie möglich zu minimieren. Außerdem kann das anästhesiologische Vorgehen umso besser dem individuellen Risiko angepasst werden, je genauer dieses bekannt ist. Nach größeren Statistiken ist die Bedeutung routinemäßig, altersunabhängig durchgeführter Untersuchungen zur Aufdeckung präexistenter, noch nicht erkannter Erkrankungen jedoch äußerst gering einzuschätzen. Der Umfang des präoperativen Untersuchungsprogramms kann deshalb am anamnestisch-klinischen Gesundheitszustand und dem Alter des Patienten sowie an Art, Ausmaß, Dauer und Dringlichkeit des Eingriffs ausgerichtet werden.
Allgemeine Prinzipien In den meisten anästhesiologischen Einrichtungen wird vor elektiven Eingriffen folgendes Vorgehen mit evtl. geringen Modifikationen praktiziert:
Bei gesunden Kindern werden für kleine Eingriffe Anamnese und körperliche Untersuchung als ausreichend angesehen (Ausnahme: Hb oder Hkt bei Säuglingen in den ersten 6 Lebensmonaten wegen der Trimenonanämie).
Bei Erwachsenen mit unauffälliger Anamnese und unauffälliger klinischer Untersuchung genügt die Bestimmung der Hämoglobin- und der Blutzuckerkonzentration, ab 60 Jahren ergänzt durch ein (Ruhe-)EKG und eine Röntgenaufnahme des Thorax.
Vor rückenmarknahen Regionalanästhesien sowie vor infraklavikulären und interskalenären Plexusblockaden wird – auch bei unauffälliger Anamnese und Klinik – eine Kontrolle der globalen Gerinnungsparameter inkl. Thrombozytenzahl vorgenommen.
Vor umfangreichen Operationen werden weitere Laboruntersuchungen, bei anamnestischen und/oder klinischen Hinweisen auf Vor- bzw. Begleiterkrankungen auch weiterführende Untersuchungen zur differenzierten Abklärung durchgeführt.
Bei Erfordernis von Voruntersuchungen sollten die Befunde zum Operationstermin hin möglichst aktuell sein, d.h. bei unverändertem Gesundheitszustand die Laborwerte nicht älter als 14 Tage, das EKG nicht älter als 4 Wochen und die Röntgenaufnahme des Thorax nicht älter als 3 Monate.
2.2.1 Systematik der klinischen Untersuchung
Die klinische Untersuchung umfasst:
Inspektion
Palpation
Perkussion
Auskultation
Sie sollte – um so effektiv wie möglich zu sein – systematisch, nach Organen oder Organsystemen gegliedert, durchgeführt werden ( ▶ Abb. 2.4).
Systematik der klinischen Untersuchung.
Abb. 2.4
2.2.2 EKG
Die Frage ist, ab welchem Alter ein Ruhe-EKG präoperativ als Suchtest für nicht bekannte kardiovaskuläre Erkrankungen eingesetzt werden sollte. Retrospektive Analysen des Datenmaterials zeigen, dass die Häufigkeit pathologischer EKG-Befunde, die eine Veränderung des anästhesiologisch-operativen Konzepts nach sich ziehen, bei klinisch gesunden Patienten unter 60 Jahren sehr niedrig ist. Deshalb erscheint eine routinemäßige Durchführung eines EKGs in dieser Altersgruppe nicht nötig. Bei Patienten mit Hinweisen auf eine kardiovaskuläre Erkrankung ist ein EKG dagegen immer indiziert. Hier soll es helfen, behandlungsbedürftige Veränderungen aufzudecken und abzuschätzen, ob eine weiterführende Diagnostik sinnvoll ist (z.B. Echokardiografie, Koronarangiografie). Folgende EKG-Veränderungen sind anästhesiologisch von Bedeutung:
ST-Strecken-Veränderungen
Zeichen eines Herzinfarkts
absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern
Vorhofflattern
AV-Blockierungen
Schenkelblockbilder
Extrasystolen (supraventrikulär/ventrikulär)
Präexzitationssyndrome
Rechtsherz- oder Linksherzhypertrophie
Aktionen eines künstlichen Herzschrittmachers
Die Sensitivität des Ruhe-EKGs ist allerdings gering, d.h., dass ein unauffälliger Befund keineswegs schwere myokardiale oder koronare Veränderungen ausschließen lässt. Auf die einzelnen EKG-Bilder kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Es wird daher auf die einschlägigen Lehrbücher verwiesen ( ▶ Abb. 2.5, ▶ Abb. 2.6).
Systematische EKG-Analyse.
Abb. 2.5
Elektrische Herzaktion.
Abb. 2.6 Schema.
Als Standardtechnik auch für die präoperative Diagnostik gilt ein im Ruhezustand durchgeführtes 12-Kanal-Oberflächen-EKG mit den bi- und unipolaren Extremitätenableitungen I, II, III, aVR, aVL, aVF sowie den unipolaren Brustwandableitungen V1 – 6.
2.2.3 Radiologische Untersuchung
Die häufigste radiologische Untersuchung dürfte präoperativ nach wie vor dieRöntgenaufnahme des Thorax ( ▶ Abb. 2.9, ▶ Abb. 2.10) sein. Auch damit sollen vorher nicht erkannte kardiopulmonale Erkrankungen aufgedeckt oder Auffälligkeiten in der Anamnese und der klinischen Untersuchung auf ihre Bedeutung hin überprüft werden. Nach den Ergebnissen mehrerer Studien kann davon ausgegangen werden, dass bei Patienten unter 60 Jahren ohne anamnestische und klinische Hinweise auf Erkrankungen der Thoraxorgane nur selten für Anästhesie und Operation relevante pathologische Veränderungen im Thoraxröntgenbild zu erkennen sind.
Davon unabhängig ist in bestimmten Fällen eine präoperative radiologische Diagnostik aber unverzichtbar, so z.B.
vor einer Strumektomie,
vor thoraxchirurgischen Eingriffen,
bei Patienten mit einem (zentralen) Bronchialtumor und
bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz.
Vor einer Strumektomie muss eine Verdrängung oder Stenose der Trachea erkannt werden. Deshalb sollte zunächst ein Röntgenbild im posterior-anterioren und im lateralen Strahlengang angefertigt werden. Bringt dies noch keinen ausreichenden Aufschluss, dann werden eine sog. Tracheazielaufnahme und ggf. auch ein Computertomogramm (CT) benötigt. Während thoraxchirurgischer Eingriffe kann es durch anästhesiologische oder operative Maßnahmen (z.B. Einlungenbeatmung; Kompression von Lungengewebe, Einblutungen) zu Veränderungen (z.B. Atelektasen) kommen, die von einem präexistenten Geschehen abgegrenzt werden müssen. Bei einem größeren hilusnahen Bronchialtumor kann sich eine Ventilstenose entwickeln, die dann unter Beatmung zu einer Überbelüftung der gesunden und Minderbelüftung der betroffenen Lunge führt. Daher müssen Größe und Lage des Tumors bekannt sein. Bei Hinweisen auf eine Linksherzinsuffizienz geht es darum, die Herzgröße und das Ausmaß einer etwaigen pulmonalen Stauung (→ Lungenödem) einzuschätzen.
Die Standardtechnik für die röntgenologische Darstellung der Thoraxorgane ist die Übersichtsaufnahme im Stehen in maximaler Inspiration (Sagittalbild im posterior-anterioren Strahlengang) ( ▶ Abb. 2.7, ▶ Abb. 2.9, ▶ Abb. 2.10). So lassen sich bronchopulmonale und kardiovaskuläre Strukturen am besten beurteilen. Bei bettlägerigen Patienten muss man auf eine Aufnahme im Liegen ausweichen (anterior-posteriorer Strahlengang), was die Beurteilung aufgrund des Zwerchfellhochstands, der intrathorakalen Blutumverteilung und von Abbildungsartefakten jedoch deutlich erschwert.
Röntgenthorax.
Abb. 2.7 Systematische Bildanalyse.
Röntgenthorax.
Abb. 2.8 Beurteilung der Bildqualität.
Radiologische Untersuchung.
Abb. 2.9 Schematische Standardprojektionen: Sagittalbild (li.), Linksseitenbild (re.).
Röntgenthorax: Normalbefund.
Abb. 2.10 Sagittalbild (li.), Linksseitenbild (re.).
2.2.4 Laboruntersuchungen
Der Nutzen routinemäßiger (umfangreicher) Laboruntersuchungen zum Aufdecken vorher unbekannter Erkrankungen oder Störungen ist ebenfalls gering. Aus diesem Grund kann präoperativ wie oben beschrieben verfahren werden. Um die Patientenvorbereitung zu vereinfachen, kann es auch sinnvoll sein, von Klinik zu Klinik unterschiedliche Standards für das Vorgehen in „Routinefällen“ festzulegen (z.B. Würzburger „18/7-Schema“) ( ▶ Abb. 2.11). Die Notwendigkeit erweiterter Analyseprogramme ergibt sich in Abhängigkeit von der Anamnese und vom Ergebnis der klinischen Untersuchung sowie von Art und Umfang des geplanten Eingriffs.
Laboruntersuchungen bei der präoperativen Visite.
Abb. 2.11
2.2.5 Spezielle Untersuchungen
Bei Hinweisen aus der Anamnese, Auffälligkeiten in der klinischen und apparativen Untersuchung und vor Operationen mit erheblichen Auswirkungen auf die Funktion lebenswichtiger Organe wird eine gezielte Diagnostik erforderlich. Vor Einleitung aufwendiger Untersuchungen zur Abklärung krankhafter Befunde sollten aber zwei Voraussetzungen geprüft werden:
Sind diese Untersuchungen für die Beurteilung des Anästhesierisikos von essenzieller Bedeutung?
Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass sich therapeutische Konsequenzen aus pathologischen Befunden ergeben?
Bei Erkrankungen oder vor Operationen mit Beeinträchtigung der Lungenfunktion sollte eine sog. Lungenfunktionsanalyse durchgeführt werden (Indikationen: ▶ Abb. 2.12). Diese sollte neben einerarteriellen Blutgasanalyse (BGA; PaO2, PaCO2) zur Einschätzung des pulmonalen Gasaustausches zumindest auch eine „kleine“ Spirometrie zur Erfassung der wichtigsten atemmechanischen Parameter (Vitalkapazität [VC], forciertes Exspirationsvolumen [FEV1]) mit einschließen ( ▶ Abb. 2.13, ▶ Abb. 2.14). Die Aussagekraft einer arteriellen BGA in Ruhe ist in Hinsicht auf die postoperative respiratorische Morbidität relativ gering. Erst eine BGA unter Belastung (Ergometrie) oder die Ermittlung der FEV1 lässt eine eingeschränkte pulmonale Reserve erkennen und ermöglicht Rückschlüsse auf zu erwartende respiratorische Komplikationen (Einzelheiten: ▶ Kap. 12.1). Wird eine bronchiale Obstruktion festgestellt, so sollte einBroncholysetest (Inhalation eines β2-Sympathomimetikums) angeschlossen werden, um die Reversibilität beurteilen zu können. Neben der Identifizierung von Patienten mit pathologischer Lungenfunktion dient die Lungenfunktionsanalyse auch als Grundlage für die Einleitung gezielter therapeutisch-prophylaktischer Maßnahmen und zur Überprüfung deren Effektivität.
Präoperative Lungenfunktionsanalyse.
Abb. 2.12 Indikationen.
Lungenfunktionsanalyse.
Abb. 2.13 Begriffsdefinitionen.
Statische Lungenvolumina und -kapazitäten.
Abb. 2.14
Genauso wichtig ist eine präoperative Abklärung kardiovaskulärer Erkrankungen. Zur Einschätzung der Herzfunktion können folgende Verfahren eingesetzt werden:
transthorakale Echokardiografie
Belastungs-EKG
Herzkatheteruntersuchung
Die Domäne der transthorakalenEchokardiografie ist die Untersuchung des myokardialen Kontraktions- und des linksventrikulären Auswurfverhaltens. Hierdurch lässt sich eine Herzinsuffizienz mit hoher Genauigkeit nachweisen oder ausschließen. Darüber hinaus kann die Funktion der Herzklappen beurteilt werden. Während das Ruhe-EKG eine hohe Treffsicherheit für den Nachweis eines Herzinfarkts hat, ist seine Sensitivität für die Diagnose einer koronaren Herzkrankheit (KHK) nur gering und beschränkt sich hier auf das Erkennen myokardialer Ischämien im Anfall. Mit einem Belastungs-EKG können anamnestische Angaben im Sinne von Belastungsstenokardien objektiviert werden. Zusätzlich lässt sich das Blutdruckverhalten besser einschätzen (z.B. labiler Hypertonus) und die Relevanz von in Ruhe auftretenden Herzrhythmusstörungen klären. Verschwindet eine Arrhythmie nämlich unter Belastung, so spricht dies im Allgemeinen für eine vegetative Genese und nicht für eine KHK. Umgekehrt ist aber eine durch Belastung provozierte Arrhythmie in der Regel Ausdruck einer organischen Herzerkrankung, wie z.B. einer KHK oder einer Herzinsuffizienz. Die Herzkatheteruntersuchung besteht aus einer Koronar- und Ventrikulografie. Sie übertrifft die Aussagemöglichkeiten der Echokardiografie besonders im Hinblick auf die Diagnostik einer KHK. Mit ihrer Hilfe lassen sich Koronarstenosen bereits bei geringerer Ausdehnung nachweisen, exakt lokalisieren und nicht selten einer umgehenden Therapie zuführen (Ballondilatation, Stenteinlage). Allerdings ist sie als invasive Methode deutlich aufwendiger und auch risikoträchtig. Weitere Einzelheiten zum Stellenwert der unterschiedlichen Untersuchungsmethoden: ▶ Kap. 12.2.
Konsiliaruntersuchungen Fachkonsile (am häufigsten internistisch-kardiologischer oder neurologischer Art) werden nur zur Beantwortung gezielter Fragen angefordert. Dabei geht es nicht um die Beurteilung der Anästhesiefähigkeit des Patienten durch den Konsiliar. Dies ist alleinige (!) Aufgabe des Anästhesisten. Vielmehr soll z.B. bei risikoerhöhenden Begleiterkrankungen geklärt werden, ob durch eine Behandlung der Zustand des Patienten präoperativ gebessert und damit das perioperative Risiko vermindert werden kann. In anderen Fällen soll eine bereits laufende Therapie auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden.
2.2.6 Voruntersuchungen im Notfall
Der Umfang von Voruntersuchungen wird im Notfall wesentlich von der Eingriffsdringlichkeit mitbestimmt. Da hier nur wenig Zeit bleibt, wird zunächst – soweit möglich – die Anamnese erhoben (Allergien!). Daran schließt sich eine kurze körperliche Untersuchung an. Es folgt eine Blutentnahme zur Bestimmung von Laborwerten und der Blutgruppe sowie zum Ansetzen der Kreuzprobe für die Fremdblutbereitstellung. In Extremsituationen muss eine Operation beginnen, bevor die Laborwerte vorliegen (z.B. bei einem perforierten Bauchaortenaneurysma). Apparative Untersuchungen werden bei Notfallpatienten nur dann durchgeführt, wenn sie für die Strategie des operativen Vorgehens maßgeblich oder für die Beurteilung lebensbedrohlicher Störungen unerlässlich sind (z.B. CCT bei polytraumatisierten Patienten).
2.3 Anästhesierisiko
Zur bestmöglichen Vorbereitung des Patienten auf Anästhesie und Operation sollte die anästhesiologische Visite, wie bereits dargelegt, möglichst frühzeitig stattfinden. Erst die umfassende Würdigung aller wesentlichen Begleiterkrankungen und -umstände ermöglicht eine genaue Einschätzung des perioperativen Gesamtrisikos. Von diesem Gesamtrisiko, das sich aus Anästhesie- und Operationsrisiko zusammensetzt, lässt sich das eigentliche Anästhesierisiko nur unscharf abtrennen, weil sich anästhesie- und operationsbezogene Faktoren in erheblichem Maße wechselseitig beeinflussen und entsprechend eng miteinander verknüpft sind.
2.3.1 Einflussfaktoren
Das Anästhesierisiko hängt nicht nur von möglichen Begleiterkrankungen, sondern auch von eingriffsspezifischen Merkmalen ab ( ▶ Abb. 2.15). Folgende Faktoren haben den größten Einfluss auf die perioperative Morbidität und Mortalität:
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (vor allem arterielle Hypertonie, KHK, Herzinsuffizienz)
Lungenerkrankungen (vor allem COPD)
Art, Umfang und Dringlichkeit des Eingriffs
Dauer der Operation
Lebensalter des Patienten
Die Bedeutung und die Auswirkungen kardiopulmonaler Vorerkrankungen werden im Einzelnen im ▶ Kap. Bedeutung häufiger Begleiterkrankungen erläutert. Was den Eingriff angeht, so steigt das perioperative Risiko mit dem Ausmaß des chirurgischen Traumas. Ganz oben in der Risikoskala rangieren Thorax-, Oberbauch- und Zweihöhleneingriffe sowie intrakranielle Operationen. Bei Notfall- und dringlichen Eingriffen kommt hinzu, dass nur wenig Zeit zur Vorbereitung des Patienten bleibt. Hier können mitunter sogar relevante Befunde nicht erhoben werden. Mit zunehmender Operationsdauer wächst die Schwierigkeit, alle Bedingungen zu kontrollieren, die für die Aufrechterhaltung der Homöostase bedeutsam sind. So können bei lang dauernden Eingriffen eine Hypothermie und extrazelluläre Flüssigkeitsdefizite nicht immer vermieden werden. Auch mit steigendem Lebensalter wird das perioperative Risiko größer, aber nicht durch das Alter selbst bedingt, sondern durch die mit fortschreitendem Alter vermehrt auftretenden Begleiterkrankungen. Ebenfalls ist das Risiko bei Neugeborenen und Säuglingen erhöht, weil bei ihnen die kardiopulmonalen Kompensationsmöglichkeiten eingeschränkt sind.
Anästhesierisiko.
Abb. 2.15 Einflussfaktoren.
2.3.2 Klassifizierung
Als Hilfestellung zur Einschätzung des Anästhesierisikos sind zahlreiche Klassifizierungssysteme entwickelt worden. Es handelt sich dabei z.T. um modifizierte Checklisten, z.T. um Scoring-Systeme. Bei Letzteren soll mithilfe einer Punkteskala das Risiko quantifiziert werden, wobei die Akzente auf Funktionsstörungen einzelner Organe oder von Organsystemen liegen. Am häufigsten wird das Schema der American Society of Anesthesiologists (ASA) verwendet ( ▶ Abb. 2.16), obwohl es nur den Allgemeinzustand des Patienten berücksichtigt und damit nur eine grobe Risikoeinschätzung zulässt. Trotzdem hat es sich in der Praxis als Orientierungshilfe bewährt, denn in verschiedenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die ASA-Einstufung statistisch gut mit der perioperativen Mortalität korreliert.
Die Beurteilung des Anästhesierisikos führt zwangsläufig auch zu der Frage nach der Anästhesiefähigkeit. Die Anästhesiefähigkeit ist