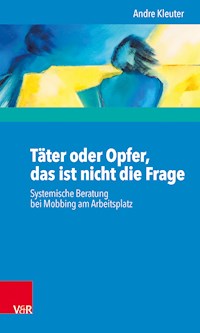
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Herkömmliche Beschreibungen von Mobbing sind geprägt von einer Täter-Opfer-Kategorisierung. Auf der einen Seite stehen die Täter, die scheinbar aus Neid, Missgunst und Bösartigkeit andere Menschen mobben, und auf der anderen Seite die Opfer, die dem Täter ausgeliefert sind. Andre Kleuter bricht mit dieser Sichtweise und folgt der Annahme, dass Mobbingbetroffene der Situation nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern sowohl zur Lösung als auch zur Chronifizierung beitragen können. Er stellt auf Basis des systemischen Beratungsansatzes ein methodisches Vorgehen für die Beratung von Menschen vor, die unter Mobbing am Arbeitsplatz leiden. Mit einem Verlaufsmodell erläutert er anschaulich und praxisnah die einzelnen Schritte im Beratungsprozess. Er zeigt, wie es gelingen kann, den Faktoren und Dynamiken, die zum Mobbing geführt haben, auf die Spur zu kommen und für einen Lösungsprozess zu nutzen. Von Andre Kleuter erfahren Sie, wie Betroffene in ihrer Eigenverantwortlichkeit gestärkt und im Finden von individuellen Lösungswegen unterstützt werden können. Ein Must-have für alle, die mit Mobbingbetroffenen im Beratungskontext zu tun haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andre Kleuter
Täter oder Opfer, das ist nicht die Frage
Systemische Beratung bei Mobbing am Arbeitsplatz
Mit 6 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
978-3-647-99883-1
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
Umschlagabbildung: AntoinetteW/shutterstock.com
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen / Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
Inhalt
Zu diesem Buch
Worum es geht
Mythos Mobbing
Mobbing gleich Konflikt?
Die Welt der konstruierten Wirklichkeit
Wirklichkeit
Kausalität
Kontext
Versteckte Kränkungen
Verdrängte Gefühle
Die systemische Beratungspraxis
Fragen erzeugen Bewegung
Hypothesenbildung
Ziele der Beratung
Prozessmodell
Die Beratung von Herrn M.
Scheitern
Der Splitter im Auge des anderen
Der Feind im Außen
Die Suche nach Gerechtigkeit
Wer anderen die Schuld gibt, gibt ihnen die Macht
Die Sehnsucht nach Komplexitätsreduktion
Macht Mobbing Sinn?
Anti-Mobbing-Strategien
Von wunden Punkten
Konfliktvermeidung ist Kontaktvermeidung
Konflikte nützen
Die vier Grundbedürfnisse
Führen, ohne zu beschämen
Was bleibt
Dank
Literatur
Zu diesem Buch
Seit vielen Jahren arbeite ich in der Beratung mit Menschen, die Schwierigkeiten am Arbeitsplatz haben. Die Probleme, derentwegen Menschen zu mir kommen, und die Anliegen, die sich daraus für die Beratung ergeben, sind vielfältig. Nicht selten kommen Männer und Frauen, die sich am Arbeitsplatz gemobbt fühlen und die als ihr Anliegen die Unterstützung im Kampf gegen das Mobbing formulieren. Sie schildern Vorkommnisse, in denen ihnen Unrecht geschehen ist, in denen sie sich missachtet, schikaniert oder schlecht behandelt und sich aus ihrem Team oder der ganzen Organisation herausgedrängt fühlen. Sie verstehen sich als Opfer Einzelner oder eines ganzen Systems.
Zu Beginn meiner Tätigkeit in der Beratung dachte ich, dass es notwendig wäre, diejenigen, die sich gemobbt fühlen, in ihrem Kampf zu unterstützen. Bald schon aber zeigte sich, dass dieser Ansatz die Situation der Ratsuchenden eher noch verschlechterte und die Konflikte und Spannungen verhärtete. Auch merkte ich während der Beratungsprozesse, dass das Opferbild, das die Klienten zunächst von sich schilderten, häufig die Situation nicht ganz adäquat abbildete. Vielmehr entstand bei genauerer Beschäftigung mit den Problemkonstellationen bei mir zunehmend der Eindruck, dass die Ratsuchenden in der Regel nicht nur Opfer sind, sondern häufig auch Täter, oder dass es zumindest schwer fällt zu unterscheiden, wer Täter und wer Opfer ist. Auch wurde mir deutlich, dass nicht jedes geschilderte Unrecht wirklich als solches zu werten ist und dass manche sogar bewusst einen Mobbingvorwurf initiierten. Aber auch in den Fällen, in denen Klienten nachweislich Unrecht geschah, waren sie in der Regel der Situation nicht hilflos ausgeliefert. Vielmehr konnten sie sowohl zur Verschlimmerung als auch zur Verbesserung der Situation beitragen. Sie waren Handelnde und nicht nur Opfer.
Mir ist dann aufgefallen, dass sich meine Erfahrungen sowohl in der öffentlichen Diskussion über Mobbing als auch in der Fachliteratur selten oder gar nicht wiederfinden lassen. Ist von Mobbing die Rede, werden vielmehr Schwarz-Weiß-Kategorien wie Gut und Böse, Schuld und Unschuld sowie Täter und Opfer verwendet. Mobbing wird dabei in Zusammenhang mit einem vermeintlichen Verfall gesellschaftlicher Werte und Normen, einer zunehmenden Ich-Bezogenheit von Menschen und mit der Skrupellosigkeit des Wirtschaftssystems im Zeichen der Globalisierung und dessen negativen Auswirkungen auf die Arbeitswelt gebracht. Mobbing wird als Auswirkung und Folge dieser Entwicklungen gesehen.
Für mich hat Mobbing mit all dem nur am Rande etwas zu tun. Mobbing ist vielmehr Ausdruck von Spannungen und Konflikten zwischen Menschen, nicht mehr aber auch nicht weniger. Dabei ist Mobbing nach meiner Ansicht kein neues Phänomen, sondern es hat es schon immer gegeben, auch wenn es früher andere Begrifflichkeiten dafür gab, was man heute mit Mobbing beschreibt.
Zeitgleich mit meinen Erfahrungen in der Beratung bin ich im Rahmen von Weiterbildung mit dem systemischen Beratungsansatz in Kontakt gekommen. In dem Systemischen habe ich eine ideale Verbindung und einen hilfreichen Zugang zu dem Thema Mobbing gefunden. Besonders angesprochen hat mich dabei die Haltung, mit der Probleme und Schwierigkeiten betrachtet werden, sowie das dem Ansatz zugrunde liegende Menschenbild, andere nicht zu kategorisieren und vermeintliche Defizite in den Fokus zu nehmen. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass Menschen in der Regel gute Absichten haben, die sich unter Umständen aber nicht in ihrer Sprache und ihrem Verhalten adäquat ausdrücken. In der Beratung geht es unter anderem darum, Menschen dabei zu unterstützen, bei sich selbst und anderen Sprache und Verhalten zu entschlüsseln, und die Intentionen und guten Absichten dahinter zu erkennen. Letztendlich ist das Ziel, einen friedvollen Umgang mit sich und den anderen zu finden.
Das Anliegen, meine Erfahrungen in ein schlüssiges, auf dem systemischen Beratungsansatz basierendes, praxistaugliches Beratungskonzept zu überführen, hat mich angetrieben und letztlich zu dem Ihnen vorliegenden Buch geführt.
Worum es geht
»MOBBING – Der Feind in meinem Büro«, so betitelte »Der Spiegel« vor einigen Jahren eine Ausgabe (Heft 16/2012). In dem entsprechenden Leitartikel zeichnet das Magazin ein düsteres Bild der deutschen Arbeitswelt; einer Welt, in der Intrigen, Neid und Schikane an der Tagesordnung seien. Vorgesetzte, die einzelne Mitarbeiter bloßstellten und lächerlich machten, Kollegen, die andere systematisch attackierten und ausgrenzten, und Arbeitgeber, die dem Treiben hilflos zusähen bzw. es ignorierten. Die Autoren beschreiben die langen Leidenswege der Betroffenen, die Ausweglosigkeit, in der sich diese häufig befänden, und die dramatischen Folgen für ihre Gesundheit. Dabei wird davon ausgegangen, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. Das Magazin beruft sich auf Zahlen einer Studie der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofonds), wonach in Deutschland fast zwei Millionen Menschen von Mobbing am Arbeitsplatz betroffen seien. Durch Fehltage aufgrund von Mobbing entstünden deutschen Unternehmen jährliche Kosten in Höhe von 2,3 Milliarden Euro.
Der Artikel ist nur ein Beispiel für die mediale Berichterstattung über Mobbing. Kennzeichnend für die Darstellung in den Medien ist, dass Mobbing in der Regel als ein Phänomen beschrieben wird, in dem es feste Rollen im Sinne von Tätern und Opfern gibt und diese Rollen mit festen Zuschreibungen verbunden sind. Auf der einen Seite stehen Täter, die aus Neid, Missgunst und Bösartigkeit andere Menschen schikanieren, diskriminieren, mithin mobben. Die Opfer auf der anderen Seite sind dem oder den Täter/-n hilflos ausgeliefert und letztendlich Objekte einer immer skrupelloseren Welt und ihrer Protagonisten.
Setzt man sich aber im Beratungskontext mit Betroffenen und ihrer Problematik intensiver auseinander, bekommt man den Eindruck, dass diese Täter-Opfer-Kategorisierung in der Regel zu kurz gegriffen ist bzw. nur einen Ausschnitt des Gesamtbildes wiedergibt. Vielmehr sind die Betroffenen nicht nur Opfer, sondern häufig auch aktiv an der Herstellung und Gestaltung der Situation beteiligt, zumindest der Situation aber nicht hilflos ausgeliefert. Sie können sowohl zu einer Lösung als auch zur Chronifizierung beitragen.
Die Formulierung dieses Eindrucks wirkt auf den ersten Blick provokant und lädt zu dem Missverständnis ein, man würde den Betroffenen womöglich vermitteln wollen, sie seien selbst schuld an der Situation. Diese Schlussfolgerung wäre aber wiederum eine zu kurz greifende Kategorisierung. Vielmehr ist die Inblicknahme der eigenen Anteile und der eigenen Verantwortlichkeiten eine Einladung an Betroffene, Selbstwirksamkeit zu erleben und ohne Schuldzuschreibung jenseits von Kategorisierungen Wege aus festgefahrenen und aussichtslos wirkenden Situationen zu finden. Auch bietet sich so ein Zugang für das Umfeld und professionelle Helfer, Menschen auf dem Weg aus einer Mobbingsituation heraus zu unterstützen.
Wie gestaltet man aber konkret die Beratung von Mobbingbetroffenen jenseits von Täter-Opfer-Kategorisierungen? Wie kann man Klienten beistehen, ohne sie in ihrem Opfererleben zu bestärken? Wie kann man sie für die eigenen Anteile am Mobbinggeschehen sensibilisieren, ohne sie gegen sich aufzubringen und einen Abbruch der Beratung zu riskieren? Diesen und weiterführenden Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden.
Dabei liegt der Schwerpunkt in der Vorstellung eines methodischen Vorgehens für die Beratung von Menschen, die sich gemobbt fühlen. Die Haltung, mit der Mobbing betrachtet wird, die Theorien, auf denen die Analyse der Mobbingkonflikte stattfinden, und die Methoden, die in der Beratung benutzt werden, basieren auf dem systemischen Beratungsansatz. Insbesondere mit seiner Fokussierung auf Zusammenhänge und der Auffassung, dass Probleme nicht einzelnen Individuen, sondern der Dynamik in Gruppen bzw. Systemen zuzuschreiben sind, macht systemische Beratung im Besonderen dafür geeignet, den in der Regel hochkomplexen Problemsituationen bei Mobbing zu begegnen. Das systemische Verständnis im Hinblick auf Kausalitäten und Wirklichkeiten sind die Grundlagen des zu beschreibenden Beratungsansatzes. Darüber hinaus ist die Einbeziehung von kontextuellen Zusammenhängen wichtiger Bestandteil der Betrachtung. Auch Überlegungen zur Sinnhaftigkeit von Mobbing sowohl für den Einzelnen als auch für die Organisation werden vorgenommen.
Gedacht ist dieses Buch als fachliche Anregung und Wegweiser für diejenigen, die in der Beratung und Begleitung von Betroffenen in vielfältiger Weise tätig sind. Das beschriebene Vorgehen für die Beratung ist primär für die Arbeit in Einzelsettings entwickelt worden und bezieht sich auf Mobbing im Arbeitsleben. Grundsätzlich sind die Haltung, mit der hier Mobbingkonflikten begegnet wird, als auch viele der methodischen Anregungen auch auf andere Settings anzuwenden (z. B. in Mediations- und Konfliktklärungsprozessen) und in andere Kontexte (z. B. Schule) übertragbar.
Auch wenn dieses Buch nicht primär Ratgeber für Betroffene sein will, ist es mehr als ein Fachbuch für Professionelle. Sich mit Mobbing zu beschäftigen, sei es als Betroffener oder als Professioneller, heißt auch immer, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Nicht von Mobbing betroffen zu sein, bedeutet nicht, zumindest Aspekte aus eigener Erfahrung zu kennen. Wer hat nicht auch schon einmal das Gefühl gehabt, von anderen ausgegrenzt zu werden, und wer kennt nicht auch Situationen aus dem eigenen Lebensweg, in denen er andere ausgegrenzt hat oder zumindest dazu beigetragen hat, dass andere ausgegrenzt werden konnten? Den allermeisten wird auch das Gefühl des Gekränktseins und des Sich-schlecht-behandelt-Fühlens vertraut sein. Der eine oder andere kennt auch das Gefühl der Ausweglosigkeit und die schmerzvolle Einsicht, sei es am Arbeitsplatz oder in der Partnerschaft, in Konstellationen zu verharren, von deren Schädlichkeit man weiß, und in denen man trotzdem verbleibt. Und wer hat sich nicht selbst schon dabei erwischt, anderen die Schuld für das eigene Misslingen zuzuschieben? Alle diese Gefühle und Verhaltensweisen treten auch bei Mobbing auf. Um also zu verstehen, was bei Mobbing passiert, was die Akteure antreibt und was Voraussetzung dafür ist, eigene Anteile und Handlungsmuster erkennen zu können, ist es erforderlich, als Berater den Blick auf eigene diesbezügliche Erfahrungen zu richten. Nur wer sich selbst kennt, kann anderen helfen. Somit können die folgenden Ausführungen auch als Unterstützung für die Entwicklung der eigenen Konfliktkompetenz verstanden werden.
Das Buch lädt auch ein, Mobbing als etwas zu begreifen, das im zwischenmenschlichen Kontakt auftreten kann. Mobbing nicht zu tabuisieren oder zu negieren, sondern als Anlass zu nehmen, in die Auseinandersetzung mit sich und anderen zu gehen, ist ein Kernanliegen des Buchs. Es geht darum, Mobbing aus der Enge eines Denkens in Schuld-Unschuld-Kategorien herauszuholen und es als etwas zu begreifen, in dem bei allem Leid und aller Schwere auch Hoffnung und Entwicklungschancen liegen.
Das Buch ist so aufgebaut, dass zunächst der bisherige Stand der Diskussion zum Thema beleuchtet und die Begrifflichkeit geschärft wird. Es folgen Grundlagen des systemischen Ansatzes und Kernpunkte eines systemischen Verständnisses von Mobbing. Bevor im Hauptteil detailliert ein methodisches Vorgehen und ein Prozessmodell für Beratung vorgestellt werden, wird der Blick auf den Zusammenhang von Mobbing und Kränkung gerichtet und darüber dargestellt, wie Mobbing von Betroffenen emotional verarbeitet wird. Im Hauptteil werden zunächst hilfreiche Fragen für die Beratung erläutert, das prozesshafte Vorgehen beschrieben und anhand eines Fallbeispiels veranschaulicht und vertieft. Dabei werden auch Fragen zu den Zielen der Beratung und Erfolgs- bzw. Misserfolgskriterien aufgeführt. Anschließend wird mit Fokus auf das Denken und Handeln der Betroffenen erläutert, wie alternative Sichtweisen und neue Handlungsoptionen in der Beratung erarbeitet werden können. Last but not least folgen abschließende Hinweise, was jeder Einzelne, aber auch Betriebe oder Organisationen präventiv unternehmen können, um Mobbing zu vermeiden.
Die besonders hervorgehobenen Textabschnitte, die im Buch an verschiedenen Stellen auftauchen, sind als Einschübe gedacht, die bestimmten Aspekten breiteren Raum geben, aber nicht zum inhaltlichen Verständnis grundsätzlich gelesen werden müssen.
Verteilt über alle Kapitel findet sich eine Vielzahl von Fallbeispielen. Sie stellen immer wieder den Praxisbezug her und sollen den Umgang mit Mobbing anschaulich machen. Die Fallbeispiele sind in ihren Schilderungen zum Schutz der Betroffenen verändert, ohne jedoch dadurch an Realität einzubüßen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der männlichen und weiblichen Schreibweise verzichtet. Auch wenn hauptsächlich die männliche Form verwendet wird, sind doch in der Regel beide Geschlechter gemeint. Ferner ist auch nur von Betrieben die Rede, obwohl alle Arten von Arbeitsorganisationen gemeint sind (Unternehmen, Ämter und Behörden, Vereine etc.).
Mythos Mobbing
Mobbing wird heute allgemein als ein Sammelbegriff für alle Arten von systematisch betriebenem feindseligem, drangsalierendem und schikanierendem Verhalten gesehen (Neuberger, 1999). Den Begriff Mobbing (in Englisch »to mob«, gleich anpöbeln, angreifen) prägte zunächst der Verhaltensforscher Konrad Lorenz. Er bezeichnete damit Gruppenangriffe von Tieren auf einen Fressfeind. Allgemein bekannt in der heutigen Bedeutung wurde der Begriff Anfang der 1990er Jahre durch den aus Deutschland nach Schweden ausgewanderten Arzt und Psychologen Heinz Leymann. Er sprach erstmals von Mobbing in Bezug auf das Arbeitsleben und lieferte auch die erste allgemeine Definition:
»Der Begriff Mobbing beschreibt negative kommunikative Handlungen, die gegen eine Person gerichtet sind (von einer oder mehreren anderen) und die sehr oft und über einen längeren Zeitraum hinaus vorkommen und damit die Beziehung zwischen Täter und Opfer kennzeichnen« (Leymann, 1993, S. 21).
Als Merkmale für Mobbing nennt Leymann: Konfrontation, Belästigung, Nichtachtung der Persönlichkeit und Häufigkeit der Angriffe über einem längeren Zeitraum hinweg (Leymann, 1993). Eine Definition von Mobbing speziell auf das Arbeitsleben bezogen entwickelte die von Leymann mitbegründete Gesellschaft gegen psychosozialen Stress und Mobbing e. V.:
»Unter Mobbing wird eine konfliktbelastende Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen verstanden, bei der die angegriffene Person unterlegen ist (1) und von einer oder einigen Personen systematisch, oft (2) und während längerer Zeit (3) mit dem Ziel und/oder dem Effekt des Ausstoßens aus dem Arbeitsverhältnis (4) direkt oder indirekt angegriffen wird und dies als Diskriminierung empfindet« (Leymann, 1995, S. 18).
Schon in den 1990er Jahren bemängelte der Frankfurter Psychologe Oswald Neuberger Leymanns Definition dahingehend, dass die vorgenommene Täter-Opfer-Kategorisierung zu kurz greife und dass beiden Seiten Aktivität zugesprochen werden müsste und nicht die eine Seite (Opfer) nur passiver Empfänger der Initiativen der anderen Seite (Täter) sei (Neuberger, 1999). Auch wenn Neubergers Kritik an der Definition von Leymann allgemein zugestimmt wird, bleiben die meisten Beschreibungen jedoch in dem Kontext der Täter-Opfer-Zuschreibung verhaftet bzw. schenken dem Aspekt der Aktivität des vermeintlichen Opfers wenig Beachtung. So spricht Holger Wyrwa davon: »Auch wenn einfache Täter-Opfer-Zuschreibungen im Allgemeinen zu kurz greifen und die Auslöser von Mobbing nicht ausschließlich nur beim Mobber oder einem Team, der Institution oder der Gesellschaft liegen, sondern unter Umständen auch beim Gemobbten zu verorten sind, darf auch dann – selbst wenn man von Wechselwirkungsprozessen ausgeht – nicht vergessen werden, dass es immer eines konkreten Akteurs bedarf, der sich anmaßt, einen anderen psychisch verletzten zu können« (Wyrwa, 2012, S. 17). Indem aber einer Seite bzw. einem oder mehreren Akteur/-en am Prozess eine schwerwiegendere Täterschaft zugeschrieben wird, droht der Blick für die Wechselseitigkeit und die Verantwortung der anderen Seite verloren zu gehen. In der Betrachtung der Aktivität des vermeintlichen Opfers liegt jedoch in der Regel ein Schlüssel zum Verstehen des Mobbinggeschehens. Die entscheidende Frage, die sich in fast jedem Mobbingprozess grundsätzlich stellt, ist die danach, was ausschlaggebend dafür war, dass mit Mobbing reagiert wurde. In manchen Mobbingprozessen mag es dem unvoreingenommenen Betrachter darüber hinaus auch schwer fallen, zu beurteilen, wer von den Akteuren wen eigentlich mehr psychisch verletzt hat bzw. wer wen eigentlich mehr mobbt, da die Situation durch eine Geschichte gegenseitiger Abwertung und feindseligen Verhaltens geprägt ist. Eine Zuschreibung, wer Täter und wer Opfer ist, ist in solchen Fällen noch weniger möglich. Auch wenn die Handlungsanteile in einem Mobbingprozess durchaus unterschiedlich sein können, ist eine Täter-Opfer-Kategorisierung zur Beschreibung der Situation in jedem Fall ungeeignet, weil sie das Gesamtbild nicht zutreffend darstellt. Eine solche Perspektive ist wertend und überträgt der vermeintlichen Täterseite mehr Verantwortung für das Geschehen und entlässt das vermeintliche Opfer aus seiner Verantwortung an dem Konflikt oder der Spannung. Der Umgang mit Mobbing in unserer Gesellschaft ist jedoch sehr geprägt von der Unterteilung in Täter und Opfer und den in Zusammenhang stehenden Kategorisierungen wie gut – böse und Schuld – Unschuld. Der Mythos, Mobbing sei dadurch gekennzeichnet, ein oder mehrere Täter schikanierten bewusst aus niederen Instinkten wie Neid, Missgunst oder einfach Bösartigkeit andere Menschen und machten das oder die hoffnungslos ausgelieferte(n) Opfer fertig, ist immer noch weit verbreitet.
Neben dem Verbleiben in einem Kategorisierungsdenken wird ferner sowohl in den Definitionen von Mobbing als auch in vielen Publikationen über das Thema kaum darauf eingegangen, dass die Einschätzung eines Verhaltens als Mobbing abhängig ist vom Betrachter. Ganz entscheidend ist aber, ob jemand das, was ihm widerfährt, als Mobbing definiert oder nicht. Verdeutlicht werden kann dies an den von Leymann (1993) definierten 45 häufigsten Mobbinghandlungen. So sieht er z. B. das »Geben ständig neuer Arbeitsaufgaben« oder das »Geben sinnloser oder kränkender Arbeitsaufgaben« bei wiederholtem Male als Indiz für das Vorliegen von Mobbing. Sicher können solche Handlungen als Akt der Schikane und somit als Mobbing angesehen werden. Sie können aber auch anders gedeutet werden, es können mithin andere Wirklichkeitskonstruktionen dafür gefunden werden. So kann das Zuteilen ständig neuer Arbeitsaufgaben auch als Versuch gedeutet werden, mit Leistungseinschränkungen eines Mitarbeiters einen Umgang zu finden und passende, die Einschränkungen berücksichtigende Arbeitsaufgaben zu finden. Was ferner als kränkend oder sinnlos erlebt wird, ist höchst subjektiv und kann in seiner Wahrnehmung diametral dem entgegenstehen, was eigentlich vom Gegenüber beabsichtigt war. So kann »Man wird ständig unterbrochen« auch z. B. der Versuch des Gesprächspartners sein, einen grenzüberschreitenden Redefluss zu stoppen.
Der Gewinn in der Entwicklung bzw. Betrachtung alternativer Wirklichkeitskonstruktionen liegt für den Betroffenen darin, aus der gedanklichen Mobbingschleife entrinnen zu können. Die Gefahr bei der Inblicknahme alternativer Wirklichkeitskonstruktionen ist jedoch, verletzendes Verhalten zu bagatellisieren und das, was der Betroffene erlebt, als womöglich verquere Wahrnehmung zu deklarieren.
Ausdrücklich ist zudem zu betonen, dass nicht für alles, was Menschen als Mobbing erleben, alternative Wirklichkeitskonstruktionen gefunden werden können und auch nicht gesucht werden sollten. Es gibt Vorkommnisse, Verhaltensweisen oder auch Handlungen, die ohne Zweifel als Angriff und als Akt psychischer Gewalt zu definieren sind. Diese sollten auch nicht umgedeutet werden. Für die Beratung von Betroffenen ist es nichtsdestotrotz wichtig für den Berater, den Blick für alternative Wirklichkeitskonstruktionen immer offen zu halten. Was dies konkret bedeutet, wird im weiteren noch Thema sein.
Fasst man nun die Aspekte zur Täter-Opfer-Kategorisierung und zur Wirklichkeitskonstruktion zusammen, lässt sich daraus eine alternative Definition von Mobbing formulieren:
Mobbing entsteht im sozialen Kontakt zwischen Menschen und hat Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Beteiligten. Von Mobbing spricht man dann, wenn über einen längeren Zeitraum mindestens einer der Beteiligten das Verhalten des anderen Beteiligten (oder mehrerer anderer Beteiligter) als diskriminierend und gezielt gegen sich gerichtet wahrnimmt und sich darüber hinaus in eine unterlegene Position gedrängt fühlt (Kleuter, 2010).
Diese Definition versucht bewusst, auf eine Täter-Opfer-Kategorisierung zu verzichten und lässt die Möglichkeit des Vorhandenseins von Wechselwirkungen zu. Ferner wird impliziert, dass die Wahrnehmung von Mobbing ein subjektiver Prozess ist.
Ein weiterer Aspekt, dem in der Diskussion über Mobbing bisher wenig Beachtung geschenkt wurde, ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Macht Mobbing im Zusammenleben von Menschen speziell im betrieblichen Kontext eigentlich Sinn? Hat Mobbing eine Funktion für den Einzelnen, aber auch für die Organisation? Und erhoffen Menschen unter Umständen durch die Formulierung eines Mobbingvorwurfes einen Gewinn für sich oder ziehen sie einen Nutzen daraus? Der Arbeitspsychologe Dieter Zapf sieht zwar »wenig Anlass, anzunehmen, dass sich jemand ohne Grund als Mobbingopfer bezeichnet, und es ist eher zu erwarten, dass man seinen Opferstatus verschweigt« (Zapf, 1999, S. 4). Aus der Erfahrung der Beratungspraxis heraus kann ich Zapfs Einschätzung jedoch nicht teilen. Nach meiner Beobachtung ziehen nicht wenige aus dem Opferstatus auch einen innerpsychischen Nutzen. So ermöglicht der Opferstatus unter anderem, Verantwortung nicht spüren und wahrnehmen zu müssen. Da die Situation durch jemand anderen hervorgerufen wurde und so auch dort die Schuld liegt, ist das »Opfer« vordergründig von eigener Verantwortung befreit. Dies wird von Betroffenen nicht selten als Erleichterung erlebt. Auch kommt es mitunter vor, dass die Formulierung eines Mobbingvorwurfes, manchmal bewusst, aber häufig unbewusst, benutzt wird, um von einem anderen, schwerer wiegenden Problem abzulenken. So kann der selbstdefinierte Status als Mobbingopfer vordergründig davor schützen, sich mit eigenen schwierigen Themen beschäftigen zu müssen.
Der Frage der Sinnhaftigkeit von Mobbing und die diesbezügliche Bedeutung für die Beratung wird im Kapitel »Macht Mobbing Sinn?« ausführlich nachgegangen.
Mobbing gleich Konflikt?
Beschäftigt man sich mit dem Thema Mobbing, spielt nicht nur die definitorische Frage eine Rolle, sondern auch die begriffliche Einordnung und Abgrenzung. Ist Mobbing ein Konflikt oder Ausdruck einer Spannung zwischen einzelnen Personen bzw. Gruppen, oder steht Mobbing für sich als eigenständige Begrifflichkeit?





























