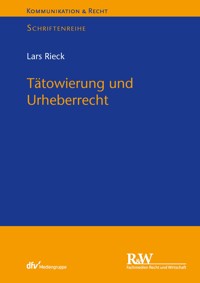
82,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fachmedien Recht und Wirtschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Kommunikation & Recht
- Sprache: Deutsch
Tätowierungen sind längst mehr als reine Körperkunst – sie sind Ausdruck individueller Persönlichkeit, gesellschaftlicher Strömungen und oft auch eines künstlerischen Schaffensprozesses. Doch wie verhält es sich mit dem rechtlichen Schutz dieser Kunstwerke? Welche Rechte stehen den Tätowierern zu, und wie lassen sich die Interessen der Träger von Tätowierungen mit dem Urheberrecht in Einklang bringen? Das Werk beleuchtet die komplexen Schnittstellen zwischen Körperkultur und geistigem Eigentum. Der Autor analysiert, inwieweit Tätowierungen urheberrechtlichen Schutz genießen, welche Urheberpersönlichkeits-, Nutzungs- sowie Verwertungsrechte für Tätowierer bestehen und ob sich ein Tätowierter rechtlichen Einschränkungen bei der Nutzung seines eigenen Körpers gegenübersehen kann. Darüber hinaus werden beispielsweise anhand der Prüfung urheberrechtlicher Schranken praxisnahe Lösungsansätze für Konflikte zwischen Urhebern, Kunden und Dritten entwickelt. Mit wissenschaftlicher Tiefe und hoher Praxisrelevanz bietet dieses Werk eine fundierte urheberrechtliche Orientierung für Juristen, Tätowierer und alle, die sich mit der rechtlichen Einordnung von Körperkunst befassen. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wem die Kunst auf der Haut eigentlich gehört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tätowierung und Urheberrecht
von
Lars Rieck
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Bibliografische Information derDeutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
ISBN 978–3–8005–1980–4
© 2025 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Mainzer
Landstr. 251, 60326 Frankfurt am Main, [email protected]
www.ruw.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, 99947 Bad Langensalza
Danksagung
Britta und Walter Kraemer.
Annegret Rieck.
Alex Coolbaugh.
Prof. Dr. Thomas Hoeren.
Prof. Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl.
Dr. Thomas Schwenke.
Dr. Ole Wittmann.
Dipl. Oec. Manfred Kohrs.
Heiko Gantenberg.
Dr. Steffen Schmidt.
Caroline Stutzmann.
Christa Appel, M. A.
Sabrina Ungemach.
Jens O. Brelle.
Andri Jürgensen.
Stephan Strestik.
Frauke Nückel.
Julian Siebert.
William Robinson.
Stefanie Lamm.
Dirk-Boris Rödel.
Jula Reichard.
Boris A. Glatthaar.
Dr. Igor Eberhard.
Anne-Katrin und Christian Gronewold.
Tanina Palazzolo.
Dr. Mark Benecke.
Gordon Lickefett.
Dr. Timo Mackenzie-Owen.
Dr. Julia Kaupisch.
Marc Cornelius.
Dr. Matt Lodder
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel: Einleitung
A. Untersuchungsgegenstand
I. Ausgangssituation
II. Autor
III. Zielsetzung
IV. Methode und Aufbau
B. Hypothesenbildung
2. Kapitel: Definition, Geschichte und Funktionen
A. Definition und Etymologie
B. Entwicklungsgeschichte
C. Funktionen von Tattoos
I. Körperschmuckfunktion
II. Sozial zuordnende Funktion
III. Medizinische Funktion
IV. Informationsfunktion
V. Zwischenergebnis
D. Vergleichbare und nahe Techniken
I. „Biotattoos“, Henna und Bodypainting
II. Branding und Cutting
III. Piercing, Implantate etc.
IV. Illustration, Graffiti und Leinwandmalerei
V. Bildhauerei
3. Kapitel: Anwendbarkeit des Urheberrechtsgesetzes
A. Werkqualität von Tattoos
I. Werkbegriff, § 2 Abs. 1 UrhG
1. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art gem. § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG
2. Werke der bildenden Künste gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG
a. Tattoovorlagen
b. Tattoos
aa. Urheberrechtliche Rechtsprechung
(1) EU-Ebene
(2) Nationale Ebene
(3) Anwendung durch Instanzgerichte
(4) Zwischenergebnis
ab. Wettbewerbsrechtliche Rechtsprechung
ac. Sozialgerichtliche Rechtsprechung
ad. Finanzgerichtliche Rechtsprechung
3. Zwischenergebnis
II. Persönliche geistige Schöpfung, § 2 Abs. 2 UrhG
B. Zwischenergebnis
4. Kapitel: Urhebereigenschaft und Miturheber bei Tattoos
A. Urheberschaft, § 7 UrhG
I. Künstliche Intelligenz
II. Anregungen
III. Zwischenergebnis
B. Miturheberschaft, § 8 UrhG
I. Gemeinsame Tattoos
II. Tattoosammler und Tattoo Models
III. Illustrationen und Fotos als Vorlagen
IV. Hilfen, Anregungen und Anweisungen
V. Restaurierung
VI. Copycats
VII. Folgen der Miturheberschaft
VIII. Urheber verbundener Werke, § 9 UrhG
1. Illustrationen und Fotos als Vorlage für Tattoos
2. Tattoosammler und Tattoo Models
C. Zwischenergebnis
5. Kapitel: Urheberpersönlichkeitsrechte
A. Veröffentlichung, § 12 UrhG
I. Interessen der Tattoo Artists
II. Interessen der Trägerperson
III. Interessen der Arbeitgeber
IV. Zwischenergebnis
B. Urhebernennung, § 13 UrhG
I. Eingriff
II. Verzicht
III. Verbleibende Rechte
IV. Rücktritt vom Verzicht
V. Drittwirkung des Verzichts
VI. Zwischenergebnis
C. Entstellung, § 14 UrhG
I. Entstellung oder sonstige Beeinträchtigung
1. Ergänzung
2. Veränderung/Überdeckung
3. Restaurierung
4. Entfernung
5. Vernichtung
6. Zwischenergebnis
II. Eignung zur Gefährdung ideeller Interessen des Urhebers
III. Interessenabwägung
1. Kundeninteressen
2. Tattoo Models als Kunden
3. Verwerterinteressen
IV. Entstellung Tattoovorlage
V. Zwischenergebnis
6. Kapitel: Verwertungsrechte
A. Vervielfältigung, § 16 UrhG
I. Tattoos als Vervielfältigung
II. Vervielfältigung von Tattoos
III. Zwischenergebnis
B. Verbreitung, § 17 UrhG
I. Begriffsdefinition
II. Erschöpfung
III. Tattoovorlagen
IV. Zwischenergebnis
C. Ausstellung, § 18 UrhG
D. Vorführung, § 19 Abs. 4 UrhG
E. Öffentliche Zugänglichmachung, § 19a UrhG
F. Bearbeitung und Umgestaltungen, § 23 UrhG
I. Tattoovorlagen
II. Tattoos
1. Tattoos als Umgestaltung
2. Umgestaltungen aus Tattoowerken
3. Tattoos aus Tattoowerken
III. Zwischenergebnis
7. Kapitel: Sonstige Rechte des Urhebers
A. Zugang zu Werkstücken, § 25 UrhG
B. Folgerecht, § 26 UrhG
C. Vergütung für Vermietung und Verleihen, § 27 UrhG
8. Kapitel: Nutzungsrechte
A. Einräumung von Nutzungsrechten, § 31 UrhG
I. Übertragungszweckgedanke
II. Umfang
1. Veröffentlichung und Vervielfältigung
2. Verbreiten
3. Öffentliche Zugänglichmachung
4. Ausstellung
5. Vorführung
6. Bearbeitung
7. Abwägung
8. Tattoovorlagen
III. Zwischenergebnis
B. Verträge über unbekannte Nutzungsarten, § 31a UrhG
I. Einschränkung des Widerrufsrechts gem. §§ 31a Abs. 1 S. 3, Abs. 3 UrhG
1. Tätowierte Körper als Werkverbindung
2. Tätowierte Körper als Sammelwerk
a. Grundlage und Motivation
b. Persönliche geistige Schöpfung
c. Sammlungshersteller
d. Verwertbarkeit nur in Gesamtheit
II. Zwischenergebnis
C. Angemessene Vergütung, § 32 UrhG; Weitere Beteiligung des Urhebers, § 32a UrhG
I. Verhältnis § 32 UrhG zu § 32a UrhG
II. Anspruch gegen Trägerpersonen, § 32a Abs. 1 S. 1 UrhG
1. Verwertung durch Trägerperson
2. Verwertung durch Tattoo Modell
3. Verwertung durch Prominente
4. Zwischenergebnis
III. Anspruch gegen verwertende Dritte, § 32a Abs. 2 UrhG
IV. Zwischenergebnis
D. Weiterwirkung von Nutzungsrechten, § 33 UrhG
E. Übertragung von Nutzungsrechten, § 34 UrhG
I. Zustimmungsrecht
II. Treu und Glauben
III. Reichweite
IV. Zwischenergebnis
F. Einräumung weiterer Nutzungsrechte, § 35 UrhG
I. Umfang Nutzungsrechte
II. Recht zur Unterlizenzierung
III. Zwischenergebnis
G. Gemeinsame Vergütungsregeln, § 36 UrhG
H. Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung, § 40a UrhG
I. Ausschließliches Nutzungsrecht
II. Pauschalvergütung
III. Zeitlich unbeschränkt, § 40a Abs. 3 UrhG
1. Nachrangiger Beitrag
2. Werk der Baukunst oder Entwurf eines solchen Werks
3. Bestimmung als Marke o.Ä.
4. Keine Veröffentlichung
IV. Zwischenergebnis
I. Rückrufsrecht wegen Nichtausübung, § 41 UrhG
1. Fehlende Ausübung
2. Unzureichende Ausübung
a. Unvollständige Ausübung
b. Ausübung durch Dritte
3. Entschädigungspflicht
4. Zwischenergebnis
J. Rückrufsrecht wegen gewandelter Überzeugung, § 42 UrhG
I. Rückruf bezüglich Tattoovorlage
1. Voraussetzungen des Rückrufs
2. Entschädigungspflicht
3. Wiederanbietungspflicht
4. Zwischenergebnis
II. Rückruf bezüglich Tattoowerk
1. Rückruf gegenüber Kunden
a. Überzeugungswandel
b. Unzumutbarkeit
c. Entschädigungspflicht
d. Zwischenergebnis
2. Rückruf gegenüber Dritten
a. Unterlizenzierung
b. Zwischenergebnis
III. Zwischenergebnis
9. Kapitel: Schranken
A. Zitate, § 51 UrhG
I. Zitat von Tattoo
1. Veröffentlichung
2. Copycat-Tattoo
3. Umgestaltung
4. Teile eines Werks
5. Andere Werkformen
6. Zwischenergebnis
II. Zitat durch Tattoo
1. Kopie in Tattooform
2. Umgestaltung
3. Zwischenergebnis
III. Änderungsverbot, § 62 UrhG
IV. Pflicht zur Quellenangabe, § 63 UrhG
V. Dreistufentest
VI. Zwischenergebnis
B. Karikatur, Parodie und Pastiche, § 51a UrhG
C. Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch, § 53 UrhG
I. Privatkopie von Tattoowerk
1. Privater Gebrauch
a. Vorlage
b. Kein Erwerbszweck
c. Herstellung durch andere
d. Zwischenergebnis
2. Sonstiger eigener Gebrauch
a. Eigenes Archiv
b. Archivierungszweck
c. Eigenes Werkstück
d. Schranken-Schranke des § 53 Abs. 2 S. 2 UrhG
e. Schranken-Schranke des § 53 Abs. 6 UrhG
f. Schranken-Schranke des § 53 Abs. 7 UrhG
g. Zwischenergebnis
II. Privatkopie von sonstigem Werk
III. Sonderfall Tattoo von Lichtbild
IV. Koppelung an Vergütung gem. §§ 54ff. UrhG
1. Abwägung
2. Anwendbarkeit
3. Kompensation
4. Zwischenergebnis
V. Schranken-Schranke, § 53 Abs. 4 UrhG analog?
1. Abschreiben
2. Nennenswerte Beeinträchtigung
3. Analoge Anwendung
4. Zwischenergebnis
VI. Änderungsverbot, § 62 UrhG
VII. Zwischenergebnis
D. Beiwerk, § 57 UrhG
I. Hauptwerk und Beiwerk
II. Unwesentlichkeit
III. US-Rechtsprechung
IV. Änderungsverbot, § 62 UrhG
V. Keine Pflicht zur Quellenangabe, § 63 UrhG
VI. Zwischenergebnis
E. Panoramafreiheit, § 59 UrhG
I. Werk i.S.d. § 59 UrhG
II. An öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen
III. Bleibend
IV. Zwischenergebnis
F. Bildnisse, § 60 UrhG
I. Tattoo von Bildnis
II. Vervielfältigung oder Verbreitung Tattoobildnis
III. Zwischenergebnis
10. Kapitel: Verwandte Schutzrechte
A. Ausübender Künstler, § 73ff. UrhG
I. Werk i.S.d. § 73 UrhG
II. Darbietung
III. Zwischenergebnis
B. Schutz des Datenbankherstellers, §§ 87a ff. UrhG
11. Kapitel: Gesetzliche Ansprüche
A. Unterlassung, § 97 Abs. 1 S. 1 UrhG
B. Beseitigung, § 97 Abs. 1 S. 1 UrhG
C. Schadensersatz, § 97 Abs. 2 UrhG
D. Anspruch auf Vernichtung, Rückruf und Überlassung von Vervielfältigungsstücken, § 98 UrhG
E. Zwischenergebnis
12. Kapitel: Änderungsvorschläge
A. Verträge über unbekannte Nutzungsarten, § 31a UrhG
B. Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung, § 40a UrhG
C. Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch, § 53 UrhG
13. Kapitel: Ergebnisse der Untersuchung
A. Bestätigung/Widerlegung der Thesen
B. Ausblick/Prognose künftiger Entwicklungen
C. Desiderate
I. Recht am eigenen Bild
II. Gewerbliche Schutzrechte
III. Gesetzlicher Vergütungsanspruchs des Urhebers bei Ausstellung i.S.d. § 18 UrhG
IV. Tattooschutz analog Lichtbildschutz gem. § 72 UrhG
V. Mitgliedschaft Verwertungsgesellschaft
14. Kapitel: Literaturverzeichnis
1. Kapitel: Einleitung
A. Untersuchungsgegenstand
I. Ausgangssituation
Die Anfertigung von Tattoos hatte noch vor wenigen Jahrzehnten einen vornehmlich negativen Ruf. Das Tätowieren erfolgte oft als inoffizielles Nebengeschäft in Hinterzimmern von in Rotlichtbezirken gelegenen Gaststätten1 oder Friseurbetrieben, zumal der schlechte Ruf häufig eine gewerberechtliche Zulassung als Tätowierbetrieb verhinderte.2
Mittlerweile hat sich die deutsche Tattoobranche jedoch zu einem stetig wachsenden Geschäftsbereich entwickelt. Im Jahr 2012 wurde ihr Jahresumsatz anlässlich einer Stellungnahme des ProTattoo e.V. für den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags auf ca. 50 Millionen Euro geschätzt. Dieser Umsatz soll damals von rund 6.000 offiziellen Studios mit ca. 20.000 Beschäftigten erwirtschaftet worden sein. Dabei wurde von einer Zahl von ca. 2 Millionen angefertigten Tattoos jährlich ausgegangen.3
Seit 2012 dürften diese Zahlen angesichts der allgemein wahrnehmbaren Rezeption von Tattoos in den deutschen Medien und in der deutschen Gesellschaft merklich gestiegen sein. So gaben einer Studie des Ipsos-Instituts (2019) zufolge 21% der befragten deutschen Männer und Frauen an, ein Tattoo oder mehrere Tattoos zu haben. Die Studie geht zudem von rund 8.000 offiziellen Tattoostudios in Deutschland aus.4
Die meisten Tattoostudios pro Kopf der Bevölkerung befinden sich in Deutschland dabei überraschenderweise nicht in international geprägten Großstädten wie Berlin oder Hamburg, sondern überwiegend auf dem Land in Bayern.5
Während Tattoostudios weiter nahezu allerorten entstehen und Reality-TV-Formate wie „LA Ink“, „Miami Ink“ u.a. den Alltag sowie die Arbeitsabläufe von Tattoo Artists begleiten und sie zu Stars machen, bestehen mittlerweile auch soziale Medien mit dem Schwerpunkt auf Videodarstellungen wie z.B. Instagram zu einem erheblichen Anteil aus Darstellungen tätowierter Körper. Sowohl Tattoos Artists als auch Tattoo Models nutzen die sozialen Medien als Hauptwerbeplattform für ihre Angebote.
Gleichzeitig werden große Player der Farben- und Pigmenteindustrie auf den boomenden Markt aufmerksam. So verkündete das bekannte deutsche Traditionsunternehmen Edding in einer Pressekonferenz am 19. August 2020, in Zukunft selbst entwickelte Tattoofarben anzubieten und ab Oktober 2020 sogar mit eigenen Tattoostudios auf den Markt zu treten6, verkündete jedoch im September 2024 überraschend den Ausstieg aus der Branche.7 Die Beiersdorf AG mit ihrer Körperpflegemarke Nivea ging bereits im Herbst 2019 mit Pflegeprodukten speziell für Tattoos auf den Markt.8 Selbst die Textilindustrie hat sich auf den Trend eingestellt und bietet mittlerweile ganze Produktlinien blickdichter Businesshemden für Tätowierte an.9
Mit dem zunehmenden Einfluss der Tattookultur auf die deutsche Bevölkerung sowie durch deren gesellschaftliche Wahrnehmung im Alltag stellen sich vermehrt Fragen über die rechtliche Einordnung von Tattoos und Tattoo Artists bei Konflikten über Immaterialgüterrechte, insbesondere Urheberrechte.
Dabei wohnt dieser Kunstform des Einbringens von Farbe in die menschliche Haut aufgrund des dadurch zum Ausdruck gebrachten persönlichkeitsrechtlichen Anspruchs und des nicht beliebig veränderbaren oder übertragbaren Trägermediums der menschlichen Haut eine ganz besondere Dynamik und Eigenart inne. Kommt es zu Konflikten im Bereich der Immaterialgüterrechte, so können die altbewährten Grundsätze von Normen, Rechtsprechung und Literaturmeinungen nicht ohne Weiteres auf die dortigen Fallgestaltungen übertragen werden. Konflikte im Tattoobereich und Urheberrecht bedürfen daher einer eigenständigen und ausführlichen rechtlichen Betrachtung, zumal das Tattoo meist als Ausdrucksform des allgemeinen Persönlichkeitsrechts besonders bewertet und gewichtet werden muss.
Auch bedarf es einer belastbaren Einordnung der Kunstform des Tätowierens als kreativer Schöpfungsprozess innerhalb des Werkkatalogs des Urheberrechtsgesetzes. Eine einordnende deutsche urheberrechtliche Rechtsprechung ist bislang nicht festzustellen. Deshalb ist die vorhandene urheberrechtliche Rechtsprechung zunächst auf ihre Anwendbarkeit auf den Tattoobereich zu überprüfen.
Hilfsweise heranzuziehende Rechtsprechung aus anderen Rechtsgebieten liefert zum Teil – jedenfalls aus urheberrechtlicher Sicht – unbefriedigende Ergebnisse. So ist Tätowieren in der Vergangenheit jedenfalls in sozialrechtlichen Konflikten höchstrichterlich ausnahmslos als in erster Linie handwerkliche Tätigkeit angesehen worden.10 Diese und andere Rechtsprechung aus weiteren Rechtsgebieten und Rechtskreisen sowie die mittlerweile vereinzelt auftretenden urheberrechtlichen Literaturmeinungen sind im Folgenden zu analysieren. Für urheberrechtlich interessierte Kreise erscheint z.B. die Einordnung jedes Tattoos als rein handwerkliche Leistung als mindestens fragwürdig, denn sie berücksichtigt weder den technischen Fortschritt noch den steigenden künstlerischen Anspruch der aktuellen Generation von Tattoo Artists hinsichtlich ihrer Techniken sowie ihres Schöpfungsprozesses.
Wo die aus einer solchen Neueinordnung resultierenden Rechte der Tattoo Artists als kreative Schöpfer mit den Rechten der Tätowierten oder Dritter kollidieren, ist eine bislang nicht erfolgte ebenso kreative Auslegung der gegebenen Normen und der vorliegenden Rechtsprechung erforderlich.
Aktuell gibt es, wie bereits oben angerissen, zu den sichtbaren oder zu erwartenden urheberrechtlichen Konflikten selbst im internationalen Kontext nahezu keine Rechtsprechung und nur wenig Literatur.
Auch birgt gerade das Spannungsverhältnis zwischen der durch Tattoos ausgedrückten Handlungsfreiheit und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite sowie dem Immaterialgüterrecht und der Kunstfreiheit auf der anderen Seite ein besonderes Konfliktpotenzial.
II. Autor
Der Autor interessiert sich seit Mitte der 1990er-Jahre für Tattoos. In seiner Tätigkeit als selbstständiger Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz ist ihm aufgefallen, dass es in Deutschland nahezu keine Berufszugangs- oder Berufsausübungsregelungen für das Tätowieren gibt. Auch hat er bemerkt, dass in Rechtsprechung und juristischer Literatur – abgesehen von Themen wie Schadensersatz bei missglückten Tattoos sowie dem äußeren Erscheinungsbild von Beamten und Soldaten – kaum rechtliche Einordnungen von Tattoos vorzufinden sind.
Er hat deshalb beschlossen, die wenigen vorhandenen Normen und Entscheidungen auf einer Website zu sammeln sowie dort rechtliche Einschätzungen zu veröffentlichen. In diesem Zusammenhang wurde er von einem befreundeten TattooArtist gefragt, ob es rechtliche Konsequenzen haben könnte, bekannte Cartoonfiguren oder Markenlogos zu tätowieren. Aus den Ergebnissen seiner Nachforschungen zu dieser Frage und sich anschließenden Folgefragen entstanden Fachartikel, Vorträge und schließlich die Idee zu der vorliegenden Dissertation.
III. Zielsetzung
Die vorliegende Arbeit soll zur Einordnung des gesellschaftlichen Phänomens Tattoo in das Rechtsgefüge der Urheberrechte beitragen. Ziel ist, am Urheberrecht und an Tattoos Interessierte für diese besonderen rechtlichen Probleme zu sensibilisieren sowie eine rechtliche Einordnung und erste Ansätze für Lösungen der absehbaren und vorliegenden Konflikte zu bieten.
IV. Methode und Aufbau
Um die angestrebte Einordnung des Phänomens Tattoo in das Rechtsgefüge der Urheberrechte vornehmen zu können, sind zuerst Definitionen, Entstehungsgeschichte, Praktiken und Eigenarten der Tattoobranche aufzuzeigen.
Weiterhin sind aktuelle internationale Fallgestaltungen vorzustellen, um das Problembewusstsein zu schärfen. Damit soll ebenfalls belegt werden, dass Fallgestaltungen mit Tattoos auch im deutschen Urheberrecht jederzeit möglich sind.
Sodann sind solche auch für den europäischen und insbesondere den deutschen Rechtskreis mindestens denkbaren oder sogar aktuell vorliegenden Fallgestaltungen an den gegebenen Normen sowie der bekannten Rechtsprechung im Urheberrecht zu messen.
Schließlich ist ein etwaiger Bedarf für die Anpassung von Normen und die Präzisierung von Rechtsprechung zu formulieren.
B. Hypothesenbildung
Die vorliegende Arbeit soll zur Klärung der urheberrechtlichen Problemstellungen in Bezug auf Tattoos beitragen. Metahypothese ist deshalb, dass auf Tattoos bezogene Rechtsstreitigkeiten in nahezu allen Bereichen des Urheberrechts in Deutschland jederzeit möglich und keineswegs fernliegend sind.
Die grundlegende Hypothese der Arbeit ist, dass nicht nur das Anfertigen von Vorlagen für Tattoos, sondern auch das Anfertigen von Tattoos selbst durch Einbringung von Farbpigmenten in Hautschichten eine persönliche, geistige Schöpfung mit über das handwerklich Normale hinausgehender Schöpfungshöhe und mithin urheberrechtsfähig sein kann.
Die zweite Hypothese der Arbeit lautet darauf aufbauend, dass Tattoo Artists bei Verletzung ihrer Urheberpersönlichkeits-, Nutzungs- und Verwertungsrechte anderen Urhebern wie Fotografen, Bildhauern oder Malern gleichgestellt sind. Damit ist zwangsläufig auch die Anwendbarkeit des urheberrechtlichen Folgerechts aus § 26 UrhG, des § 32a UrhG etc. zu prüfen. Tattoo Artists wären damit auch an der Verwertung ihrer Werke in Bildbänden, Computerspielen, Filmen oder an den Erlösen aus der Tätigkeit als sogenanntes Tattoo Model angemessen zu beteiligen.
Die dritte Hypothese der Arbeit basiert ebenfalls auf der ersten und besagt, dass Tattoo Artists als Urheber auch bezüglich der Veröffentlichung von bearbeiteten Versionen und vor der Entstellung ihres Werks geschützt sind. In diesem Bereich stellen sich grundlegende Fragen hinsichtlich der Abwägung der Rechte des Urhebers mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der Handlungsfreiheit des Tätowierten.
1 Dpa/lno, Museum nimmt Tattoo-Ikone von St. Pauli in den Fokus, 26.11.2019 (https://www.sueddeutsche.de/kultur/ausstellungen-hamburg-museum-nimmt-tattoo-ikonevon-st-pauli-in-den-fokus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191126-99-892258) (geprüft am 29.09.2024); Setzer, Der König der Tätowierer – Nadelstiche der Geschichte, 06.05.2022 (https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.der-koenig-der-taetowierer-nadelstiche-der-geschichte.c8cfdfeb-7abf-44b3-9191-7cf4f106df02.html) (geprüft am 29.09.2024).
2Spamer, in: Eberwein/Petermann (Hrsg.), Die Tätowierung in den deutschen Hafenstädten, 1993, S. 33, 40f.; Petermann, in: Eberwein/Petermann (Hrsg.), Die Tätowierung in den deutschen Hafenstädten, 1993, 13; Feige/Streckenbach, Ein Tattoo ist für immer, 2003, 39; Wittmann, Geschichte, 07.04.2023 (https://warlich-rum.de/pages/geschichte) (geprüft am 29.09.2024).
3Pilath, Wer schön sein will, muss zahlen?, 2012 (https://www.das-parlament.de/2012/18_19/Innenpolitik/38792174-318496) (geprüft am 29.09.2024); Stutzmann, Der Selbstverschuldungs-Paragraph, 2012 (https://protattoo.org/2012/04/13/der-selbstverschuldungs-paragraph/) (geprüft am 29.09.2024).
4 Dpa, Jeder Fünfte in Deutschland ist tätowiert, 2019 (https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-jeder-fuenfte-in-deutschland-ist-taetowiert-dpa.urn-newsml-dpacom-20090101-190923-99-994055) (geprüft am 29.09.2024).
5Milbradt, Tattoo-Studios, 2015 (https://www.zeit.de/zeit-magazin/2015/46/tattoo-studios-bayern-deutschlandkarte) (geprüft am 29.09.2024).
6Hintz, Einstieg in den Tattoo-Markt mit selbst entwickelten, EU-konformen Farben im eigenen Tattoostudio, 2020 (https://web.archive.org/web/20220704084547/https://www.edding.tattoo/presse/edding-einstieg-in-den-tattoo-markt) (geprüft am 29.09.2024).
7Kapalschinski, Tattoos: Edding-Aus weckt große Zweifel an gesundheitlich unbedenklicher Tinte, 2024 (https://www.welt.de/wirtschaft/article253714516/Tattoos-Edding-Aus-weckt-grosse-Zweifel-an-gesundheitlich-unbedenklicher-Tinte.html) (geprüft am 29.09.2024).
8Balzter, Tattoo-Boom: Edding wird zum Tätowierer, 2019 (https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mittelstand/der-stifte-hersteller-edding-wird-zum-taetowierer-16452965.html) (geprüft am 29.09.2024).
9 ETERNA, Cover Shirt (https://www.eterna.de/de/slim-fit-cover-shirt-in-weiss-unifarben/1sh05518-00-01-42-1-1) (geprüft am 29.09.2024).
10 BSG, Urt. v. 28. Februar 2007, Az. B 3 KS 2/07 R, ZUM-RD 2007, 449, 451.
11Feige/Krause, Tattoo-Lexikon, 2004, 244.
12Friederich, Tätowierungen in Deutschland, 1993, 63; Finke, Tätowierungen in modernen Gesellschaften, 1996, 15ff.; Weber, Soziologische Aspekte der europäischen Körpertätowierung, 2003, 6.
13Ruhnke, Die Tätowierung, eine soziokulturelle und medizinische Betrachtung, 1974, 11.
14Weber, 6.
15Oettermann, Zeichen auf der Haut, 1979, 9.
16Oettermann, 9; Petermann, in: Eberwein/Petermann (Hrsg.), Die Tätowierung in den deutschen Hafenstädten, 1993, 7; DeMello, Bodies of inscription, 2003, 45; Feige/Streckenbach, Ein Tattoo ist für immer, 2003, 10.
17DeMello, 45; Petermann, in: Eberwein/Petermann (Hrsg.), 7f.
18Oettermann, 121.
19Petermann, in: Eberwein/Petermann (Hrsg.), Die Tätowierung in den deutschen Hafenstädten, 1993, 115.
20 BSG, Urt. v. 28. Februar 2007, Az. B 3 KS 2/07 R, ZUM-RD 2007, 449, 451.
21Kunter, Paideuma: Mitteilungen zur Kulturkunde 1971, 1, 19; Oettermann, 9; Levy, Tattoos in modern society, 2009, 6ff.
22Kunter, 1; Levy, 6ff.
23Kunter, 16; Oettermann, 12.
24Kunter, 16.
25Levy, 9ff.; Europäische Akademie Bozen, Neuentdeckte Tätowierung auf Ötzis Körper torpediert bisherige Erklärungen Ötzi: Tattoos geben Rätsel auf – scinexx | Das Wissensmagazin, 27.01.2015 (https://www.scinexx.de/news/medizin/oetzi-tattoos-geben-raetsel-auf/) (geprüft am 29.09.2024).
26Levy, 9; Lobstädt, Tätowierung, Narzissmus und Theatralität, 2011, 99; Müller, Ötzis therapeutische Tattoos, 2016 (https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/gletschermumie-oetzis-therapeutische-tattoos) (geprüft am 29.09.2024).
27Kunter, 12ff.
28Kunter, 14; Lombroso, Der Verbrecher in anthropologischer, aerztlicher und juristischer Beziehung, 1887, 270; Oettermann, 12.
29Lombroso, 267; Kunter, 16; Oettermann, 13.
30Oettermann, 14.
31Levy, 9f.
32Lombroso, 267; Kunter, 16ff.; Oettermann, 15; Spamer, in: Eberwein/Petermann (Hrsg.), Die Tätowierung in den deutschen Hafenstädten, 1993, S. 33, 52; Levy, 19.
33 Razzouk Family, Razzouk Tattoo | Since 1300 (http://razzouktattoo.com/) (geprüft am 29.09.2024).
34Petermann, in: Eberwein/Petermann (Hrsg.), 8; Levy, Tattoos in modern society, 2009, 20ff.
35Oettermann, 9.
36Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, 2019, 600f.
37Melville, Moby-Dick oder Der Wal, 2017, 62.
38Spamer, in: Eberwein/Petermann (Hrsg.), 51ff.; Finke, 47f.; Weber, 7; Wittmann, in: Campbell (Hrsg.), Tattoo & Religion, 2019, S. 76, 79; Levy, 23, 52.
39Oettermann, 9.
40Kunter, 1f.; Levy, 25f.
41Kunter, 1.
42Kunter, 2; Weber, 8.
43Lombroso, 255ff.
44Lombroso, 255ff.; Weber, 8, Fn. 17.
45Lombroso, 260ff.
46Ders., 271f.
47Ders., 530.
48Ders., 261.
49Ders., 272.
50Ders., 263.
51Spamer, in: Eberwein/Petermann (Hrsg.), 36; Wittmann, Tattoos, 2015, 22ff. mwN.
52Loos, Ornament und Verbrechen, 2019, 10.
53Oettermann, 109.
54Oettermann, 91f.; Weber, 9; Wittmann, Tattoos, 2015, 28ff.
55Schmidt, Das äußere Erscheinungsbild von Beamtenbewerbern, 2017, 177; Weber, 9f.
56Feige/Krause, 60 m.w.N.; Feige/Streckenbach, Ein Tattoo ist für immer, 2003, 38.
57Klees-Wambach, Kriminologische und kriminalistische Aspekte des Tätowierens bei Rechtsbrechern, 1976, 157.
58 BSG, Urt. v. 28. Februar 2007, Az. B 3 KS 2/07 R, ZUM-RD 2007, 449, 451; Bidlo, Tattoo, 2010, 7; S. Kampmann, in: S. Kampmann/Herrmann/Petri u.a. (Hrsg.), Tattoo, 2011, 40ff.
59Karger, Tätowierte: Anzahl der Tattoos Statista, 2010 (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160696/umfrage/taetowierte-anzahl-der-tattoos/) (geprüft am 29.09.2024).
60 Dpa, Jeder Fünfte in Deutschland ist tätowiert, 2019 (https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-jeder-fuenfte-in-deutschland-ist-taetowiert-dpa.urn-newsmldpa-com-20090101-190923-99-994055) (geprüft am 29.09.2024).
61 PR Newswire, One in Five U. S. Adults Now Has a Tattoo, 2012 (https://www.prnewswire.com/news-releases/one-in-five-us-adults-now-has-a-tattoo-140123523.html) (geprüft am 29.09.2024).
62Kunter, 2.
63Finke, 158.
64Weber, 11–26.
65Meier, Inked: 0,3 mm unter der Haut der Gesellschaft, 2010, 48–54.
66Ders., 28ff.; 65f.
67Meier, 48ff.; Weber, 2.
68Binnie, in: Campbell (Hrsg.), Tattoo & Religion, 2019, S. 20, 21; Wittmann, in: Campbell (Hrsg.), Tattoo & Religion, 2019, S. 76, 81.
69Feige/Streckenbach, 23; Weber, 7.
70Morel, Lash Enhancement Tattoos Are About to Be the Hottest New Trend, 13.02.2017 (https://www.allure.com/story/lash-enhancement-tattoos-are-about-to-be-the-hottestnew-trend) (geprüft am 29.09.2024).
71Kohrs, in: Campbell (Hrsg.), Tattoo & Religion, 2019, 89.
72Friederich, 275ff.; Finke, 131ff.; Oettermann, 11ff.
73Gilbert, Tattoo History, 2000, 15f.; Oldenburger, Die Geschichte der Tattoos: Das Phänomen der Zeit, 22.05.2022 (https://www.mytattoo.com/de/blog/die-geschichte-der-tattoos/) (geprüft am 29.09.2024).
74Oettermann, 104.
75Gilbert, 77; Rödel, Alles über japanische Tätowierungen, 2004, 21.
76McCallum, in: Rubin (Hrsg.), Marks of civilization, 1988, 116f.; Rödel, 21f., 28ff.
77Rödel, 21.
78Rojkov, Auschwitz-Gedenken: Tätowiertes Mahnmal, 26.01.2015 (https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-01/auschwitz-gedenken-tattoos-kz-nummern) (geprüft am 29.09.2024); Stölzner, Das Erbe der Shoa: Die Häftlingsnummer als Bricolage, 2016 (https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/das-erbe-der-shoa-die-haeftlingsnummer-als-bricolage/) (geprüft am 29.09.2024); Cwojdzinski, Die Tätowierung als Medium, 2019, 202.
79Müller, Zuhälter-Methoden: Für Fluchtversuch verprügelt, rasiert und tätowiert, 26.03.2012 (https://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article13947307/Fuer-Fluchtversuch-verpruegelt-rasiert-und-taetowiert.html) (geprüft am 29.09.2024); Norak, Eigentums-Tattoos von Zuhältern – Betroffene identifizieren, 2020 (https://sandranorak.com/2020/10/17/eigentums-tattoos-von-zuhaltern-betroffene-identifizieren/) (geprüft am 29.09.2024); Norak, Tattoos in der Prostitution als Eigentumsstempel der Zuhälter, 02.06.2020 (https://www.trauma-and-prostitution.eu/2020/06/03/tattoos-in-der-prostitution-als-eigentumsstempel/) (geprüft am 29.09.2024); Sidner, Zuhälter brandmarken ihre Prostituierten als Eigentum, 2015 (https://www.woman.at/gesellschaft/zuhaelter-prostituierte) (geprüft am 29.09.2024).
80Aitken-Smith, TattooDictionary, 2017, 215f.
81Wittmann, in: Campbell (Hrsg.), 81.
82Ders., in: Campbell (Hrsg.), 82.
83Hüter, Geburtshilfe und Frauenheilkunde 36 (1976), 10, 13; Kohrs, in: Campbell (Hrsg.), 89.
84Winkler, pardon 1975 (01.04.1975), 14, 18.
85Feige/Streckenbach, 17ff.
86Akintola, Süddeutsche Zeitung 13.05.2018.
87Lobstädt, Tätowierung, Narzissmus und Theatralität, 2011, 125.
88 Memento (2000) – IMDb (https://www.imdb.com/title/tt0209144/) (geprüft am 29.09.2024).
89 Prison Break (TV Series 2005–2017) – IMDb (https://www.imdb.com/title/tt0455275/?ref_=nv_sr_srsg_0) (geprüft am 29.09.2024).
90Donelly, 5 Reasons Why BarcodeTattoosAren’t Such A Great Idea, 2020 (https://www.tattoodo.com/a/5-reasons-why-barcode-tattoos-arent-such-a-great-idea-4815) (geprüft am 29.09.2024); Siggard, Skin MotionTM – Tattoos brought to life!, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=-7U1LWoDZUQ) (geprüft am 29.09.2024).
91Cooper/Aronowitz, Journal of General Internal Medicine 2012, 1383, 1383ff.; Holt/Sarmento/Kett u.a., The New England journal of medicine 377 (2017), 2192, 2192ff.; Rieck, Müssen Ärzte ein „Keine Wiederbelebung!“-Tattoo beachten?, 13.12.2017 (https://tattoo-recht.de/muessen-aerzte-ein-bitte-nicht-wiederbeleben-tattoo-beachten/) (geprüft am 29.09.2024).
92 ROSE PARTNER Rechtsanwälte Steuerberater, Tisch, Tätowierung, Testament, 09.11.2020 (https://www.rosepartner.de/blog/tisch-taetowierung-testament.html) (geprüft am 29.09.2024); RINCK Notare Rechtsanwälte Fachanwälte, Tätowiertes Testament?! Die Kirche soll erben, 25.05.2024 (https://www.youtube.com/shorts/Jxpk4yWOQP0) (geprüft am 29.09.2024).
93Junge Helden e.V., OPT.INK – Das Organspende-Tattoo, 2023 (https://junge-helden.org/optink#map) (geprüft am 29.09.2024).
94Rieck, Operation Tat-Type: Tattoos für den nuklearen Ernstfall, 28.01.2019 (https://tattoo-recht.de/operation-tat-type-tattoos-fuer-den-nuklearen-ernstfall/) (geprüft am 29.09.2024).; OrangeBean Indiana, The Atomic Tattoo Experiment, 2020 (https://orangebeanindiana.com/2020/01/07/indiana-blood-type-tattoo/) (geprüft am 29.09.2024); Wolf/Laumann, Journal of the American Academy of Dermatology 58 (2008), 472ff.; Yeager, Atomic Tattoos – 99% Invisible, 15.01.2019 (https://99percentinvisible.org/episode/atomic-tattoos/) (geprüft am 29.09.2024).
95Reichard/Schaab, Tätowier Magazin 2020, 62ff.
96Kohrs, in: Campbell (Hrsg.), 88.
97Schaab/Kohrs, Tätowier Magazin 2020, 80.
3. Kapitel: Anwendbarkeit des Urheberrechtsgesetzes
Fraglich ist, ob die in Deutschland vorhandene urheberrechtliche Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur geeignet sind, die Besonderheiten tattoobezogener Fallgestaltungen angemessen zu berücksichtigen.
Im Weiteren ist zunächst zu erörtern, ob Tattoos als Werke im urheberrechtlichen Sinne eingeordnet werden können. Sodann ist das Ergebnis der Erörterung auf die existierenden urheberrechtlichen Regelungen anzuwenden.
A. Werkqualität von Tattoos
Bei der Beantwortung der Frage, ob es sich bei Tattoos um urheberrechtsfähige Werke handelt, sind zunächst zwei getrennte Betrachtungen erforderlich. Bei der Beurteilung ist zwischen den Ergebnissen der Erstellung eines Tattoos und einer Tattoovorlage zu unterscheiden. Diese Differenzierung ist erforderlich, da in der wenigen vorhandenen tattoobezogenen Rechtsprechung98 in Deutschland bei der Bewertung teilweise ausdrücklich zwischen dem Anfertigen von Tattoovorlagen und demjenigen von Tattoos unterschieden wird. Die Unterscheidung ist in der o.g. Rechtsprechung von wesentlicher Bedeutung für den Ausgang der Beurteilung, ob jeweils Werkqualität gegeben ist, wie im Weiteren noch zu erörtern sein wird. Zunächst sind beide Begriffe jedoch zu definieren.
Tattoos sind, wie bereits oben definiert (s.o.S. 6), das optisch wahrnehmbare Ergebnis der willentlichen Einbringung von Farbpigmenten in die oberen Hautschichten der menschlichen Haut auf manuelle oder maschinelle Weise.99
Bei Tattoovorlagen handelt es sich um von Menschen entworfene, analoge oder digitale Zeichnungen, die auf Papier, vergleichbaren Trägermaterialien oder z.B. mithilfe von elektronischen Zeichentablets erstellt werden.
Sodann sind sowohl Tattoos als auch Tattoovorlagen am Werkbegriff und den Werkarten des § 2 UrhG zu messen.
98 BFH, Urt. v. 23.07.1998, Az. V R 87/97, DStRE 1998, 771; BSG, Urt. v. 28. Februar 2007, Az. B 3 KS 2/07 R, ZUM-RD 2007, 449; OLG Hamburg, Urt. v. 04.05.2011, Az. 5 U 207/10, GRUR-RR 2012, 26; LSG für das Saarland, Urt. v. 09.06.2020, Az. L 1 R 23/19, openJur 2021, 7868; SG Hamburg, Urt. v. 18.06.2020, Az. S 48 KR 1921/19, openJur 2020, 47924.
99Finke, 15ff.; Friederich, 63; Weber, 6.
I. Werkbegriff, § 2 Abs. 1 UrhG
§ 2 Abs. 1 UrhG definiert unter den Oberbegriffen Literatur, Wissenschaft und Kunst einen Katalog an Werkarten.100 Dieser Katalog soll nach dem Willen des Gesetzgebers nicht abschließend sein, wie die Verwendung des öffnenden Adverbs „insbesondere“ in § 2 Abs. 1 UrhG zeigt.101
Sowohl bei Tattoos als auch bei Tattoovorlagen handelt es sich jeweils um eine Form von Illustration auf und bezüglich Tattoos in einem Trägermedium. Damit bietet sich, wie bei anderen Illustrationen, die Einordnung unter den Oberbegriff der Kunst an. Angesichts des Katalogs der Kunstformen des § 2 Abs. 1 UrhG liegt die Vermutung nahe, dass es sich entweder um Darstellungen i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG, um Werke der bildenden oder der angewandten Kunst i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG sowie hinsichtlich der Vorlagen um Entwürfe solcher Werke handeln muss.
100G. Schulze, in: Dreier/G. Schulze/Raue u.a. (Hrsg.), UrhG, 2022, § 2, Rn. 2.; Loewenheim/Leistner, in: Schricker/Loewenheim/Leistner (Hrsg.), UrhR, 62020, § 2, Rn. 5.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger (Hrsg.), UrhR, 2022, § 2, Rn. 4.
101G. Schulze, in: Dreier/G. Schulze/Raue u.a. (Hrsg.), UrhG, 2022, § 2, Rn. 3.; Loewenheim/Leistner, in: Schricker/Loewenheim/Leistner (Hrsg.), UrhR, 62020, § 2, Rn. 5.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger (Hrsg.), UrhR, 2022, § 2, Rn. 2.
1. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art gem. § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG
Werke gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG sollen Informationen über den in ihrem Fokus stehenden wissenschaftlichen oder technischen Gegenstand vermitteln.102 Sowohl Tattoovorlagen als auch Tattoos selbst können und sollen diese Voraussetzung gemäß ihren häufigsten Funktionen nicht erfüllen (s.o.S. 11ff.). Sie befassen sich zumeist schon nicht mit einem wissenschaftlichen oder technischen Gegenstand. Jedenfalls erfolgt der Transport von Informationen in aller Regel allenfalls als Zusatz zur vornehmlich gewünschten Schmuckfunktion (s.o.S. 12ff.). Eine Einordnung von Tattoovorlagen und Tattoos als Werke i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG liegt demnach fern.
102G. Schulze, in: Dreier/G. Schulze/Raue u.a. (Hrsg.), UrhG, 2022, § 2, Rn. 222.; Loewenheim/Leistner, in: Schricker/Loewenheim/Leistner (Hrsg.), UrhR, 62020, § 2, Rn. 226.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger (Hrsg.), UrhR, 2022, § 2, Rn. 131.
2. Werke der bildenden Künste gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG
Aufgrund ihrer Nähe zum Bereich der Illustration, Malerei und Bildhauerei bietet sich für Tattoovorlagen und Tattoos eine Einordnung in die Werkarten des § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG, mithin in den Bereich der bildenden oder angewandten Künste an. Auch einige Stimmen der juristischen Literatur ordnen Tattoos den Werken der bildenden Künste zu.103 Ob diese Kategorisierung für Tattoovorlagen und Tattoos selbst zutreffen kann, ist im Folgenden zu untersuchen. Dazu ist zunächst der urheberrechtliche Begriff der bildenden Kunst zu definieren.
Alle Gestaltungen, die in zwei oder drei Dimensionen erfolgen und ihren ästhetischen Wert durch den Einsatz von formgebenden Mitteln wie Farbe, Linie, Fläche, Raumkörper und Oberfläche vermitteln, werden dem Oberbegriff der bildenden Kunst untergeordnet.104 Werke der bildenden Kunst im engeren Sinne sind ausschließlich durch eine formgebende Tätigkeit gekennzeichnet105 und dienen keinem funktionellen Gebrauchszweck.106
103A. Nordemann, in: A. Nordemann/J. B. Nordemann/Czychowski (Hrsg.), UrhR, 2018, § 2, Rn. 184.; Duvigneau, ZUM 1998, 535, 542; Mezger, Die Schutzschwelle für Werke der angewandten Kunst nach deutschem und europäischem Recht, 2016, 64; Leßmöllmann/Peifer, Tattoo-Recht: Diese Strafen drohen bei kopierten Motiven!, 2019 (https://feelfarbig.com/artikel/diese-strafen-drohen-bei-kopierten-motiven/) (geprüft am 29.09.2024); Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 2021, Rn. 234.
104A. Nordemann, in: A. Nordemann/J. B. Nordemann/Czychowski (Hrsg.), Rn. 137.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger (Hrsg.), UrhR, 2022, § 2, Rn. 81.
105 BGH, Urt. v. 09.12.1958, Az. I ZR 112/57, GRUR 1959, 289, 290; BGH, Urt. v. 19.01.1979, Az. I ZR 166/76, GRUR 1979, 332, 336.
106 BGH, Urt. v. 12.05.2011, Az. I ZR 53/10, GRUR 2012, 58, Rn. 17; OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.10.2007, Az. I-20 U 64/07, ZUM 2008, 140, 142; G. Schulze, in: Dreier/G. Schulze/Raue u.a. (Hrsg.), UrhG, 2022, § 2, Rn. 158.; A. Nordemann, in: A. Nordemann/J. B. Nordemann/Czychowski (Hrsg.), 138f.; Loewenheim/Leistner, in: Schricker/Loewenheim/Leistner (Hrsg.), UrhR, 62020, § 2, Rn. 165.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger (Hrsg.), UrhR, 2022, § 2, Rn. 86.
a. Tattoovorlagen
Tattoovorlagen sind Zeichnungen aus menschlicher Hand. Sie vermitteln ihren ästhetischen Wert zweidimensional durch Farbe, Linie und Fläche (s.o.S. 21).
Werden Tattoovorlagen einzig dazu angefertigt, sie zur Erstellung einer Schablone oder eines sogenannten „Stencil“ abziehbildartig auf die Haut des Kunden aufzubringen, damit der TattooArtist sich bei Erstellung des Tattoos daran orientieren kann, ist dies als funktioneller und einziger Gebrauchszweck anzunehmen. Die Klassifizierung als Werk der bildenden Kunst im engeren Sinne scheidet damit nach der o.g. Definition aus.
Dies eröffnet jedoch angesichts des beschriebenen Gebrauchszwecks als Werk der angewandten Kunst die Einordnungsmöglichkeit als Werk der bildenden Kunst im weiteren Sinne.
Schließlich ergibt sich auch die naheliegende Einstufung als Entwurf eines Werks gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG, allerdings nur dann, wenn sich Tattoos selbst innerhalb der noch folgenden Prüfung als Werke der bildenden Kunst i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG herausstellen. In diesem Fall bietet sich diese letzte Kategorisierung als naheliegendste für Tattoovorlagen an.
Eine Unterscheidung innerhalb des § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG mag zunächst überflüssig erscheinen, hat jedoch z.B. in Hinblick auf das Folgerecht aus § 26 UrhG Konsequenzen. Gemäß § 26 Abs. 8 UrhG gilt dieses nicht für Werke der Baukunst und der angewandten Kunst.
Soweit sie nicht nur als zeitweilige Vorlage zur unmittelbaren Anfertigung eines Tattoos, sondern beispielsweise auch als Wandschmuck wie andere Zeichnungen, Gemälde oder Lithografien genutzt werden sollen, sind Tattoovorlagen angesichts ihres ästhetischen Gehalts und in Ermangelung eines rein funktionellen Gebrauchszwecks der Werkart der reinen bildenden Kunst gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG zuzuordnen.
Auf der Suche nach einer geeigneten Werkart zur Klassifizierung von Tattoovorlagen ist somit auf die im Katalog des § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG genannte Werkart der bildenden Kunst zurückzugreifen.
b. Tattoos
Die Klassifizierung von Tattoos in den Katalog des § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG fällt ungleich schwerer.
Zunächst ist bei einem Tattoo ähnlich wie bei Illustration, Malerei und Bildhauerei an ein Werk der reinen bildenden Kunst zu denken. Neben der zumeist als schmückend beabsichtigten Umgestaltung des Anblicks der betroffenen menschlichen Hautstellen erscheint ein Gebrauchszweck jedenfalls bei oberflächlicher Betrachtung nicht ersichtlich (s.o.S. 11ff.).
Würde man die Schmuckfunktion jedoch als einen die zweckfreie Kunst ausschließenden Gebrauchszweck ansehen, käme jedenfalls eine Einordnung in den Bereich der angewandten Kunst infrage.
Schließlich besteht auch die Möglichkeit, dass es sich bei einer Vielzahl eher alltäglicher Tattoos um Werke der angewandten Kunst und, bei einigen wenigen, z.B. im Rahmen eines Kunstprojekts entstandenen und damit ansonsten zweckfreien, besonders kreativen und hochwertigen Tattoos mit starker künstlerischer Aussage um Werke der bildenden Kunst handelt. Allerdings fehlt es Tattoos wegen ihrer ortsgebundenen Manifestation in der Haut ihrer Trägerperson an einer den Werken der angewandten Kunst anhaftenden Produkteigenschaft in Form eines beliebig handelbaren Erzeugnisses. Dies würde gegen ein Werk der angewandten Kunst sprechen. Der urheberrechtliche Werkbegriff in Bezug auf Werke der angewandten Kunst ist deshalb im Folgenden näher zu erörtern.
Ob die Eigenschaften von Tattoos und insbesondere die Schmuckfunktion dazu geeignet sind, eine Einordnung von Tattoos in den Bereich der reinen bildenden und damit zweckfreien Kunst zu versagen, wird anschließend zu erörtern sein.
Schließlich ist auch der jeweilige Schutzumfang zu bewerten.
In Ermangelung einschlägiger deutscher Rechtsprechung in urheberrechtlichen Streitigkeiten über Tattoos und zur Bewertung der o.g. juristischen Stimmen und Fragestellungen erscheint zur urheberrechtlichen Einordnung von Tattoos in den Werkkatalog des § 2 UrhG eine Analyse der höchstrichterlichen Rechtsprechung der letzten Jahre zur Werkqualität im Urheberrecht erforderlich (aa.). Im Interesse der Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist sodann ergänzend die tattoobezogene Rechtsprechung aus anderen Rechtsgebieten zu betrachten (ab. bis ad.). Insbesondere Entscheidungen des Bundessozialgerichts (im Weiteren: BSG), des Sozialgerichts (im Weiteren: SG) Hamburg, des Landessozialgerichts (im Weiteren: LSG) für das Saarland, des Bundesfinanzhofs (im Weiteren: BFH) und des Oberlandesgerichts (im Weiteren: OLG) Hamburg sind bei der Frage der Einordnung von Tattoos als Kunst zu analysieren.
aa. Urheberrechtliche Rechtsprechung
Als Beobachtungszeitraum für die Analyse der obergerichtlichen urheberrechtlichen Rechtsprechung der letzten Jahre wird ein Zeitraum von rund
13 Jahren angesetzt. Dieser wird so gewählt, um insbesondere den Umbruch in der urheberrechtlichen Rechtsprechung des BGH zum Werkbegriff und zur Werkqualität sowie zur Abgrenzung der Werke der angewandten Kunst von Werken der bildenden Kunst in dem Urteil vom 13. November 2013 zum Az. I ZR 143/12 – Geburtstagszug darstellen und einordnen zu können. Weiter soll auch die einschlägige Rechtsprechung auf europäischer Ebene bis hin zur Folgerechtsprechung ausgewählter unterer Instanzen beleuchtet werden, um anhand des sich bietenden Gesamtbilds eine Einordnung für Tattoos vornehmen zu können.
(1) EU-Ebene
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes (im Weiteren: EuGH) vom 13. November 2018 in Sachen Levola Hengelo BV ./. Smilde Foods BV postulierte erstmals einen autonomen, EU-einheitlichen, allgemeinen Werkbegriff107 im Sinne der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft108 (im Weiteren: InfoSoc-RL).
Zunächst müsse eine geistige Schöpfung eines Urhebers vorliegen, die einen Teil seiner Persönlichkeit beinhalte und wiedergebe.109 Zudem müssten Gestaltungselemente zwingend solche Schöpfungen ausdrücken, um ihnen Werkcharakter zugestehen zu können.110 Da aber die Formulierung „Werke der Literatur und Kunst“ gemäß Art. 2 Abs. 1 der Berner Übereinkunft alle Erzeugnisse auf dem Gebiet der Literatur, Wissenschaft und Kunst ohne Rücksicht auf die Art und Weise und die Form des Ausdrucks erfasse sowie sich der urheberrechtliche Schutz gemäß Art. 2 des WIPO-Urheberrechtsvertrags und Art. 9 Abs. 2 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums auf Ausdrucksformen erstrecke, bedeute der Ausdruck „Werk“, auf den sich die InfoSoc-Richtlinie bezieht, zwangsläufig eine Darstellungsform des durch das Urheberrecht geschützten Gegenstands, die dessen Identifizierung oder Wahrnehmung mit ausreichender Präzision und Objektivität ermögliche, auch wenn diese Darstellungsformen nicht zwingend von dauerhafter Natur sein müssten.111
Mit seinem Urteil vom 12. September 2019 in Sachen Cofemel-Sociedade de Vestuário SA ./. G-Star Raw CV präzisierte der EuGH den in Sachen Levola Hengelo BV ./. Smilde Foods BV112 geschaffenen allgemeinen Werkbegriff und klärte das Verhältnis des Urheberrechts zum Designschutz weiter.
Demnach führe die subjektiv wahrgenommene ästhetische Wirkung eines Modells allein nicht dazu, dass man auf einen Gegenstand schließen könne, der im Sinne des zuvor genannten allgemeinen Werkbegriffs des EuGH mit ausreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbar sei.113 Zum anderen könnten ästhetische Erwägungen zwar das Ergebnis schöpferischer Tätigkeit sein. Jedoch sei die bloße ästhetische Wirkung nicht ausreichend, um zu bestimmen, ob es sich um eine geistige Schöpfung handele, die die Entscheidungsfreiheit und die Persönlichkeit des Urhebers reflektiere und somit Originalität verkörpere.114
In seinem Urteil vom 11. Juni 2020 im Fall SI, Brompton Bicycle Ltd gegen Chedech/Get2Get wandte der EuGH den einheitlichen Begriff des Werks erneut auf Produkte an, bei denen die Form zumindest teilweise durch das Ziel eines technischen Ergebnisses bestimmt wird. Wenn es sich bei diesen Produkten um originale Werke handele, die aus einer geistigen Schöpfung hervorgegangen seien, weil der Schöpfer des Werks durch die Auswahl der Produktform seine kreative Kompetenz auf eine eigenständige Art und Weise demonstriere, indem er freie und kreative Entscheidungen treffe, die seine Persönlichkeit reflektierten, könne auch für solche Erzeugnisse Urheberrechtsschutz gewährt werden.115 Ein Gegenstand könne nur dann nicht als Werk im Sinne des einheitlichen Werkbegriffs des EuGH betrachtet werden, wenn seine Erstellung ausschließlich durch technische Überlegungen, Vorschriften oder sonstige Einschränkungen bestimmt werde, die keinen Spielraum für die Ausübung künstlerischer Freiheit und somit für kreative Entscheidungen böten, wodurch die notwendige Originalität für die Anerkennung als Werk zwangsläufig fehlen müsse.116
In Bezug auf Tattoos





























