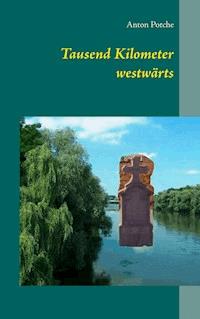
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ruhtraud Münch verlässt nach den Wirren der Oktoberrevolution ihre Heimatstadt Tarutino und versucht im Banat ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das Dorf, in dem sie eine Anstellung als Dienstmädchen findet, bleibt ihr fremd. Die Mühlsteine des Dorfalltags verschonen auch die herrisch gekleidete Fremde nicht. Strenge Sitten und Bräuche markieren das Leben der selbst im Diasporazustand lebenden Banater Schwaben. Das schüchterne Mädchen liebt und leidet und verstößt gegen die ungeschriebenen Gesetze der bäuerlich geprägten Dorfgemeinschaft. Doch gibt es kein Zurück in die Weiten der bessarabischen Steppe. Das Leben drängt Ruhtraud Münch vorwärts, hinein in die Auswirkungen der Nazipropaganda und die schrecklichen Folgen des Zweiten Weltkrieges. Schreckgespenster durchziehen auch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ruhtraud trägt ihr Dasein als Außenstehende in einer sich wandelnden und schließlich der Auflösung anheimfallenden Gemeinschaft im Südosten Europas während der kommunistischen Diktatur mit Würde und heimlichen Tränen. Auch ihrer Enkelin Julia wird ein ähnliches Schicksal zuteil. Die junge Frau setzt Familie und Leben aufs Spiel, um einer von Konventionen und Kontrollen geprägten Welt zu entrinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Exposé
Ruhtraud Münch verlässt nach den Wirren der Oktoberrevolution ihre Heimatstadt Tarutino und versucht im Banat ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das Dorf, in dem sie eine Anstellung als Dienstmädchen findet, bleibt ihr fremd.
Die Mühlsteine des Dorfalltags verschonen auch die „herrisch“ gekleidete Fremde nicht. Strenge Sitten und Bräuche markieren das Leben der selbst im Diasporazustand lebenden Banater Schwaben.
Das schüchterne Mädchen liebt und leidet und verstößt gegen die ungeschriebenen Gesetze der bäuerlich geprägten Dorfgemeinschaft. Doch gibt es kein Zurück in die Weiten der bessarabischen Steppe. Das Leben drängt Ruhtraud Münch vorwärts, hinein in die Auswirkungen der Nazipropaganda und die schrecklichen Folgen des Zweiten Weltkrieges.
Schreckgespenster durchziehen auch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ruhtraud trägt ihr Dasein als Außenstehende in einer sich wandelnden und schließlich der Auflösung anheimfallenden Gemeinschaft im Südosten Europas während der kommunistischen Diktatur mit Würde und heimlichen Tränen.
Auch ihrer Enkelin Julia wird ein ähnliches Schicksal zuteil. Die junge Frau setzt Familie und Leben aufs Spiel, um einer von Konventionen und Kontrollen geprägten Welt zu entrinnen.
Vita des Autors
Anton Potche wurde 1953 in Jahrmarkt (rum.: Giarmata) / Rumänien geboren. 1973 legte er seine Bakkaulareatprüfung am Industrielyzeum für Maschinenbau in Temeswar ab und arbeitete anschließend als Maschinenschlosser. Seit 1984 lebt er in Ingolstadt und übt einen gewerblichen Beruf aus. Er hat viele Beiträge zu gesellschaftlichen und kulturellen Themen sowie Gedichte, Erzählungen und Übersetzungen aus dem Rumänischen in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften, Anthologien sowie im Internet veröffentlicht.
Inhalthaltsverzeichnis
Steppenwind
Holunderzeit
Feuersbrunst
Eiszeit
Tauwetter
Anmerkungen und Worterklärungen (*)
Nachwort
Das Verblassen der Realität verhilft der Fiktion zu ihrem Recht.
Personen und Handlung dieses Romans sind frei erfunden. Aber gewisse Ähnlichkeiten mit den Geschehnissen in einem ehemals deutsch geprägten Dorf im rumänischen Banat sind unvermeidlich.
I
Steppenwind
1
Die Erdklumpen lösten beim Aufprallen ein dumpfes Geräusch aus, das wie Keulenschläge auf den viel zu früh ergrauten Mann und die zwei Mädchen wirkte. Es klingt so, als ob der Sarg leer wäre, ging es dem Bauer durch den Kopf, doch nur für einen Augenblick, denn das nun grollende Fallen der Erde und das Aufschluchzen des größeren Mädchens zu seiner Rechten ließen ihn die furchtbare Gewissheit zum wiederholten Male in den letzten drei Tagen spüren.
Die vier Totengräber schaufelten drauflos. Einer zog seine Jacke aus und spuckte diensteifrig in die Hände. Die Hacken gruben sich in die Erde und formten einen Hügel. Der Friedhof von Tarutino wurde soeben um ein Grab reicher.
Die Herbstsonne stand schon tief über dem Horizont und der ewige Nordostwind schien es sehr eilig zu haben. Lorenz Münch nahm das vierjährige Mädchen auf den Arm.
Das andere Kind weinte noch immer leise vor sich hin. Es verstand schon etwas von dem Vorgefallenen und hatte Angst: Wenn Mutter jetzt wieder aufwacht, wenn sie ruft, zu uns will, heraus aus dieser engen Kiste?!
Die Hand des Vaters durchschnitt diese Gedankenstränge des Mädchens. Er streichelte sein glattes, in einen langen Zopf mündendes Haar und suchte seine Augen. Die Stimme klang rau, aber verständnisvoll und selbst jetzt noch zuversichtlich, als er sagte:
„Emilie, unsere Mutter ist bestimmt schon im Himmel. Sie war ein viel zu guter Mensch, als dass sie jetzt woanders sein könnte.“
„Kann sie uns wirklich sehen?“ Hoffnung und Erleichterung schwang in dieser Frage mit. „Natürlich. Du hast doch gehört, was Pastor Huber gesagt hat. Im Himmel gibt es ein Wiedersehen und von da oben sieht man die ganze Erde.“
„Wird Mutter auch die kleine Ruhtraud sehen?“
„Sie wird bestimmt im Himmel für ihr kleines Mädchen beten. Und sie wird auch für dein Schwesterlein Hulda, für dich und für mich beten.“
Lorenz Münch nahm Emilie an der Hand und mit Hulda auf dem muskulösen Arm schritten sie langsam dem Städtchen zu. Es waren viele Leute beim Begräbnis, dachte er.
Auch der Oberschulze war gekommen, und der Volost-Schreiber*. Es war fast so wie bei der Beerdigung eines städtischen Würdenträgers. Gleich hinter Lorenz und den Mädchen waren seine Schwiegereltern, seine Schwester und deren Mann im Leichenzug gegangen. Dahinter hatte sich sein Onkel, der Großliebentaler Oberschulze Johann Münch, und der Zemstvo-Abgeordnete* Andreas Andreevic Widmer* aus Wittenberg eingereiht. Widmer war ein Freund der Familie aus seiner Zeit als Dorf- und später Volost-Schreiber in Tarutino. Die zwei Männer hatten schon am Morgen mit ihren Beileidsbekundungen Lorenz ihre Aufwartung gemacht, da sie unmittelbar nach dem Begräbnis nach St. Petersburg zu einer Duma-Sitzung fahren mussten.
Besonders von den Warschauern* bekundeten viele ihre Anteilnahme. Es war nicht nur die Sprache, sondern auch das zwar immer mehr verblassende, aber noch verbindende Wissen um die gleiche Abstammung, das die Menschen in diesen schweren Zeiten zusammenrücken ließ.
Leicht war es eigentlich nie, das Leben in der Steppe Bessarabiens. Mit 60 Desjatinen* Land hat Lorenz Münchs Urgroßvater vor fast hundert Jahren hier angefangen. Nur die Grundrisse der ersten zwei, hintereinander gelegenen Räume des Hauses haben das Kronshäuschen überlebt, das der Siedler aus dem Herzogtum Warschau sich damals gebaut hatte. Lorenz’ Vater baute dann das heutige Haus aus gebrannten Ziegelsteinen. Es umschloss je einen Wohn- und Schlafraum, eine Küche, eine Weinkammer und einen großen Stall für die zwei Kühe und zwei Pferde. Lorenz konnte sich noch an den Hausbau erinnern. Das war 1890, als er zehn Jahre alt war.
‚Jetzt bin ich dreißig‘, sinnierte Lorenz, ‚und meine Leontine ist von mir gegangen. Drei Mädchen soll ich großziehen. Wenn der Winter wieder ohne Schnee bleibt und der verrückte Wind auch nächstes Jahr alles zu Staub macht, muss ich verkaufen.‘
Das Herz des Bauern schnürte sich zusammen. Er spürte zum ersten Mal im Leben richtige Angst, Angst um die Zukunft. Sorgen um die Kinder machten sich breit. Er dachte an das vor drei Tagen geborene Mädchen. Die Hebamme hatte ihm das Kreuz auf die Stirn gezeichnet und seine Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen. Das Kind war sehr schwach und der Pastor war nicht vor Ort. Ruhtraud, tauf sie Ruhtraud, hatte Leontine kaum hörbar gehaucht. Es war ihr letzter Wunsch.
„Meine Leontine“, presste Lorenz zwischen den Zähnen hervor. Die Tränen forderten ihr Recht, brachten ihm aber keine Erleichterung. Herzgestein härtete sich in seiner Brust. Warum er? Warum? Er war doch gut, immer gut zu Leontine gewesen. Und sie hatten sich wirklich gern gehabt. Warum musste dieses Kind kommen? Es hat ihm seine Leontine getötet.
Dieses Jahr hatte einfach zu viel Unheil über Lorenz Münch gebracht. Zuerst waren seine Eltern innerhalb von drei Wochen gestorben, der Vater, dann die Mutter. Es folgte die schlechte Ernte. Jetzt hat Leontine ihn verlassen, für immer, und dieses Mädchen ist gekommen. Ein Mädchen, wieder nur ein Mädchen.
„Ja, es ist doch so. Dieses Kind ist ein Unglück“, murmelte Lorenz voller Bitterkeit, für das Mädchen an seiner Seite unverständlich, vor sich hin. „Wie soll ich es durchbringen ohne Mutter? Ich werde es meiner Schwester geben. Die soll es in ihr russisches Rudel aufnehmen. So kann sie wenigstens zeigen, dass sie auch etwas Gutes tun kann, hat sie doch Vater und Mutter eine unerträgliche Schande mit ihrer Heirat – damals, nach dem Krieg mit den Japanern - aufgebürdet. Grigori ist zwar nur ein beigelaufener Kosak, aber er hat für Kinder viel übrig.“
Der Wind war stärker geworden und trieb jetzt dunkle Wolken dem Schwarzen Meer zu. Als Lorenz Münch in die breite, schnurgerade Straße mit den weiß getünchten Häusern und Steinzäunen einbog, fielen vereinzelte Regentropfen auf sein Haupt. Das zehnte der lang gezogenen Bauernhäuser lag wie ausgestorben in der Dämmerung.
2
Tarutinos entfernteste Gewannen Ackerland lagen östlich der Kagil’nik, nicht allzu weit von Berezina entfernt. Die Münchs hatten drei Lose Acker und ein Los Heuschlag in dieser gottverlassenen Gegend. Fast zwei Stunden benötigte Lorenz Münch, um die Feldstücke mit seinem Leiterwagen zu erreichen.
Er hat die Zersplitterung der Kolonistenfelder schon oft verdammt, aber der ertragreiche Boden in der Nähe des Flüsschens hielt schon seinen Vater von einem erwogenen Verkauf ab. Die Kagil‘nik selbst war für die Tarutinoer Bauern auch nur selten ein Hindernis. Im Sommer war sie fast ganz ausgetrocknet und schneereiche Winter gab es nicht oft in der südrussischen Steppe, so dass sie auch während der Schneeschmelze nur bedingt Hochwasser führte.
- - -
Lorenz Münch war auf dem Heimweg. Wie so oft in den letzten acht Jahren nach dem Tod seiner Frau war er auch an diesem Tag allein mit seinen Pferden unterwegs. Er fuhr der Sonne nach. Die war aber schneller und schickte sich schon an, hinter dem Horizont zu verschwinden.
Es war noch sehr warm und über der Steppe lag eine drückende Schwüle. Das sieht ganz nach Regen aus, dachte sich Lorenz und straffte ein wenig die Zügel. Die Rappen fielen in einen leichten Trab und der Wagen zog eine Staubwolke hinter sich her.
Vielleicht hätte ich dieses Feld gleich nach Leontines Tod doch verkaufen sollen. Mit den Losen hinter der Weide am Stadtrand wäre ich auch über die Runden gekommen. Jetzt hört man, das Feld soll enteignet werden, wenn die Bolschewiken kommen. Dann sollen sie sich’s hinten reinstecken.
Lorenz lachte. Es klang gequält, voller Bitterkeit. Er griff hinter den Sitz und zog die Schnapsflasche hervor. Ein Zigarettenstummel flog in weitem Bogen in den Staub. Dann führte er die Flasche hastig an die Lippen und trank wie aus dem Wasserkrug. Der Pflaumenschnaps suchte sich brennend seinen Weg durch die Kehle in den Magen.
Lorenz warf die leere Literflasche über die Schulter in den Wagen und schickte ihr einen deftigen russischen Fluch hinterher. Morgen wird es schon besser gehen. Seine Schwester Gertrude und ihr Mann haben ihm versprochen, beim Mähen zu helfen. Grigori kann die Sense gut führen. Der hat noch Kosakenblut in den Adern. Sie werden auch ihre zwei Buben mitbringen. Das wird schon gehen. Und übermorgen kommen wir mit dem Stirnwärmer raus. Der Wagner hat ja versprochen, die gebrochene Haspel bis dahin zu reparieren.
Auch seine zwei Mädchen werden dabei sein. Das Garbenbinden hat Hulda schon im vergangenen Sommer Spaß gemacht und Ruhtraud wird mit Strohpuppen spielen können. „Schade, dass Emilie nicht da ist“, sprach Lorenz mit sich selbst. Sein Gesicht hatte einen wehmütigen Zug angenommen, der auf das Schwingen ungeahnter Gefühlssaiten im Innern dieser verwitterten und auf den ersten Blick kantig erscheinenden Bauerngestalt hindeutete. „Sie soll ja noch vor dem Ende des Schnitts aus Odessa kommen.“ Das Mädchenheim wird vergrößert, hat seine Schwester ihm am Sonntag aus einem Brief seiner ältesten Tochter vorgelesen. Selber hatte er es nicht so mit dem Lesen und Schreiben. Darum bleibt das Heim bis in den Spätherbst hinein geschlossen, stand in dem Brief. Der Pastor wollte das allerdings nicht so recht glauben. Er meinte, es wäre wegen der schlechten Lebensmittelversorgung in den großen Städten.
‚Hulda, Ruhtraud.‘ In den zurückliegenden Tagen hat Lorenz Münch oft in seiner Einsamkeit an die Kinder denken müssen. Warum das so war, fragte er sich nicht. Sie waren einfach da, die Gedanken an die Mädchen. Ruhtraud war bei Gertrude und Grigori Platonowitsch in fürsorglichen Händen. Trotzdem, eine innere Unruhe hinderte ihn, seine Gedanken in gerade Bahnen zu lenken. Ich habe zu viel Schnaps in mir, dachte er dann, um gleich danach wieder über andere Dinge nachzugrübeln.
Es war Krieg in Europa und am Don tobte der Bürgerkrieg. Die Deutschen waren zwar da und die Ukraine sollte mit ihrem deutschen Generalgouverneur bolschewikenfrei bleiben, aber alles war so ungewiss. Gerüchte beherrschten die Wirtshausdebatten. Es trieb sich so viel fremdes Gesindel wie nie zuvor in der Gegend herum.
‚Hulda ist schon zwölf Jahre alt und tagsüber oft allein zu Hause, seit Emilie in Odessa weilt. Es könnte ihr etwas zustoßen.‘ Solche Gedanken begannen sein Gemüt zu bedrücken. Die Pferde waren längst in ihren alten, langsamen Trott zurückgefallen. Hulda hat es nicht besonders gut bei mir, haderte der in sich zusammengesunkene Bauer mit seinem Schicksal. Es war ihm in diesem Augenblick bewusst, dass er dem Mädchen die Mutter nie ersetzen konnte. Immer wieder hatte er sich vorgenommen, lieb und gut zu sein. Leider hat der Schnaps immer öfter in seinen Eingeweiden gebrannt und seine Gefühle vernichtet. Wie oft war er nur ein unkontrolliertes Bündel Frust? Dann hat Hulda sich stets irgendwo im Haus versteckt. Die Deutschen im Städtchen haben es bald alle gewusst und auch die Russen und Rumänen haben die Köpfe zusammengesteckt, wenn er aus dem Wirtshaus nach Hause getaumelt ist. Es war nicht der Alkohol, der die Frauen von ihm abhielt, sondern die Kinder waren schuld, redete er sich oft ein; und wenn man den breitschultrigen, muskulösen Körper, der einen hochstirnigen Schädel trug, aus dem zwei graublaue Augen manchmal recht gutmütig in die Sonne blinzeln konnten, sah, so war man sogar geneigt, das zu glauben. Aber wenn Lorenz Münch morgens mit nüchternem Verstand hinaus in die unendliche Weite der Steppe fuhr, glaubte er selber nicht an diese Theorie und Selbstzweifel marterten sein ausgeruhtes Gehirn. Dann griff er meist schon mit dem Sonnenaufgang hinter den Wagensitz.
In letzter Zeit hatte ihn wirklich oft eine unbändige Sehnsucht nach der kleinen Ruhtraud gepackt. Das Mädchen, das er nach seiner Geburt so gehasst hatte, ähnelte immer mehr seiner Mutter. Jetzt hätte er es am liebsten bei sich zu Hause gehabt. ‚Vielleicht könnte ich dann mit dieser Sauferei aufhören.‘
Lorenz Münch spürte, dass sich trotz aller Wirrnisse im Kopf so etwas wie ein Ziel vor seine getrübten Augen schob. ‚Ich muss Gertrude drauf ansprechen.‘ In den bereits vergangenen Sommerwochen hatte er sich schon ein paar Male vorgenommen, das zu tun, aber der nötige Mut fehlte ihm dann letztendlich. Gertrude werde ihm bestimmt seine Alkoholexzesse an den Kopf werfen, war seine Befürchtung. ‚Morgen, morgen Abend auf der Heimfahrt nach Tarutino werde ich mit meiner Schwester und meinem Schwager reden. Ich werde morgen keinen Schnaps einpacken.‘ Münchs Gesicht hellte sich plötzlich schelmisch auf. ‚Grigori wird den ganzen Tag Wasser aus dem Tonkrug trinken müssen... Es ist nie zu spät ... Es ist nie zu spät, auch für mich nicht, und vielleicht …‘ Seine Gedanken wandten sich blitzartig der Witwe des verunglückten Peter Hauer zu. ‚Maria ist immer so freundlich zu mir … und ein schönes Weib.‘
- - -
Nur noch ein kleines Kreissegment von der Feuerkugel stand über der Erde, weit, unendlich weit im Westen. ‚Jetzt muss der Kirchturm von Tarutino aber bald auftauchen‘, strebten Lorenz Münchs Gedanken heimwärts, als er meinte, in dem Bruchstück der im Pruth versinkenden Sonnenkugel schwarze Punkte zu sehen. „Verfluchter Schnaps! Morgen ist Schluss!“, rief er mit jubelnder Stimme und rieb sich die Augen. Er wollte zu einem noch ausgelasseneren Erleichterungsschrei ansetzen, als er bemerkte, dass die Punkte sich bewegten. „Reiter, das sind Reiter“, sagte er stattdessen und nahm die Zügel fester in die Hand.
In gestrecktem Galopp näherte sich ihm eine Reiterschar. Etwa zwanzig Mann, schätzte Lorenz, kamen da aus Richtung Tarutino. Zum weiteren Nachsinnen, wer die Männer wohl sein könnten, blieb ihm keine Zeit, denn, noch in eine Staubwolke gehüllt, kreisten diese seinen Wagen ein. Ihre Pferde waren frisch. Das hat der erfahrene Bauer gleich erkannt. Und er merkte auch sofort, dass er keine Militärpatrouille vor sich hatte. Zu wild und verwegen sahen die Gestalten aus. Die meisten trugen Vollbart und waren ziemlich gut bewaffnet. Jeder hatte ein Gewehr und einen Säbel. Einige trugen auch Pistolen in ihren breiten Gürteln.
„Spann deine Rappen aus, Bauer. Du bist auch zu Fuß bald in der Stadt. Lass uns die Pferde“, rief der Hordenführer.
Lorenz verstand ihn, obwohl es nicht das Russisch war, das man in Tarutino sprach.
„Ich brauche meine Pferde“, entgegnete er ebenfalls auf Russisch und griff zur Peitsche. Er sah dem Anführer direkt ins finstere Antlitz. Der viele Schnaps, den er tagsüber getrunken hatte, machte ihn verwegen. Seine Stimme klang rau und entschlossen: „Niemand wird sich an meinen Rappen vergreifen.“
In diesem Augenblick drängte sich ein Reiter auf einem wohlgenährten, sehr gepflegten Schimmel vor. Seine Stimme zitterte merklich, als er sich an den Mann auf dem Wagen wandte.
„Lorenz, gib uns die Pferde.“
„Grigori, was suchst du hier?“
„Das sind Kosaken. Ich reite mit ihnen gegen die Bolschewiken.“
„Hier in der Gegend gibt es keine Kosaken.“ Lorenz hatte auch den letzten Rest Vernunft eingebüßt. „Das sind Banditen“, schrie er mit sich überschlagender Stimme. „Siehst du nicht, wie die aussehen? Du hast Haus und Hof und Gertrude mit den Kindern im Stich gelassen. Die Kosaken sind weit über dem Dnepr, nicht hier.“
„Lorenz“, mahnte Grigori mit verzweifelter Stimme, auf den Anführer zeigend, „das ist ein gefürchteter Ataman. Sei vernünftig und spann aus. Wenn ich zurückkomme, werde ich dir alles erklären.“
Dieser auf Deutsch geführte, sehr erregte Wortwechsel hat den Anführer der Kosaken um die letzte Geduld gebracht. Das Zuhören war anscheinend nicht seine Stärke, und schon gar nicht diesem Geplänkel in einer ihm fremden Sprache.
„Spannt die Pferde aus!“, befahl er.
„Wagt es nicht!“, schrie Lorenz Münch. Er sprang auf und schwang die Peitsche.
Im nächsten Augenblick peitschte ein Schuss durch die sich zu Ruhe begebende Steppe. Lorenz riss die Arme hoch. Er spürte die sengende Hitze in seiner linken Brustseite.
„Nein!“, hörte er noch Grigoris Aufschrei in einem Kugelhagel untergehen.
3
Der Friedhof von Tarutino ist in den Kriegsjahren schnell gewachsen. Er hat sich sein Land von der Steppe genommen. Der Tod, der so viel Steppenerde benötigte, hat in allen Himmelsrichtungen gewütet. Lorenz Münch lag neben seiner Frau Leontine und Grigori Platonowitsch ruhte allein in seinem Grab.
Die zwei Mädchen standen vor dem blumenbedeckten Hügel. Hulda wirkte schon weiblich. Ihre Brüste hoben und senkten sich im schweren Takt ihres bedrückten Gemüts. Tränen glänzten wie kleine Tautropfen auf ihren vom Frühlingswind geröteten Wangen. Es war Sonntag und Hulda hatte ihren dunkelblauen Trägerrock mit dem schwarzen Samtband und eine schneeweiße Bluse angezogen, die weiße Schürze umgebunden und das mit Blumenmotiven bestickte Halstuch über die Schultern gehängt. Ihr langes, weiches Haar war zu einem Dutt gewunden. Sie hatte sich so hergerichtet, wie Mutter sie bestimmt gerne beim Tanz gesehen hätte.
„Weine nicht, Hulda. Tante Gertrude weiß, was für uns besser ist und Herr Widmer hat versichert, dass dieser Dr. Kräuter* ein guter Mann sei ... Und wir bleiben ja nicht für immer fort. Vielleicht geht die Krise in der Tuchfabrik bald vorbei. Dann kommen wir wieder nach Hause.“
„Worte, Ruhtraud, Worte. Du hast Herrn Widmer erzählen gehört und glaubst alles. Der Mann ist ein Abgeordneter. Wir fahren nicht so wie er für ein paar Tage zu einigen Sitzungen ins Parlament nach Bukarest oder weiß ich wohin. Wir fahren ins Banat, um zu arbeiten, und das nicht für einige Tage oder Wochen, sondern für Jahre, vielleicht für immer.“
Ein tiefer Seufzer begleitete diese Worte. Dann ergriff Hulda die Hand ihrer Schwester und drängte zum Aufbruch: „Komm, wir gehen noch zu Onkel Grigori.“
Wortlos durchschritten sie die Gräberreihen. Außer ihnen war niemand auf dem Gottesacker. Windstöße brachten aus Melodien gerissene Blasmusiktöne zu den Toten. Die Stadtjugend war zu ihrem ersten Sonntagnachmittagstanz im Freien zusammengekommen.
Tante Gertrude hatte am Morgen nach dem Gottesdienst auf die zwei Mädchen eingeredet, doch noch vor Mittag auf den Friedhof und dann am Nachmittag zum Tanz zu gehen. Davon aber wollten beide nichts wissen. Die zwei Gräber waren ihnen wichtiger als ein letztes Zusammensein mit befreundeten Altersgenossen.
Über zwei Stunden verweilten Hulda und Ruhtraud in der Stille der Gräber. Auf jedem der zwei Grabstätten brannten zwei Kerzen, als die Schwestern den Friedhof verließen. Am Tor drehten beide sich ohne Absprache noch einmal um und verharrten lange schweigend.
Wortlos gingen sie auch heimwärts, doch nicht den kürzesten Weg, sondern einen weiten Umweg über die Steppe. Ihre Schritte ließen die für ihr Alter übliche Jugendfrische nicht erkennen. In einer bitteren Kindheit waren beide früh gereift. Zu viel Trostlosigkeit hatte sie sehr früh ihrer kindlichen Unbekümmertheit beraubt. So waren diese Mädchen zu stillen, wortkargen Geschöpfen herangewachsen und so gingen sie auch jetzt nebeneinander her, jedes mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen beschäftigt.
- - -
Hulda dachte an jenen Sommertag des Jahres 1918, als ihr Vater abends nicht nach Hause gekommen war. Das war eigentlich nichts Außergewöhnliches gewesen, denn seit er mit dem Trinken begonnen hatte, blieb er oft nachts außer Haus. Sie war es gewöhnt, in Sorgen gebettet einzuschlafen und aufzuschrecken, wenn Windböen auf ihrem Flug zum Meer an den Fensterläden rüttelten. Dann hatte sie sich stets gefürchtet und sich nach ihrer Mutter gesehnt, bis die schweren Augenlider sie für wenige Stunden von der bösen Wirklichkeit befreit hatten.
Am nächsten Morgen lag der Vater dann immer in seinem Bett in der Guten Stube mit dem Bettwäscheschrank, dem Schubladenkasten, auf dem ein Kruzifix stand, und einer Bank. In diesem Raum befand sich nie ein Ofen und ihre Mutter hat nur tot darin gelegen. Bis zu Ruhtrauds Geburt haben alle vier, die Eltern, Emilie und sie, in der Kammer, die zwischen Stube und Küche lag, geschlafen.
Dann war jener Morgen gekommen, an dem ihr Vater nicht, schwer atmend und nach Alkohol und Nikotin riechend, in der Stube lag. Sie war zum Wirt gelaufen und hatte ihn im ganzen Dorf gesucht, beim Wagner und in der Schmiede. Neben der Angst um den Vater hatte ihr auch ihr kindliches Gewissen zugesetzt. Es hätte ihr doch auffallen müssen, dass er nicht vom Feld gekommen war. Sie hätte sich nicht schlafen legen dürfen.
Als sie dann in ihrer Verzweiflung zu Tante Gertrude gelaufen war, hatte sie diese in Tränen aufgelöst vorgefunden. Onkel Grigori hätte sich einer Gruppe Kosaken angeschlossen und sei an den Don geritten, erzählte die Tante, sich mit der Schürze die Augen trocknend. Er wäre mit diesen vom Feld in die Stadt gekommen, hätte mit ihnen über Mittag beim Juden im Wirtshaus gezecht und sei dann mit ihnen weggeritten. Alles Einreden und Flehen ihrerseits hätte nichts genutzt. Jetzt sei ihr Mann im Bürgerkrieg.
Bald danach konnte man von der Straße großen Menschenlärm hören. Sie war mit Tante Gertrude aus dem Haus geeilt. Bauern hatten ihren Vater und ihren Onkel auf einem Wagen nach Hause gebracht. Beide Leichen waren von Kugeln durchsiebt.
Nach dem Begräbnis war auch sie zu Tante Gertrude gezogen und Sergej war gegangen. Er hatte sich den Bolschewiken angeschlossen und ist am Don gefallen.
„Ruhtraud, du darfst im Banat niemand erzählen, dass dein Onkel ein Kosake war und dass dein Vetter auf Seiten der Bolschewiken gekämpft hat. Hörst du?“, beschwor Hulda ihre Schwester.
„Wem soll ich das erzählen? Dort sind doch lauter fremde Menschen.“ Die Zuversicht, die Ruhtraud auf dem Friedhof noch ausgestrahlt hatte, war längst von ihr gewichen. Das Mädchen verspürte jetzt Angst vor der ungewissen Zukunft.
Das bescheidene Häuschen mit dem kleinen Garten war ihr Universum und Tante Gertrude, diese tapfere Frau, war ihr stets eine gute Mutter. Ihre leibliche Mutter kannte sie nur von einem vergilbten Foto. Es zeigte eine Frau mit gutmütigem Gesichtsausdruck an der Seite ihres Vaters, den sie noch gut in Erinnerung hatte. Eine besondere Bindung hat sie zu diesen Menschen aber nie verspürt. Da empfand sie für Onkel Grigori und besonders für Tante Gertrude schon wesentlich mehr Zuneigung. Und gerade Onkel Grigori sollte sie vergessen, hat Hulda von ihr verlangt.
Was soll aus Tante Gertrude werden, wenn sie jetzt mit Vetter Sascha allein bleibt? Sascha ist nicht so gut, wie Onkel Grigori war. Er ist grob und flegelhaft und arbeitet nicht so gerne auf dem Feld. Die ganze Last wird auf Tantes Schultern liegen. Sie, die Mädchen, haben zwar immer geholfen, aber die Ernten blieben trotzdem karg und die Winter warteten immer mit mehr Bescheidenheit als mit Schnee auf.
Emilie hat angeblich den Großteil des Geldes vom Verkauf des Münch-Vermögens in Odessa verbraucht. Seit einem Jahr hat sie nicht mehr geschrieben. Tante Gertrude hat gesagt, sie wäre mit einem Offizier nach Moskau gegangen, „mit einem Roten“, wie sie sich verächtlich ausdrückte.
Oft beklagte die Tante auch das Schicksal ihrer Mannsleute. „Grigori war bei den Weißen, aber Sergej...“, seufzte sie dann, und sie, Ruhtraud, hat mitgelitten und ihre Stängelpuppe ganz fest ans Herz gedrückt.
Das ist alles noch gar nicht so lange her, und jetzt soll sie mit Hulda in die Welt ziehen, irgendwohin, zu fremden Menschen arbeiten, damit sie leben können. Das noch vorhandene Geld soll für die Fahrt ausreichen, hat sie am Vorabend aus einem Gespräch zwischen Tante Gertrude und Hulda erfahren. Die Tante hat zwei Koffer in der Tischlerei anfertigen lassen. In die soll ihre Wäsche und das Essen für vier Tage eingepackt werden. So weit fort von zu Hause und wer weiß wie lange. Die Puppe, die Emilie bei ihrem letzten Besuch aus Odessa ihr mitgebracht hat, werde sie aber auf jeden Fall mitnehmen.
- - -
Die Sonne war schon untergegangen, als die zwei Mädchen in den Hof traten. Ihre Tante knetete Wäsche in einer hölzernen Waschschüssel, und das an einem Sonntagabend. Als sie die beiden hörte, richtete sie sich auf und die Münch-Schwestern sahen in zwei vom Weinen gerötete Augen.
Wortlos gingen alle drei in die Küche. Sascha war beim Tanz. Weder Tante Gertrude noch die Mädchen dachten an ein letztes gemeinsames Abendmahl. Sie saßen lange an dem ungedeckten Tisch, wortlos. Nur eine zusammengefaltete Zeitung der vergangenen Woche lag vor ihnen. Sascha hatte sie beigebracht.
In der langsam, aber unaufhaltsam hereinbrechenden Dunkelheit konnte die fett gedruckte Überschrift und das Datum nur noch als eine schwarze Zeichenkette wahrgenommen werden. Die DEUTSCHE ZEITUNG FÜR BESSARABIEN – TARUTINO vom 25. April 1925 war schon nach wenigen Minuten mit der stillen Dunkelheit verschmolzen.
- - - -
II
Holunderzeit
1
Das Winkelhaus mit den sechs Fenstern und der massiven Tür, zu der drei Stufen führten, hob sich deutlich aus der Reihe der langgezogenen Giebelhäuser ab. Die Schrift über der Tür gab in einfachen Lettern auf einem verwitterten Holzschild Auskunft: APOTHEKE JOSEPH TALLER.
Das Fenster links der Tür ließ das Tageslicht in den Verkaufsraum fallen, während durch das Fenster rechts des Apothekeneingangs der Lagerraum für die unzähligen Medikamentenpackungen, aber auch für den großen Tisch, auf dem mit Reagenzgläschen bestückte Holzständer und Mörser verschiedener Größen standen, tagsüber erhellt wurde. Die anderen zwei Fenster an der rechten Gassenfront gehörten zu einem geräumigen Wohnzimmer, das noch ein drittes Fenster zur Hofeinfahrt hatte. Die zwei verbliebenen Fenster an der linken Hausseite waren meist mit schweren Gardinen verdunkelt, weil Frau Apothekerin sich mit ihrem zermürbenden Migräneleiden oft auch tagsüber in ihr Schlafzimmer zurückzog.
In rechtem Winkel zu dieser Raumanordnung schlossen sich hinter dem Schlafgemach noch ein kleines Zimmer für die Apothekerstochter, die Küche, ein Dienstmädchenzimmer und eine tiefer gelegte Weinkammer an. Alle diese Räumlichkeiten waren dank einer Veranda gegen Wetterunbilden geschützt. In den breiten Glasgang gelangte man über je eine Treppe in der Hofeinfahrt und von der Tenne her sowie durch zwei weitere Türen, die sich nahtlos in die Verandaverglasung einreihten und vis-a-vis der Trennwände zwischen Lagerraum und Wohnzimmer und zwischen Küche und Dienstmädchenzimmer lagen.
Das stattliche Haus war kurz vor dem Krieg von Baron Béla Sándor errichtet worden. Als der Gutsbesitzer aber 1921 seine Ländereien verlor, hat er dieses und zwei weitere Häuser im Dorf verkauft und ist in Richtung Budapest abgereist. Seither waren sieben Jahre ins Land gegangen und man hatte die ungarische Vorherrschaft auf den Gemarkungen der mehrheitlich deutsch bevölkerten Dörfer des Banats längst dem allmählichen Vergessen anheimgegeben.
Der neue Eigentümer des Anwesens, besagter Apotheker Taller, war, obwohl von den bäuerlichen Dorfbewohnern als guter Salbenmischer geachtet, eher eine zwielichtige Gestalt. Das hing wesentlich damit zusammen, dass die Vergangenheit der Familie verschleiert blieb, akzeptierte das Dorf in der Banater Hecke doch nur äußerst schwer offene Geheimnisse, geschweige denn gut getarnte Familienverhältnisse. Wo jeder jeden kannte, unterlagen Familien- und Besitzangelegenheiten von jeher einer großzügigen Entblößung.





























