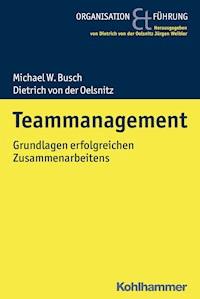
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
What are the foundations for successful collaboration? What is the best way for teams to successfully achieve a common goal, and what are the unplanned dynamics that may emerge in the process? This book aims to provide a comprehensive overview of these issues, presenting the essential information about various types of team, management challenges and tools that can be used to shape the process. It deals both with success factors and with central processes such as team leadership, problem-solving and coordination. Special emphasis is given to ways of promoting collective learning and creativity within teams in the face of the dynamic momentum of today's business world.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Organisation und Führung
Herausgegeben von
Dietrich von der Oelsnitz
Jürgen Weibler
Michael W. Busch, Dietrich von der Oelsnitz
Teammanagement
Grundlagen erfolgreichen Zusammenarbeitens
Verlag W. Kohlhammer
Für den kleinen Arthur von seinem Papa Michael
1. Auflage 2018
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-031556-3
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-031557-0
epub: ISBN 978-3-17-031558-7
mobi: ISBN 978-3-17-031559-4
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Geleitwort der Herausgeber
Der vorliegende Band beschließt die 2003 begonnene Management-Lehrbuchreihe, die sich in ihren Einzelbänden mit ausgewählten Fragen der Organisation und Führung befasst. Die Verbindung von wissenschaftlicher Problembehandlung und praktischer Anschaulichkeit soll ihre Ausführung leiten. Darüber hinaus sind unterschiedliche Zugänge ausdrücklich erwünscht – hierdurch wird ein inhaltlich wie methodisch vielfältiges Spektrum für die Behandlung von Organisations- und Führungsfragen ermöglicht. Denn schließlich tragen auch die Probleme, denen wir im Rahmen des Nachdenkens über und des Handelns in Organisation begegnen, keine disziplinären Etiketten. Die jeweiligen Einzelbände wenden sich dabei zunächst an Dozenten und Studierende in der grundständigen wie weiterbildenden Lehre. Praktiker können von den anwendungsorientierten Ausführungen jedoch ebenfalls profitieren.
Michael W. Busch und Dietrich von der Oelsnitz ist mit dem vorliegenden Werk »Teammanagement« etwas gelungen, was Forschende, Top-Manager, Organisationsgestalter und Organisationsberaterinnen, aber auch Teamführungen wie Teammitglieder selbst, herbeigesehnt haben: Endlich eine systematisierte und einordnende Zusammenschau des Wissens zu und um Teams. »Grundlagen«, »Erfolgsfaktoren« und »Entwicklungen« der Teamarbeit sind die schlichten Bezeichnungen für eine nicht enden wollende Erkundung der Höhen und Tiefen der wissenschaftlichen Teamforschung. Dies geht einher mit einer Fülle von Praxisbeispielen und Erfahrungen heraustretender Akteure. Am Ende der Reise steht dann das, beispielhaft komprimiert im Fazit, was, warum und mit welchen Konsequenzen gegenwärtig zur Teamarbeit in Erfahrung zu bringen ist. Drei Punkte sind mir noch zur fachlichen Kennzeichnung des Werkes persönlich wichtig:
1. Es ist absolut ehrlich, da es nicht vorgibt, beständig einfache Lösungen auf grundlegende wie drängende Fragen zu präsentieren, sondern stattdessen klar aufzeigt, wo wir stehen und wo die Grenzen unseres Wissens, auch gestalterisch, liegen. Damit kann man nun theoretisch wie praktisch arbeiten.
2. Es ist bei aller Vielfalt fokussiert, da es mit dem ganzheitlich-dynamischen Teammodell einen sehr konkreten Bezugsrahmen der Teamarbeit aufzeigt. Deutlich wird im weiteren Verlauf, wie jedes Team hierdurch eine einzigartige Färbung erhält, die dann über u. a. aufsetzende Macht-, Einfluss- und Regelstrukturen zu einem charakteristischen Reifezustand des Teams mit entsprechenden Folgen führt.
3. Es ist als letztes dieser langjährigen Reihe insofern beispielhaft, als es ihr erklärtes Ziel, eine Mischung aus »wissenschaftlicher Problembehandlung und praktischer Anschaulichkeit« zu sein, konsequent einlöst. Indem es unter Hinzunahme einer unglaublichen Fülle einschlägiger Literatur, Klassiker wie jüngster Veröffentlichungen, das Problemfeld »Team« durchleuchtet und befundet, glückt nachfolgend ein konzeptioneller Zugriff auf die Teamarbeit, dem Referenzstatus zukommt. Im Gedächtnis wird diese Referenz auch durch die anschaulichen Erfahrungs- und Fallbeispiele bleiben, die, verschiedensten Praxisbereichen entstammend, nicht nur für die Ausformulierung des eigenen Zugriffs verdienstvoll waren, sondern uns allen die Reichhaltigkeit und Relevanz des Themas – aufgelockert durch eingestreute Zitate wie kleinere Weisheitsgeschichten – näherbrachten.
Ich wünsche dem Werk eine positive Aufnahme und weite Verbreitung.
Hagen, im Februar 2018
Jürgen Weibler
FernUniversität in Hagen
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Personalführung und Organisation
Vorwort
Die Literatur zum Teammanagement gleicht einem Dschungel. Zwar gibt es zahlreiche praxisorientierte Darstellungen über Teamarbeit, doch fehlt vielen dieser Bücher eine Gesamtkonzeption sowie auch ein theoretisches Fundament. Einzelaspekte der Teamarbeit werden hier isoliert voneinander dargestellt, ohne dass erkennbar wird, wie all diese Aspekte miteinander in Verbindung stehen. Auf der anderen Seite existieren pointiertere wissenschaftliche Darstellungen (z. B. Becker 2016; Edding/Schattenhofer 2015a; van Dick/West 2013), brauchbare Sammelbände zur Teamarbeit (z. B. Jöns 2016; Edding/Schattenhofer 2015b; Högl/Gemünden 2005; Stumpf/Thomas 2003) und Bücher mit einem speziellen Fokus (z. B. zum Teamcoaching). Zudem gibt es in wissenschaftlichen Zeitschriften unterschiedlichster Provenienz eine nicht mehr zu überschauende Zahl an erkenntnisreichen Artikeln über Teamarbeit, die in der Praxis jedoch kaum mehr wahrgenommen werden. Als Leser kann einem hier leicht der Überblick verlorengehen.
In den meisten Publikationen steht der Leistungsgedanke, die Teamperformance, im Vordergrund. Der Lerngedanke hingegen bleibt unterbelichtet (eine Ausnahme: Bornewasser/Schlick/Bouncken 2015). Unser Buch setzt seinen Schwerpunkt auf genau diese Lernperspektive und soll damit eine Lücke auf dem deutschen Buchmarkt schließen. Es ist Ergebnis zahlreicher Überlegungen, Begegnungen und Erfahrungen. Es soll keine »dünne Suppe« sein, aber auch kein allzu schwer verdaulicher Wälzer. Wir würden uns freuen, wenn wir Wissenschaftlichkeit und Praxisorientierung noch besser miteinander in Einklang bringen könnten. Dazu haben wir u. a. sogenannte Infoboxen eingeschaltet, die man als eiliger Nutzer nicht lesen muss, aber gerne lesen darf. Sie dienen der Vertiefung oder Veranschaulichung eines besonders wichtigen Aspekts.
Nachfolgend wollen wir Teams die theoretische Untermauerung geben, die ihnen aufgrund ihres hohen praktischen Stellenwerts gebührt. Dies geschieht über drei zentrale Konzepte:
• Teaming: Wie gelingt es einem Unternehmen, sich in Teamstrukturen immer wieder neu zu formieren und zu »erfinden«?
• Dynamische Fähigkeiten: Wie gelingt es Teams, die Brücke zwischen der Umwelt und den vorgefundenen organisationalen Rahmenbedingungen zu schlagen?
• Ambidextrie: Wie lässt sich Lernen in kleinen Schritten und Lernen in großen Sprüngen, Effizienz- und Innovationsorientierung mit Hilfe von Teams unter einen Hut bringen?
Als konzeptioneller Bezugsrahmen dient uns ein ganzheitlich-dynamisches Teammodell, das das klassische Input-Prozesse-Output-Modell der Teamforschung aufgreift, zugleich aber auch deutlich erweitert.
Auch auf die Grenzen des zielgerichteten Managements von Teams wird dezidiert eingegangen. Diese liegen in der Dynamik eines jeden Teams, die zu freudigen, aber auch zu bösen Überraschungen führen kann. Als Schlüsselkonzept dienen die beiden Begriffe »Gestalt« und »Emergenz«. Das Ganze ist stets etwas anderes als die Summe seiner Teile. Dieses Axiom der Gestalttheorie bildet einen wichtigen argumentativen Ausgangspunkt unserer Analyse. Emergente Teamphänomene repräsentieren hierbei das Andere, das im guten Fall ein Mehr, im schlechten Fall ein Weniger im Lern- und Leistungsvermögen einer Gruppe bewirkt. In ihrer Handhabung zeigt sich echte Führungskunst.
Unser Thema ist mehr als »in« – der Stellenwert effektiver Teamstrukturen ist von der Praxis längst erkannt worden. Das strahlt auch auf den härter werdenden Kampf um Fachkräfte aus. In der Wirtschaftspresse mehren sich Berichte darüber, dass sog. Headhunter sich nicht mehr damit zufriedengeben, einem Arbeitgeber einzelne Spitzenkräfte abzujagen, sondern gleich ganze Teams abwerben (vgl. Tödtmann 2017). Dies geschieht vor allem in der Kreativ- und Finanzbranche, denn Geldanlage und der Außenauftritt sind Vertrauenssache. Hier sind Teamwechsel mittlerweile die Regel. Die Lunis Vermögensmanagement in Frankfurt etwa warb der Schweizer Privatbank J. Safra Sarasin im April ein komplettes Expertenteam ab, inklusive des Generalbevollmächtigten. Dabei liegt der große Vorteil eines Teamwechsels auf der Hand: es findet eine kostenlose Qualitätskontrolle statt. Denn ein Chef nimmt zu seinem neuen Arbeitgeber nur die besten Leute mit, die er einerseits fachlich wertschätzt und mit denen er auch menschlich »kann«. Und umgekehrt: Exzellente Mitarbeiter folgen nur exzellenten Vorgesetzten. Der neue Arbeitgeber kann sich also freuen: Er bekommt eine eingespielte Mannschaft, die sofort Leistung bringen kann.
Wir hoffen dementsprechend, dass sich von unserem Buch sowohl Wissenschaftler als auch Praktiker angesprochen fühlen. Daneben kommen Masterstudenten als mögliche Nutznießer in Frage. Dadurch, dass sich die Forschung heutzutage immer mehr inter- und intradiziplinär zersplittert und in kleinteiligen Fragestellungen verliert bzw. Veröffentlichungen fast nur noch in englischer Sprache erfolgen, erscheint es uns dringend geboten, die Brücke zwischen Theorie und Praxis aufrecht zu erhalten. Verwiesen sei hier auf den zeitlosen Gedanken Immanuel Kants: »Theorie ohne Praxis ist leer; Praxis ohne Theorie ist blind«.
Wien und Braunschweig, im Winter 2017
Michael W. Busch
Dietrich von der Oelsnitz
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort der Herausgeber
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Kapitel 1
Grundlagen der Teamarbeit
1.1 Teambegriff und Teammerkmale
1.2 Spezielle Teamarten
1.2.1 Arbeitsteams
1.2.2 Kontroll- und Untersuchungsteams
1.2.3 Hochleistungsteams
1.2.4 Verhandlungsteams
1.2.5 Entscheidungsteams
1.2.6 Innovationsteams
1.3 Teaming als Motor einer lernenden Organisation
1.3.1 Teaming in innovativen Organisationskonzepten
1.3.2 Dynamische Fähigkeiten: Innen- und Außenorientierung verbinden
1.3.3 Ambidextrie: Exploration und Exploitation gleichzeitig
1.3.4 Grundformen der Kompetenz- und Lernsteuerung in Teams
1.4 Ganzheitlich-dynamisches Erklärungsmodell der Teamarbeit
Kapitel 2
Erfolgsfaktoren der Teamarbeit
2.1 Teamführung
2.1.1 Inhaltliche Grundsätze und Verankerungsoptionen
2.1.2 Teamgröße
2.1.3 Teamzusammensetzung
2.2 Basisprozesse in Teams
2.2.1 Reflektieren
2.2.2 Kommunizieren
2.2.3 Koordinieren
2.2.4 Feedback geben
2.2.5 Probleme lösen
2.2.6 Konflikte bewältigen
2.2.7 Sich gegenseitig unterstützen
2.2.8 Entscheiden
2.2.9 Die Kontakte zur Außenwelt steuern (team boundary spanning)
2.3 Teamlernen
2.3.1 Definition und Grundelemente
2.3.2 Cross Training: Gegenseitiges Wissen aufbauen
2.3.3 After Action Review: Wissen aktualisieren
2.3.4 Action Learning: Kreativ sein und aus Fehlern lernen
Kapitel 3
Geplante und ungeplante Entwicklungen der Teamarbeit
3.1 Erkenntnisphilosophische Vorbemerkung
3.2 Teamkognitionen – Dynamische Denkmuster
3.2.1 Teamwissen
3.2.2 Situationswissen
3.3 Teamemotionen – Dynamische Gefühlsmuster
3.3.1 Teamstimmungen
3.3.2 Teamgeist
3.4 Teamhierarchien – Dynamische Einflussmuster
3.4.1 Sympathiebasierte Beziehungsstruktur
3.4.2 Machtbasierte Rangstruktur
3.5 Teamreifung – Dynamische Entwicklungsmuster
3.5.1 Das Modell von Tuckman
3.5.2 Das Modell von Gersick
3.5.3 Das Modell von Rickards und Moger
Kapitel 4
Resümee
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1:
Ausgewählte Zitate zur Teamarbeit
Abb. 2:
Ausgewählte Teamdefinitionen
Abb. 3:
Interdependenzmuster in Teams
Abb. 4:
Teamarten und Lernmodus
Abb. 5:
Unterschiedliche Teamarten und Beispiele
Abb. 6:
Innovationsarten
Abb. 7:
Die beiden grundlegenden Lernmuster
Abb. 8:
Exploitations- und explorationsähnliche Verhaltensmuster
Abb. 9:
Varianten des Multiskilling
Abb. 10:
Bestandteile transaktiven Wissens
Abb. 11:
Das Input-Prozesse-Output-Modell der Teamarbeit
Abb. 12:
Überblick über die wichtigsten Input-, Prozess- und Outputgrößen
Abb. 13:
Ganzheitlich-dynamisches Teammodell
Abb. 14:
Schlüsselprozesse der Teamführung
Abb. 15:
Transaktionale vs. transformationale Führung
Abb. 16:
Ambidextere Führungsmuster
Abb. 17:
Führungsformen in Teams
Abb. 18:
Anzahl der Kommunikationspartner und Kommunikationsmöglichkeiten
Abb. 19:
Governancestruktur in der Großprojektsteuerung
Abb. 20:
Auswahlkriterien bei der Teamzusammenstellung
Abb. 21:
Verhaltensmuster bei Leistungsunterschieden
Abb. 22:
Die fünf großen Persönlichkeitsdimensionen (»Big Five«)
Abb. 23:
Emotionale Intelligenz bei Führungskräften
Abb. 24:
Die drei wichtigsten Rollendimensionen in der Teamarbeit
Abb. 25:
Aufgaben- und Beziehungsprozesse nach McGrath
Abb. 26:
Die drei Hauptaktivitäten von Teams
Abb. 27:
Die wichtigsten Teamprozesse
Abb. 28:
Gestaltungsfelder der Teamreflexivität
Abb. 29:
Die drei klassischen Interdependenzformen nach Thompson
Abb. 30:
Zusammenhang zwischen Konflikttypen und Teamerfolg
Abb. 31:
Serviceorientierung in Teams
Abb. 32:
Die vier grundlegenden Umweltstrategien eines Teams
Abb. 33:
Die drei Stufen von Cross Training
Abb. 34:
Qualifizierungsmatrix
Abb. 35:
Ablauf eines After Action Review
Abb. 36:
Der After Action Review als Lernzyklus
Abb. 37:
Der Weg zum Erfolg
Abb. 38:
Dynamische Denkmuster in Teams
Abb. 39:
Dynamische Gefühlsmuster in Teams
Abb. 40:
Das Stimmungsrad
Abb. 41:
Vereinfachte Darstellung eines Soziogramms
Abb. 42:
Das rangdynamische Modell nach Schindler
Abb. 43:
Das erweiterte Modell von Tuckman
Abb. 44:
Das Teamentwicklungsmodell von Gersick
Abb. 45:
Das Modell von Rickards und Moger
Kapitel 1
Teamwork makes the dream work.
Grundlagen der Teamarbeit
In der Saison 2015/16 setzte Leicester City nicht nur die englische Premier League, sondern auch die gesamte Fußballwelt in Erstaunen. Erstmals in der Vereinsgeschichte gelang es dem kleinen Club mit großer Fangemeinschaft, die englische Meisterschaft zu holen, obwohl er Finanzgiganten wie Manchester United oder Chelsea weit unterlegen war. In der deutschen Bundesliga würde sich manch ein Fußballfan solche »Underdogerfolge« wünschen. Auch bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich überraschten Außenseiter wie die kämpferischen Waliser oder die coolen Isländer die Zuschauer mit ihrer Kollektivleistung, während hoch gehandelte Teams wie die englische, belgische oder österreichische Fußballmannschaft deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben und teilweise bereits in der Vorrunde ausschieden. In all diesen Beispielen scheint der Teamgeist die Einzelklasse von Starspielern kompensiert zu haben.
Auf einer ganz anderen Ebene – nämlich der zwischenstaatlichen – stellt sich gegenwärtig ebenfalls die Teamfrage. Die Schulden- und Flüchtlingskrise konfrontieren die EU mit existenziellen Fragen der Kooperation oder Nichtkooperation: Stehen hier noch alle füreinander ein? Steht das Wir über dem Ich? Halten sich noch alle an das gemeinsam verabredete Regelwerk? Herrscht eine gerechte Lastenverteilung? Und existiert noch eine zugkräftige Zukunftsvision, die die Staaten eint – oder war die EU nur der Traum einer politisch-ökonomischen Schönwetterperiode?
Leicht zu erkennen ist also, wie sehr Teams oder Fragen der Kollektivarbeit unseren heutigen Alltag in nahezu allen Bereichen prägen. Ob im Sport, in studentischen Lerngruppen, in politischen Verhandlungssituationen oder bei der Entwicklung neuer Produkte, ob bei der Krisenbewältigung oder der Durchführung chirurgischer Eingriffe – überall treten Gruppen in Erscheinung, überall sind es zwischenmenschlich koordinierte Handlungen, in denen individuelle Stärken arbeitsteilig genutzt und auf ein gemeinsames Ziel hin ausgerichtet werden. Insofern erstaunt es nicht, dass die Fähigkeit des Teaming auch für Unternehmen zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor wird (vgl. Edmondson 2012, S. 2 f.). Anders als noch zu Taylors und Fords Zeiten, als der einzelne Mitarbeiter eng definierte Aufgabenfelder unter strikter Fremdkontrolle zu verrichten hatte, geht es heute darum, das »Gold« aus den Köpfen der Mitarbeiter zu schürfen, ihre Ideen zu stimulieren und durch Zusammenführung zu nutzen, um so letztlich von der vielzitierten »Weisheit der Vielen« profitieren zu können. Gute Teams nutzen die persönlichen Stärken ihrer Mitglieder und kompensieren zugleich ihre Schwächen. Genau hierum soll es nachfolgend gehen: Um die Grundlagen erfolgreichen Zusammenarbeitens und um effektives Teamwork.
Ein Schwerpunkt wird auf die Frage gelegt, wie sich durch diese Prozesse das gemeinsame Lernen in Gruppen anregen lässt, um innovative Problemlösungen zu ermöglichen und sich zugleich immer schneller und geschmeidiger wechselnden Kundenwünschen oder neuen Technologien anzupassen. Das Lernen bewegt sich dabei auf einem Kontinuum zwischen Exploitation (= Lernen in kleinen Schritten) und Exploration (= Lernen in großen Sprüngen), mit denen wiederum zwei grundlegende Formen der Kompetenzsteuerung in Teams korrespondieren. Auf der einen Seite stehen Teams, die Outputs gleichbleibender Qualität und Menge erzielen sollen (z. B. in der Automobilmontage). Auf der anderen Seite befinden sich Teams, die neue Produkte oder Dienstleistungen erstellen sollen. Da es sich bei solchen innovationsorientierten Arbeitsformationen zumeist um fachlich heterogen zusammengesetzte Teams handelt, geht es hier primär um die kreative Vernetzung der Mitglieder.
Im konzeptionellen Zentrum steht das in Kapitel 1.4 vorgestellte Teammodell, das es erlaubt, Teamerfolgsfaktoren, Teamprozesse und teamdynamische Erscheinungen einzuordnen und ganzheitlich zu erfassen. Speziell die teamdynamischen Eigenheiten sind es, mit Hilfe derer man dem Geheimnis besonders erfolgreicher Teams auf die Spur kommt; denn erst sie machen aus einer Gruppe ein Team und aus einem Team ein Hochleistungsteam. Zugleich dienen sie aber auch als wirksame Erklärung kollektiver Fehlentscheidungen und Leistungsverschlechterungen bei scheiternden Teams. Sie sind letzten Endes der Schlüssel, um sowohl Erfolgs- als auch Misserfolgsspiralen in Gruppen besser zu verstehen.
1.1 Teambegriff und Teammerkmale
Nicht in jeder Verpackung, auf der heutzutage Team steht, steckt tatsächlich auch ein Team drin. Da beinahe jeder schon eigene Erfahrungen mit dieser Arbeitsformation gesammelt hat, glaubt auch jeder, darüber eine Meinung äußern zu können. Oft fallen die Urteile gemischt bis negativ aus. Nicht selten wird Team als Abkürzung für »Toll, ein Anderer macht’s!« verstanden (vgl. von der Oelsnitz/Busch 2014). Daneben kursieren viele andere schöne Zitate über das Zusammenwirken von Menschen in Teams, die mal launig, mal vernichtend ausfallen, doch stets ein Körnchen Wahrheit in sich tragen. Abbildung 1 gibt einen Überblick über einige häufig verwendete, eher skeptische Zitate zur Teamarbeit.
Die Zitate lassen bereits erkennen, dass sich Teamarbeit immer in einem Spannungsverhältnis zwischen Ich und Wir bewegt. Einerseits darf die individuelle Persönlichkeit (inklusive ihrer Stärken) im Team nicht untergehen, andererseits dürfen die Egos der Teammitglieder auch nicht zu groß sein, weil sonst die Fliehkräfte überhandnehmen und der Zusammenhalt verlorengeht. Jeder muss sich ein wenig biegen lassen, darf aber nicht brechen, so dass seine Eigenart und sein freier Wille zum Erlöschen kommen. Ähnlich wie in einer Zweierbeziehung fordert Teamarbeit von allen Beteiligten also immer ein gewisses Maß an Kompromissbereitschaft und Konformität.
Abb. 1: Ausgewählte Zitate zur Teamarbeit
Dieser Grundgedanke taucht bereits in der Etymologie des Wortes Team auf, das aus dem Altenglischen stammt und mit den deutschen Wörtern ziehen und Zaum verwandt ist. Eine seiner ursprünglichen Bedeutungen war »Nutzvieh unter einem Joch«, »Gespann«, »Reihe zusammengespannter Tiere«, oder auch allgemein »das, was zieht«. Auch Teams von Menschen sollten an einem Strang ziehen, gemeinsam eine Aufgabe bewältigen, weshalb das Motto der drei Musketiere »Einer für alle und alle für einen!« nicht ohne Grund oft zum Leitspruch für Teamarbeit schlechthin erhoben wird.
Die Bergsteigerlegende Reinhold Messner veranschaulicht diesen Gedanken am Beispiel einer Seilschaft. »Die Verantwortung wird nie allein von einem Kletterer getragen; sie wird am Berg immer mit allen anderen Mitgliedern einer Gruppe geteilt. Wobei die körperlich und geistig Fähigeren (…) mehr davon übernehmen. Instinktiv werden Sorgen, Verantwortung, Lasten so aufgeteilt, dass jedes Glied einer Seilschaft seinen gerechten Anteil übernimmt. Alle sind also gleichberechtigt, je nach ihrem Können selbstverpflichtet« (Messner 2014, S. 56). Dieser Aspekt des Mit- und Füreinanders – nicht des Neben- oder gar Gegeneinanders – spiegelt sich auch in gängigen Definitionen von Teams wider ( Abb. 2).
Aus diesen Definitionen lassen sich grundlegende Merkmale eines Teams ableiten, die prinzipiell auf sämtliche Arten von Teams anwendbar sind:
• Mindestens drei Personen,
• gemeinsames Ziel,
• Aufgabeninterdependenz und daraus resultierender Abstimmungsbedarf,
• Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Teammitgliedern,
• Arbeitsteilung, d. h. eine klare Rollen- und Verantwortungsstruktur,
• formell ernannte Teamführung,
• Handlungsautonomie, d. h. weitgehende Selbststeuerung von Aktivitäten,
• Vorhandensein einer Teamgrenze und Regelungen der Teamzugehörigkeit.
Abb. 2: Ausgewählte Teamdefinitionen
Mindestens drei Personen
Erst ein Team, das aus mindestens drei Personen besteht, wird hier als Team bezeichnet. Ab 20 Personen spricht man von einer Großgruppe. Sobald drei Personen vorhanden sind, kann sich ein Teammitglied einem anderen zuwenden und mit diesem eine Koalition bilden, wodurch bei Uneinigkeit auf der einen Seite eine Mehrheit und auf der anderen Seite eine Minderheit entsteht (vgl. Hertel/Hüffmeier 2014, S. 222). Gruppendynamische Erscheinungen wie Konformitätsdruck, Positionskämpfe oder Leistungsvergleiche können erst ab drei Personen in stärkerem Maße auftreten. Überdies ist es ab dieser Gruppengröße möglich, unterschiedliche Perspektiven zu diskutieren und differenzierte Abwägungen zu treffen. Dieser Umstand spielte bereits im römischen Recht eine Rolle, wonach ab einer Dreier-Konstellation von einem Kollegium gesprochen wurde (»tres faciunt collegium«, Marcellus, Corpus Iuris Civilis).
Gemeinsames Ziel
Ein Team hat ein wie auch immer gelagertes Problem zu lösen, das – zumindest im unternehmerischen Kontext – aus Sicht eines Auftraggebers wie der Geschäftsführung oder eines Großkunden relevant erscheint. Diese Aufgabe bedarf i. d. R. der Bündelung unterschiedlicher Stärken und Fähigkeiten. Hierbei ähneln Teams im Kleinen einer ebenfalls arbeitsteilig funktionierenden Organisation, in der im größeren Rahmen persönliche Kompetenzen genutzt und vernetzt werden, um komplexe Herausforderungen zu meistern. Die Ziele, die durch Teams erreicht werden sollen, können eher ökonomischer oder eher sozial-humanitärer Natur sein oder auch beide Aspekte sinnvoll miteinander verbinden. Beispiele für ökonomische Ziele sind Qualitätssteigerung, Produktivitätsverbesserungen, Senkung von Fehlzeiten oder die Förderung des innerbetrieblichen Wissens- und Erfahrungstransfers. Beispiele für humanitäre Ziele sind die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und Motivation von Mitarbeitern, deren gesunde Persönlichkeitsentwicklung oder die allgemeine Verbesserung des Betriebsklimas (vgl. Wegge 2004, S. 18).
Nach Buchinger (2004, S. 231 ff.) kann Teamarbeit in Unternehmen als Instrument der Entscheidungsfindung, der strategischen Planung, der Verankerung von Zielen und Visionen, der Steuerung von Organisationen und ihres laufenden Umbaus, der internen überfachlichen Vernetzung, der Bewältigung notwendiger organisatorischer Konflikte, der gesteigerten Identifikation mit der Organisation, der Handhabung affektiver Prozesse oder schließlich als Instrument der organisatorischen Selbstreflexion dienen. Durch die Festlegung von Zielen lassen sich Anforderungen an die zu erbringenden Leistungen des Teams durch klare Vorgaben definieren – und anschließend auch beurteilen (vgl. Kriz/Nöbauer 2008, S. 45 f.; Stock-Homburg 2013, S. 599).
Aufgabeninterdependenz und Abstimmungsbedarf
Dem gemeinsamen Ziel vorgelagert ist die Frage der Aufgabenbeschaffenheit: Wie stark greifen Aufgaben ineinander? In welchem Ausmaß ist die Kombination individueller Inputs erforderlich, um ein kollektives Output zu erlangen? Am Anfang der Bildung von Teams steht immer die Frage nach der »Teamhaftigkeit« der Aufgabe. Wann macht es Sinn, Einzelaufgaben zu Teamaufgaben zusammenzuführen? Allein der Umstand, dass Teams in Mode sind, sollte eine Organisation aber nicht dazu verleiten, einem übertriebenen Teamwahn zu verfallen, der versucht, alles und jedes in diese Arbeitsformation zu pressen (vgl. Kieser 1996).
Zu prüfen ist also genau, was eine Team- und was eine Einzelaufgabe ist und wo Schnittstellen zwischen beiden bestehen. In seinem inzwischen zum Klassiker avancierten Werk »Group process and productivity« aus dem Jahr 1972 (S. 15 ff.) entwickelte der amerikanische Sozialpsychologe Ivan D. Steiner (1917-2001) eine bis heute gültige Unterteilung von Gruppenaufgaben (vgl. auch Hammar Chiriac 2008, S. 507 f.):
• Bei additiven Gruppenaufgaben ergibt sich die Gruppenleistung als Summe der Einzelleistungen der Mitglieder. Auch in der Softwareprogrammierung findet sich häufig die Vorgehensweise, dass einzelne Programmierer klar abgegrenzte Module programmieren, die erst zum Schluss in eine Gesamtlösung integriert werden. Im Grunde handelt es sich um Einzelarbeit, die durch ein gemeinsames Ziel verbunden ist.
• Bei kompensatorischen Gruppenaufgaben soll eine Anzahl von Menschen unabhängig voneinander die Entwicklung eines bestimmten Phänomens richtig ab- bzw. einschätzen (z. B. Börsenkursentwicklung oder Trendformulierung in einer Delphi-Expertenbefragung), wobei dann aus dem Gesamtergebnis das arithmetische Mittel, der Median oder ein sich abzeichnender Trend gebildet wird.
• Konjunktive Gruppenaufgaben verlangen im Gegensatz zu den zuvor genannten Aufgabentypen eine Interaktion der Beteiligten. Hierbei müssen alle Mitglieder erfolgreich sein, damit die Gruppe als Ganzes erfolgreich ist, wobei die Gruppenleistung am Ende durch das schwächste Glied in der Kette bestimmt wird. Eine Seilschaft im Gebirge bildet ein klassisches Beispiel hierfür. Von Reinhold Messner weiß man etwa, dass er bei der Zusammenstellung seines Teams strikt darauf achtete, Partner mit ähnlichem Leistungsniveau und Drive zu finden, um von vornherein Konflikte und Streitereien während einer Bergtour auszuschließen (vgl. Messner 2014, S. 302 ff.).
• Bei disjunktiven Gruppenaufgaben hängt die Gruppenleistung vom stärksten Gruppenmitglied ab. Die Lösung kann durch Experten oder hochbegabte Fachkräfte gefunden werden, die dann sehen, was alle sehen, dabei aber etwas denken, was noch niemand gedacht hat. Teilweise findet sich dies auch im Mannschaftssport, in dem sich Teams um einen Starspieler herum formieren. Alex Ferguson, der langjährige Erfolgstrainer von Manchester United, betont jedenfalls die Bedeutung herausragender Spieler: »Elf gute Spieler, die gut miteinander harmonieren, können eine Mannschaft bilden, die mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Und dennoch: Mir fällt kein Team ein, das auf dem allerhöchsten Niveau ohne einen Weltklassespieler in seinen Reihen Großartiges erreichte« (Ferguson 2016, S. 117). Es seien solche Spieler, die Partien entscheiden und einen Verein pushen könnten.
• Bei komplementären Gruppenaufgaben schließlich hängt die Leistung von der optimalen Nutzung der inviduellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensbestände ab. Ein Orchester etwa benötigt exzellente Einzelmusiker, aber erst im gelungenen Zusammenspiel aller wird es zu einem unverwechselbaren Klangkörper (vgl. Scholz/Schmitt 2011; de Hoop 2012).
Allerdings bilden sehr stark ausgeprägte Interdependenzbedingungen im Alltag eher die Ausnahme. Es gibt folglich nur wenige Teams, die sich ständig abstimmen müssen. Vielmehr wechseln sich Phasen ab: Phasen intensiver Abstimmung, die das gesamte Team betreffen, mit Phasen niedrigeren Abstimmungsbedarfs, die womöglich nur Teile des Teams betreffen, und Phasen völlig isolierter und voneinander unabhängiger Einzelarbeit, in der Personen am Stück und abgeschirmt an einem Problem arbeiten ( Abb. 3).
Abb. 3: Interdependenzmuster in Teams (vgl. Busch 2008, S. 63)
Selbst Rudermannschaften müssen nur unter Wettkampfbedingungen wirklich synchron funktionieren. In der sehr viel mehr Zeit beanspruchenden Trainingssituation kennzeichnen ebenso häufig Einzeltrainings die Vorbereitung. Zugleich sollten Schnittstellenprobleme ein wichtiger Gegenstand der Reflexion in Teams sein. In der Praxis kommen zudem bestimmte Vorgehensmodelle zum Einsatz (z. B. Projektstrukturplan, Scrum, Gantt-Diagramm), um Abhängigkeiten zu visualisieren und mögliche Abstimmungstermine zu fixieren. An späterer Stelle werden diese Aspekte noch ausführlicher unter dem übergeordneten Teamprozess der Koordination erörtert ( Kap. 2.2.3).
Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten
Es ist einleuchtend, dass eine solche Abstimmung nur dann möglich ist, wenn das Team über entsprechende Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten verfügt. Diese hängen sowohl von der realen als auch von der virtuellen Architektur ab. Die reale Architektur schafft die Voraussetzungen für eine physische Vernetzung der Teammitglieder, die virtuelle Architektur schafft die Voraussetzungen für die technische Vernetzung der Teammitglieder, z. B. über entsprechende Intranetlösungen (vgl. Busch 2015, S. 397 ff.). Kooperieren Teammitglieder standortübergreifend in einem virtuellen Team, so werden komplexere technologische, aber auch verhaltensbezogene Vernetzungslösungen erforderlich. Vereint an nur einem Standort richtet sich die Art der Zusammenarbeit danach, ob die Teammitglieder in einem Einzelbüro (Zellenbüro), Mehrpersonenbüro (Gruppenbüro), Großraumbüro, an einem flexiblen, non-territorialen Arbeitsplatz oder gar an einem mobilen Arbeitsplatz tätig sind (vgl. Gerhardt 2014, S. 51 ff.; Wohlers/Hertel 2017, S. 467 ff.). Bei additiven und kompensatorischen Aufgaben ist ein Verbleiben der Teammitglieder an ihren bisherigen verteilten Arbeitsstätten möglich.
Mit zunehmendem Interdependenzgrad dagegen wird eine temporäre oder gar vollständige räumliche Zusammenführung der Teammitglieder erforderlich, um ein dichtes Interagieren und Kommunizieren zu ermöglichen. Hierfür eignen sich besonders Mehrpersonenbüros. Eine Reinform der Face-to-face-Zusammenarbeit stellen dabei Team Rooms dar, die in einer von Olson und Kollegen geleiteten Langzeitstudie untersucht wurden, um Vor- und Nachteile sog. ko- bzw. dislozierter Zusammenarbeit herauszuarbeiten (vgl. Olson et al. 2002, S. 117 ff.; Busch 2006, S. 200 f.). In einer Art Konferenzraum, der die Arbeitsplätze der Teammitglieder, einen Tisch in der Mitte sowie Whiteboards und Flipcharts umfasst, arbeitet das Team während des gesamten Arbeitsprozesses zusammen. Nur für Phasen, die höchste individuelle Konzentration erfordern, ist die Separierung einzelner Teammitglieder vom Rest des Teams vorgesehen. Die Mitglieder stehen dabei ausschließlich dem Team zur Verfügung und besitzen keine anderen Büros.
Neben der informierenden und koordinierenden Wirkung direkter Kommunikation darf am Ende aber auch deren inspirierende Wirkung nicht vergessen werden. Die auf den MIT-Forscher Thomas J. Allen zurückgehende Beobachtung, dass 80 Prozent aller betrieblich realisierten Ideen auf direkten Kontakt von Angesicht zu Angesicht zurückzuführen sind, weist auf die essentielle Bedeutung persönlicher Gespräche hin. Wer viel miteinander spricht, kommt zwar auf viele bedeutungslose Ideen, aber auch auf manch gute und zündende Idee. Zudem konnte Allen auch eine sich wechselseitig verstärkende Beziehung zwischen direkter Kommunikation und technologievermittelter Kommunikation feststellen. Je häufiger wir uns mit jemandem persönlich unterhalten, desto häufiger werden wir mit ihm auch via Telefon, E-Mail oder sozialen Medien kommunizieren und umgekehrt (vgl. Allen/Henn 2007, S. 28 f., 51 ff.).
Daraus zog er den Schluss, dass ebenso auf Team- und Abteilungsebene eine Tendenz zur kommunikativen Abschottung besteht, die durch die Anlegung längerer, »lästiger« Wege und unausweichlicher Begegnungszonen (sog. Gravitationszentren) gezielt durchbrochen werden muss. Das effizienzgeleitete Prinzip der kurzen Wege, wie es im Fertigungsbereich üblich ist, sollte im kreativen Bereich also durch das ideenfördernde Prinzip der sich kreuzenden Wege ersetzt werden (vgl. Allen/Henn 2007, S. 91). Diese Erkenntnisse haben im Projekthaus, einem Teil des Forschungs- und Innovationszentrums der BMW Group in München, architektonische Gestalt angenommen (vgl. dazu ausführlicher Busch 2015, S. 403 ff.).
Arbeitsteilung
Mit Teamarbeit sind idealerweise sowohl quantitative als auch qualitative Leistungsvorteile verknüpft, wie sie etwa in den Sprichwörtern »Viele Hände schaffen der Arbeit rasch ein Ende« oder »Vier Augen sehen mehr als zwei« zum Ausdruck kommen. Als Organisation im Kleinformat sind in einem Team ähnliche Gestaltungsregeln anzuwenden wie im Unternehmen als Ganzes:
• Bilde spezialisierte Aufgabenprofile, besetze diese mit fachlich geeignetem Personal und schaffe die Voraussetzungen für deren kreative Vernetzung!
• Vermeide Doppelarbeit und unnötige Überschneidungen (Schnittstellen), um Reibungsverluste zu minimieren!
• Sorge für eindeutige, klar abgegrenzte Rollen und Verantwortlichkeiten, um Kompetenzstreitigkeiten und einen Zustand organisierter Verantwortungslosigkeit zu verhindern!
• Setze hinter jedes Ziel den Namen einer Person oder eines Personenkreises, denn nur persönliche Ziele sind wirksame Ziele (vgl. Malik 2006, S. 186)!
• Decke Schieflagen in der Arbeitsbelastung auf und sorge für gerechte Lastenteilung!
Im Zentrum steht immer die Frage, wie sich individuelle Stärken im arbeitsteiligen Teamverbund produktiv nutzen lassen, um eine hohe Schlagkraft bei der Zielerreichung zu entwickeln. Hiermit hat sich zuerst und bis heute am prägnantesten Peter F. Drucker befasst, dessen 1967 in den USA veröffentlichtes Werk »The effective executive« im Jahr 2014 in deutscher Übersetzung erneut aufgelegt wurde – nach bald 50 Jahren sicherlich ein Gütebeweis. Drucker ging davon aus, dass Organisationen – und damit auch ihre kleinen Geschwister, die Teams – unabhängig von ihrer jeweiligen Zielausrichtung einzig und allein den Zweck verfolgen, individuelle Stärken sinnvoll zu nutzen bzw. die Stärken einzelner Mitarbeiter so einzusetzen, dass sie sich vervielfachen (vgl. Drucker 2014, S. 23, 79; Malik 2006, S. 122 ff.). Werden Positionen stärken- und nicht sympathiebezogen besetzt und erfolgt eine sinnvolle Vernetzung, so können »ganz gewöhnliche Menschen außergewöhnliche Leistungen erbringen« (Drucker 2014, S. 88).
Teamführung
Natürlich hat bei der Favorisierung einer bestimmten Vorgehensweise oder der Lösung eines Problems auch die Teamführung ein gewichtiges Wort mitzureden. An dieser Stelle – bei der Darstellung der Grundmerkmale eines Teams – wird jedoch weniger auf den prozessualen Führungsbegriff verwiesen, d. h. die Gruppe wird geführt, also eine – wie auch immer geartete – Leitungsebene hat bestimmte Funktionen in einem Team zu erfüllen (z. B. die Leistungs- und Fortschrittskontrolle), als auf den institutionellen Führungsbegriff, d. h. ein Team hat eine Führung, eine formal ernannte Spitze, die das Team nach innen lenkt und nach außen vertritt. Dieser Spitze kommt Letztverantwortung zu und sie kann im Konfliktfall ein Machtwort sprechen. Dies kann ein Projektleiter, ein Teamsprecher oder auch ein externer Trainer sein ( Kap. 2.1.1).
Zwar gibt es heute durchaus Diskussionen, die Sinn und Zweck von Führung in Teams generell in Frage stellen, jedoch verkennt diese Sichtweise, dass es in der Praxis de facto keine machtfreien Zonen gibt. Wer Autorität in Frage stellt, bekommt sie häufig auf weniger angenehme und berechenbare Weise zurück – man denke etwa an rechtsfreie Stadtviertel, in die sich die Polizei kaum mehr hineinwagt. Und auch in vermeintlich führerlosen Teams bildet sich eine »Hackordnung« heraus. An die Stelle formeller Führungsstrukturen treten dann informelle Strukturen, die künstliche Hierarchie wird durch eine natürliche ersetzt, die gemachte durch eine gewachsene Einfluss- und Machtstruktur. »In der Wildnis entsteht immer auch eine eindeutige Leadership, instinktiv, sie folgt nicht professionellen Ausscheidungssystemen, kennt keine Führungsinstanzen« (Messner 2014, S. 302). Auf diese dynamischen Einflussmuster in Teams, die sich allerdings auch bei Existenz einer formalen Führung emergent herauskristallisieren können, wird an späterer Stelle ausführlicher eingegangen ( Kap. 3.4). In diesem Sinne ist Teamführung abzugrenzen von klassischer Personalführung, die eher eine Vorgesetzten-Untergebenen-Beziehung – die sog. Führungsdyade – begründet.
Teamleiter müssen heutzutage in der Lage sein, mit Technik und kultureller Vielfalt umzugehen, also über eine ausreichende Medien- und interkulturelle Kompetenz verfügen. Viele moderne Führungsansätze fordern überdies ein Eingehen auf die individuellen Stärken und Eigenheiten des Mitarbeiters. In Teams kann diese ungleiche Behandlung allerdings zu Unstimmigkeiten führen, denn was von dem einen als angemessen und gerecht empfunden wird, kann für den anderen das genaue Gegenteil bedeuten. In Teams finden einerseits untereinander fortlaufend Vergleichsprozesse statt, andererseits wird aber auch genau beobachtet, wie sich der Teamleiter verhält, welche Bemerkungen er macht, was er nicht kommentiert und wem er besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden lässt. Diese vielseitigen Anforderungen machen es für ihn oder sie nicht eben leichter.
Erschwerend kommen mögliche Beeinflussungsversuche von seiten einzelner Teammitglieder und persönliche Sympathien auf seiten des Teamleiters hinzu. Im Laufe der Zeit bilden sich deshalb oft eine »In-Group« und eine »Out-Group« heraus: »In der privilegierten Innengruppe sind jene Mitarbeiter, mit denen die Führungskraft keine Probleme hat, weil sie fähig, engagiert, loyal und sympathisch sind. Die Randgruppe dagegen ist aus den schwierigen Mitarbeitern zusammengesetzt. Die Beziehungen zur ›in-group‹ gestalten sich informell-locker, vertrauensvoll, respektierend und sind durch hohen gegenseitigen Einfluss ausgezeichnet (…), während im Kontakt zur ›out-group‹ Formalität, Misstrauen, Distanz und einseitig vorgesetztenbetonter Einfluss vorherrschen« (Neuberger 2002, S. 335. Zu der dahinterstehenden Erklärung der sog. Leader-Member Exchange Theory vgl. Graen/Uhl-Bien 1995, S. 225 ff.; Lord et al. 2017, S. 442).
Der Aufbau konstruktiver und vertrauensvoller Zusammenarbeit setzt in einem viel stärkeren Maße als früher emotionale Intelligenz, Empathie, Selbstreflexion und Achtsamkeit voraus (vgl. Sauer et al. 2011, S. 343 ff.; von Au/Seidel 2017). Der Teamführer wird zum Coach, der sein Team nicht nur zum Ziel führen muss, sondern ihm dabei auch Lern- und Wachstumschancen zu bieten hat. Insgesamt ergibt sich daraus eine stärkere Psychologisierung des Führungsverhaltens, das mehr auf gute Beziehungen, Umgang mit Emotionen sowie die Entwicklung von Sinnerleben ausgerichtet ist (vgl. von der Oelsnitz 2017a, S. 90 ff.).
Handlungsautonomie
Idealerweise erschafft der Teamleader ein Umfeld, in dem sich Teammitglieder am Ende selbst leiten können (vgl. Blanchard/Carew/Parisi-Carew 2015, S. 101). Die beste Führung ist demnach – auch wenn es zunächst paradox klingt – diejenige, die sich selbst mit der Zeit überflüssig macht bzw. immer mehr in den Hintergrund tritt. Dies geschieht, indem sie das Team zur Selbstführung anleitet und den Teammitgliedern das Gefühl der Freiheit und Eigenverantwortung vermittelt (vgl. Manz/Sims 1995). Es gibt Vorgesetzte, denen es gelingt, dass Mitarbeiter ihnen vertrauen, und Vorgesetzte, denen es gelingt, dass Mitarbeiter sich selbst vertrauen (vgl. Sprenger 2007, S. 49 ff.). Vor allem dieses Selbstvertrauen reduziert den Führungsbedarf in Teams – vorausgesetzt natürlich, die Teammitglieder verfügen über die notwendige fachliche und charakterliche Reife.
Die Handlungsautonomie von Teams kann sich auf vier Kategorien erstrecken (vgl. Gemünden/Salomo 2005, S. 64 ff.; Busch 2015, S. 462 f. sowie allgemein Sichler 2006):
• Zielsetzungsautonomie betrifft zum einen die Frage, wieviel Spielraum bei der Definition des gemeinsamen Ziels besteht. Ziele können präzise formuliert und vorgegeben sein (z. B. zu erfüllende Kennzahlen im Produktionsbereich), sie können sich innerhalb eines flexiblen Korridors bewegen (z. B. Erfüllung bestimmter Anforderungen eines Kunden) oder auch sehr vage und offengehalten sein (z. B. bei künstlerischen Werken). Zum anderen besitzt das Team Freiräume darin, zu bestimmen, wie es sich dem vorgegebenen Ziel durch das Setzen von Teilzielen und Meilensteinen iterativ annähert, welches Tempo es hierbei an den Tag legen will und welches Teammitglied bzw. welche Teile des Teams für die Erreichung welcher Teilziele verantwortlich sind.
• Ressourcenautonomie betrifft die Frage, inwiefern ein Team über ein eigenes Budget und über sonstige Ressourcen verfügt, über deren Zuweisung es selbstständig bestimmen kann. Für den Teamführer schließt dies auch Freiheiten bei der Auswahl von Personal und der Zusammensetzung des Teams mit ein. Bei Neuzugängen in bereits bestehende Teams kann auch das Team mit involviert werden (vgl. Busch/Lorenz 2009, S. 54 ff.; von der Oelsnitz/Busch 2014, S. 86 ff.).
• Strukturelle Autonomie betrifft die (Nicht-)Einbindung des Teams in die formale Weisungsstrukur der rahmengebenden Organisation. Ist es der »Linie« untergeordnet, muss es sich mit dieser abstimmen oder kann es sich gegen diese durchsetzen, indem es allein dem Top Management unterstellt ist? Im Zusammenhang damit steht die Frage, ob Teammitglieder sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht vollumfänglich für ein Team abgestellt sind (etwa im Rahmen eines Projektvorhabens) oder ob sie weiterhin in ihrem angestammten Arbeitsbereich bleiben und nur Teile ihrer Arbeitszeit für Teamaufgaben aufwenden. Sie wären dem »Zugriff« der Teamführung dann weitgehend entzogen.
• Soziale Autonomie betrifft die schon angesprochene Definition von Zuständigkeiten, die Art der Aufgabenverteilung, den Partizipationsgrad des Teams, und das Wie der Zusammenarbeit, z. B. die Gestaltung von Teamprozessen, die Aufstellung von Regeln und Standards, die Wahl der Kommunikations- und Führungsstruktur, die Wahl einzusetzender Verfahren und Handlungsstrategien oder das Ausmaß der zu beachtenden Förmlichkeit. Ein Beispiel für eher begrenzte soziale Autonomie ist die teilautonome Arbeitsgruppe im Fertigungsbereich. Diese kann zwar nicht den Arbeitstakt und das zu erbringende Pensum selbst bestimmen, aber zumindest eigenständig über die Einsatzplanung während einer Schicht oder die Urlaubsplanung entscheiden (vgl. Antoni 2000, S. 52).
Je innovativer ein Vorhaben ist, desto mehr Freiräume sollte ein Team besitzen. Dessen Mitarbeiter sind keinen unnötigen bürokratischen Zwängen unterworfen, wodurch sie in der Lage sind, in besonderem Maße eine Aufbruchstimmung wie in einem gerade gegründeten Unternehmen zu entwickeln. Dieser Grundgedanke geht auf die sog. Skunk works zurück, ein Geheimlabor des amerikanischen Luftfahrtunternehmens Lockheed Martin, das in den 1940er Jahren eine rasche Antwort auf den von den Deutschen entwickelten Düsenjäger finden sollte. Dies geschah, indem man einen Trupp hochtalentierter Experten zusammenbrachte, diese strikt von der Außenwelt isolierte und ihnen ausreichend Autonomie gab, damit sie sich hochkonzentriert ihrer Aufgabe widmen konnten (vgl. Rich/Janos 1994; Brown 2004, S. 134 ff.). Das Skunk Work-System ist seitdem häufig kopiert worden. Der BMW i3, das Betriebssystems Android oder der Macintosh wurden in Teams entwickelt, die unter ähnlichen Bedingungen arbeiteten.
Existenz einer Teamgrenze und Regelung der Teamzugehörigkeit
Teams, die völlig losgelöst von betrieblichen Strukturen arbeiten, tendieren dazu, eine besondere Selbstwahrnehmung zu entwickeln. Sie fühlen sich oft als innovative Speerspitze, als eine mit einer bedeutsamen Mission betraute Avantgarde, die dabei hilft, die Gesamtorganisation erfolgreich in die Zukunft zu führen. Das Macintosh-Team etwa lebte den Slogan »It’s more fun to be a pirate than to join the navy« und grenzte sich damit deutlich vom Rest der Organisation ab. »Jobs besaß die geniale Begabung, Gruppenidentität zu erzeugen. Er verteilte T-Shirts und lockte mit so kindischen Belohnungen wie einem Waggon Ananas-Pizza für alle, wenn sie bis zu einem bestimmten Termin ein besonders kniffliges Problem bewältigten. Er umgab ihre Arbeit mit der Aura des Mystischen (…) Der Macintosh war ihr geheimes Projekt von welterschütternder Wichtigkeit« (Bennis/Biederman 1998, S. 95).
Auch in seiner späteren Phase bei Apple betrieb Steve Jobs eine exzessive Grenzziehung für diejenigen Teams, die wichtige Innovationsprobleme zu lösen hatten. Er erklärte sie kurzerhand zu Sperrzonen innerhalb eines Gebäudekomplexes, ließ Fenster entfernen oder mattieren, Türen mit neuen Schlössern versehen, die nur mit entsprechender Identifikationskarte zu öffnen waren, und verlangte von Teammitgliedern uneingeschränkte Verschwiegenheit, zu der sie sich in vertraglichen Vereinbarungen unter Androhung von Strafen bei Nichtachtung zu verpflichten hatten. Niemand durfte sich »verplappern« und der kursierende Spruch »Geschwätzigkeit führt zum Untergang des Schiffs« wurde mehr als ernst genommen, so dass selbst Kollegen oft erst anlässlich von Produktpräsentationen erfuhren, woran die Geheimprojekte die ganze Zeit gearbeitet hatten (vgl. Lashinsky 2012, S. 41 f., 48 f.).
Die Abgrenzung eines Teams nach außen ist ein zentraler Mechanismus, um eine eigene Identität aufzubauen und um bei Teammitgliedern die Identifikation mit dem eigenen Tun und dem der Gruppe zu erhöhen. Dadurch steigen Engagement und Kooperationsbereitschaft (vgl. Busch 2015, S. 265). Für Teams ist die Frage der Grenze und der Zugehörigkeit somit ebenfalls ein grundlegendes Merkmal, ja erst wenn eine Grenzziehung möglich ist, kann überhaupt von einem echten Team gesprochen werden. Problematisch werden Grenzziehung und Identitätsbildung allerdings in Teams mit wechselnden Mitgliedschaften (z. B. in schichtbedingt zusammengestellten OP-Teams) sowie in Teams mit fluiden Teamgrenzen, in denen neben Kernmitgliedern auch periphere Mitglieder außerhalb der Organisation wie Freelancer oder Berater, oft nur temporär, mitarbeiten (vgl. Dineen/Noe 2003, S. 6). Zwar steigt in diesen Teams die Kreativität durch den zusätzlichen Wissenszufluss, doch geht dies häufig zu Lasten des Teamzusammenhalts ( Kap. 2.2.9).
Vor ähnlichen Herausforderungen sehen sich virtuelle, d. h. standortübergreifend kooperierende Teams gestellt. Die Verarmung der Kommunikation, die die »kalte« elektronische Kommunikation im Vergleich zum »warmen« persönlichen Kontakt mit sich bringt (vgl. Hertel/Orlikowski 2012, S. 332), erschwert den Aufbau von Vertrauen und die Entwicklung einer sich nach außen abgrenzenden Teamkohäsion. Ein Gefühl der Zughörigkeit stellt sich über Distanz nur schwer ein. Der Managementvordenker Charles Handy hat dies auf die einprägsame Formel »Trust needs touch« gebracht und ergänzt dies durch die Beobachtung, dass mit zunehmender Virtualisierung von Beziehungen der Bedarf an persönlichen Kontakten und vertrauensfördernden Maßnahmen nicht ab-, sondern sogar noch zunimmt (vgl. Handy 1995, S. 46; Breuer/Hüffmeier/Hertel 2016, S. 1152 ff.) ( Infobox »Virtuelle Teams«).
Infobox »Virtuelle Teams«
Angesichts der Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien stellt sich die berechtigte Frage, ob es überhaupt noch Teams gibt, die allein analog, von Angesicht zu Angesicht kommunizieren. Denn selbst Arbeitsformationen, die räumlich an einem Standort arbeiten, kommunizieren über E-Mail, greifen auf gemeinsame Datenbanken zurück und verwenden technologiegestützte Lern- und Kollaborationsformen. Im engeren Sinne kann von virtuellen Teams jedoch nur dann gesprochen werden, wenn deren Mitglieder über mehrere Standorte verteilt sind, sich also nicht zu Fuß erreichen können.
Als Erfolgsbedingungen virtueller Teams werden genannt (vgl. Kauffeld/Handke/Straube 2016; Cohen/Alonso 2013; Hertel/Geister/Konradt 2005; Martins/Gilson/Maynard 2004; Gibson/Cohen 2003):
• Der Vertrauensaufbau zu Beginn in einem persönlichen Treffen (Kick-off-Meeting);
• die Aufstellung klarer Kommunikations- und Verhaltensregeln (z. B. Beantwortung von E-Mails innnerhalb eines gewissen Zeitraums);
• die Einigung auf eine von allen beherrschte Geschäftssprache;
• die an der Aufgabenkomplexität, aber auch an kulturellen Usancen ausgerichtete Wahl des adäquaten Kommunikationsmediums (Stichwort: media richness; vgl. Daft/Lengel 1984, S. 195 ff. sowie ausführlicher hierzu Döring 2003, S. 127 ff.);
• die allgemeine Sensibilität gegenüber interkulturellen Unterschieden;
• die Kompatibilität der IT bzw. der verwendeten Soft- und Groupware;
• die Herstellung von Datensicherheit und die Klärung von Zugangsfragen;
• eine besonders aktive Führung, die klare Arbeitspakete definiert, auf die Einhaltung von Terminen achtet, regelmäßige Fortschrittskontrollen durchführt und typische Konflikte reguliert (z. B. Enflaming oder unerwünschte Subgruppenbildung).
In dem Zusammenhang wird auch von »E-Leadership« oder »Digital Leadership« gesprochen. Die Teammitglieder selbst sollten in besonderem Maße offen sein für Neues, überdies frustrationstolerant und fähig zur Selbststeuerung.
1.2 Spezielle Teamarten
Teamarten lassen sich auf verschiedene Weise differenzieren (vgl. hierzu etwa Antoni 2000, S. 24 ff., Kriz/Nöbauer 2008, S. 28 ff. oder Eberhardt 2013, S. 12 f.). Teams kommen in Unternehmen
• auf unterschiedlichen Hierarchieebenen (Top, Middle, Lower Management),
• in unterschiedlichen funktionalen Bereichen (z. B. Produktion, Service, Logistik, Forschung und Entwicklung, Public Relations)
• in der Verwaltung (Büroorganisation) oder der unmittelbaren Wertschöpfung (Fertigungsorganisation),
• organisationsintern oder organisationsübergreifend,
• mit dispositiven Aufgaben (Planung, Organisation, Kontrolle), mit operativen Aufgaben oder einer Mischung von beidem
zum Einsatz.
• Sie variieren in ihrer Zusammensetzung, in ihrer Handlungsautonomie und dem Grad ihrer räumlichen Zusammenführung.
• Teams können auf Dauer angelegt und in die Arbeitsorganisation integriert sein oder nur temporär – projektbasiert bzw. anlassbezogen – gebildet werden.
• Der von ihnen verfolgte Zweck kann von strategischer Bedeutung sein, aber auch taktische und operative Probleme betreffen.
• Und schließlich kann ihre Entstehung formell initiiert werden oder informell, von oben ungeplant erfolgen. Ein typisches Beispiel für informelle Teams, deren Grenzen sich nicht klar abstecken lassen, sind Expertengemeinschaften, sog. Communities of practice (vgl. Wenger/Snyder 2000, S. 143 ff.).
Die Vielfalt möglicher Abgrenzungskriterien lässt leicht erkennen, dass es keinen universal gültigen Schlüssel zur Kategorisierung von Teams gibt. Die Frage ist eher, wie brauchbar bestimmte Kriterien sind, um eine sinnvolle Ordnung zu schaffen. Nachfolgend wird diese Ordnung mit Hilfe der beiden Lern- und Aktivitätsmuster Exploitation und Exploration zu erreichen versucht.
Es gibt demzufolge Teams, die Standardprobleme zu lösen und hierbei auf vorgefertigtes Prozesswissen und Handlungsroutinen zurückgreifen, Teams, die komplexe Probleme unter oft dynamischen Bedingungen bearbeiten und hierzu ebenfalls einerseits auf eingespielte Handlungsroutinen angewiesen sind, andererseits aber auch arbeitsbegleitend lernen müssen, und schließlich Teams für neuartige Probleme, für die es keine vorgefertigten Lösungswege gibt. Entsprechend dieser lernorientierten Unterteilung werden von uns verschiedene Teamarten entlang eines Exploitation-Exploration-Kontinuums unterschieden. Lernprozesse als Ausgangspunkt zur Differenzierung von Teamformen heranzuziehen, erscheint deswegen besonders vielversprechend, weil ausnahmslos jeder Teamleistung ein Lernvorgang vorgelagert ist ( Abb. 4).
Abb. 4: Teamarten und Lernmodus
Das eine Mal müssen die Rahmenbedingungen von Teamarbeit also so gestaltet sein, dass ein möglichst präzises, maschinenartiges Funktionieren gewährleistet wird; das andere Mal sind sie so einzurichten, dass ein Lernen mit- und voneinander bzw. eine gegenseitige Anregung zum kreativen Denken stimuliert wird. Die Gestaltung passender Rahmenbedingungen wird durch grundlegende Fragen bestimmt, die darüber entscheiden, ob ein Team stärker exploitative oder stärker explorative Lernanteile aufweisen sollte.
• Wie neuartig (bekannt) ist die Aufgabe (= Innovationsgrad)? Wie (un-)gewiss und (wenig) vorhersehbar ist das Ergebnis?
• Geht es um die Verwertung und Anwendung bestehenden Wissens oder um den Aufbau und die Erzeugung neuen Wissens?
• Handelt es sich um einen Einzel-, Projekt-, Regel- oder Routinefall? Daraus abgeleitet: Wie hoch ist die Aufgabenkomplexität und -variabilität, die Plan- und Strukturierbarkeit, die Gleichartigkeit und der Wiederholungsgrad der Gesamtaufgabe? Gibt es ein ideales Prozessmuster?
• Wie standardisiert und repetitiv kann der Aufgabenvollzug dementsprechend gestaltet werden? Gibt es vorab definierbare Leistungs- und Bewertungskriterien der Einzel- und Teamarbeit?
Bevor in Kapitel 1.3.3 noch gründlicher auf die beiden generellen Lernmuster Exploration und Exploitation eingegangen wird, sollen zunächst die Eigenarten und Herausforderungen der hier unterschiedenen Teamarten näher betrachtet werden. Abbildung 5 gibt zunächst einen Überblick über Teams, die sich unter die abgegrenzten Teamarten subsumieren lassen.
Abb. 5: Unterschiedliche Teamarten und Beispiele
1.2.1 Arbeitsteams
Vielleicht ist der Begriff Arbeitsteam etwas unglücklich gewählt, weil natürlich alle anderen Teams ebenfalls Arbeit leisten. Arbeiten ist hier im Sinne eines sich wiederholenden Vollzugs von im Grunde einander stark ähnelnden Tätigkeiten zu verstehen. Entsprechend ausgerichtete Teams haben operative Aufgaben zu erledigen, die inhaltlich über die Zeit hinweg weitgehend gleichförmig bleiben. Typische Beispiele sind Fertigungsteams, die tagein tagaus bestimmte Bauteile für ein Endprodukt zusammenfügen oder arbeitsteilig funktionierende Teams in einer Großküche.
Gerade weil die hier zu verrichtenden Tätigkeiten eher monoton sind, ist – ausgerichtet am Vorbild des Toyota Produktionssystems – in vielen Betrieben ein Wandel in der Fertigungsphilosophie vollzogen worden. Inzwischen ist Teamarbeit mit rotierenden Arbeitsplätzen die dominante Form der Arbeitsorganisation und hat die über Jahrzehnte vorherrschende Einzelarbeit in diesem Bereich abgelöst. Bei der Volkswagen AG erfolgte dieser Wechsel erstaunlicherweise erst im Jahr 2008 im Zuge der vom damaligen Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn vorangetriebenen »Mach 18«-Strategie. Inwiefern mit dem Wechsel von der tayloristisch geprägten Einzelarbeit zur toyotistisch geprägten Teamarbeit tatsächlich Kostensenkungen, Produktivitätssteigerungen und Lernvorteile verknüpft sind, lässt sich kaum pauschal beantworten.
1.2.2 Kontroll- und Untersuchungsteams
Kontroll- und Untersuchungsteams weisen einen solchen auf Wiederholung ausgerichteten Arbeitscharakter nicht auf. Exploratives Lernen ist hier wichtiger. Diese Teams kommen in ganz unterschiedlichen Aufgabenfeldern zum Einsatz. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Informationen über bestimmte Vorfälle (Problem, betriebliche Störung, Verbrechen), über eine Institution oder den Teilbereich einer Institution sammeln, die einzelnen Informationseinheiten wie in einem Puzzle zu einem Gesamtbild integrieren, korrekt untersuchen (Ist-Analyse) und darauf aufbauend zu Bewertungen und/oder Empfehlungen gelangen müssen. Im Polizeibereich sind Teams in der kriminaltechnischen Untersuchung und Spurensicherung Beispiele für das Zusammenfügen von Puzzleteilen und die Rekonstruktion eines Tathergangs oder Unfalls.
Im Gegensatz zu Überwachungsteams im Hochleistungsbereich (z. B. Luftraumüberwachung, Sicherheitsmaßnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen) ist das zu analysierende Beobachtungsobjekt bzw. Ereignis nicht simultan, d. h. im Bewegungszustand zu erfassen, sondern es erfolgt eher eine Momentaufnahme und eine gründliche Betrachtung der bis dahin stattgefundenen Entwicklung. Entsprechend steht mehr Zeit für die Auswertung und Reflexion von Daten und Materialien zur Verfügung. Ein typisches Beispiel in der Politik ist ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Mit diesem Kontrollinstrument versucht speziell die Opposition eines Parlaments zu überprüfen, ob das Handeln der Regierung oder einzelner Minister und Staatssekretäre in einer speziellen Angelegenheit korrekt und frei von persönlichen Vorteilnahmen war. Historisch einmalig und später von vielen anderen Staaten zum Vorbild genommen war die von Nelson Mandela eingesetzte Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika, die sich von 1996 bis 1998 unter der Leitung von Erzbischof Desmond Tutu mit der Aufarbeitung von Apartheidsverbrechen befasste.
Die Qualität der Leistung eines Kontrollteams hängt zum einen von der Expertise und Gründlichkeit der Kontrolleure bzw. Untersucher ab: Verstehen diese überhaupt das, was sie überprüfen sollen? Verfügen sie über ausreichend Sachkenntnis und Erfahrung? Und sind sie bereit, genügend Zeit und Mühen in die Suche nach der Wahrheit zu investieren? Entscheidend für die angestrebte Annäherung an die Wahrheit ist, wie offen und kritisch Diskurse in einem Kontrollgremium geführt werden (dürfen), wie frei und unabhängig einzelne Mitglieder in ihrer Meinungsbildung sind und wie häufig sich ein solches Gremium trifft. Der letzte Aspekt wurde speziell im Hinblick auf Aufsichtsräte im Gefolge der Finanzmarktkrise intensiv diskutiert. Und nicht zuletzt spielen auch Teamdynamiken wie plötzliche Stimmungswechsel und unsichtbare »Hackordnungen«, die einen subtilen Zwang ausüben, eine Rolle.
Als Machtquelle häufig unterschätzt wird das sog. Agenda Setting. König (1998, S. 32 f.) ordnet dies der »situativen Kontrolle« zu, d. h. der Strukturierung der räumlich-zeitlichen Umstände (z. B. Architektur, Sitzordnung, Verfahrenstricks). Hierbei handelt es sich um eine Macht über die Verhältnisse im Gegensatz zur Macht in den Verhältnissen. Durch »geschicktes« Setzen der Tagesordnung lassen sich Untersuchungsergebnisse, wenn schon nicht präjudizieren, so doch in eine bestimmte Richtung lenken. Die Frage nach dem »cui bono?« (wem nützt es?) kann Aufschluss über die richtungsgebenden Interessen im Hintergrund geben:
• Welche Punkte kommen auf die Tagesordnung, welche werden weggelassen?
• In welcher Reihenfolge werden einzelne Punkte behandelt, wieviel Zeit steht zu ihrer Behandlung zur Verfügung und in welchem Licht werden sie dargestellt?
• Wie kurzfristig werden Informationen den Teilnehmern im Vorfeld zur Verfügung gestellt, d. h. wieviel Zeit bleibt diesen zu einer gründlichen Prüfung und Einschätzung?
• In welcher Art und Weise werden Diskussionen geführt? In einer eher konstruktiven oder eher einschüchternden Atmosphäre?
• Gibt es eine »hidden agenda«, d. h. steckt hinter der geäußerten Meinung eine andere, persönlichen Interessen folgende Tagesordnung, die eigentlich durchgesetzt werden soll?
• Finden die Diskussionen zu einer Tageszeit statt, in der der Biorhythmus eine entsprechende Aufmerksamkeit zulässt oder werden unliebsame Punkte kurz vor dem Mittagessen oder kurz vor Dienstschluss behandelt?
1.2.3 Hochleistungsteams
Hochleistungsteams – alternative Bezeichnungen sind High Reliability-Teams, High Responsibility-Teams oder Einsatzteams – üben zum Teil ebenfalls Kontrollaufgaben aus, allerdings im »Livezustand«. Sie nehmen eine interessante Zwischenstellung zwischen Arbeits- und Innovationsteams ein. »Einerseits greifen sie auf ein festes Handlungsrepertoire und eingespielte, zumeist hochstandardisierte Prozessabläufe zurück, andererseits müssen sie aber auch in der Lage sein, auf völlig neuartige Situationen adäquat zu reagieren, da sie unter dynamischen und komplexen Umweltbedingungen agieren« (Busch 2015, S. 21). Beispiele sind Rettungsteams, OP-Teams, Zugriffteams bei der Verbrechensbekämpfung, aber auch Teams in Sportarten mit unmittelbarem Gegnerkontakt. In solchen Einheiten bildet die hochkonzentrierte Verknüpfung von Einzelaktivitäten (»heedful interrelating«) den entscheidenden Erfolgsfaktor (vgl. Weick/Roberts 1993). Alles muss Hand in Hand gehen und das möglichst schnell und präzise. In dieser Notwendigkeit, routinierte, »im Schlaf« beherrschte Handlungsabfolgen zu entwickeln, gleichen Hochleistungsteams Arbeitsteams – allerdings sind die Handlungen oder Entscheidungen als solche zumeist wesentlich voraussetzungsreicher, vielschichtiger und in ihren Konsequenzen gravierender. Ein OP-Team kann einen Patienten verlieren, eine Geiselbefreiung eskalieren und eine militärische Einheit aufgerieben werden.
Die insgesamt sehr hohe Komplexität lässt sich nur über hochstandardisierte Handlungsabläufe (standard operating procedures) beherrschen, um die Fehleranfälligkeit so niedrig wie nur möglich zu halten. Der Fußballtrainer Jürgen Klopp etwa »ist sich nicht zu schade, mit gestandenen Profis elementare Dinge wie die richtige Ballannahme hundertfach zu üben. Training bedeute Wiederholung, sagt er; Schlagzeuger würden zum Beispiel einzelne Sequenzen 1600-mal wiederholen, bis sie sie intuitiv beherrschten. So funktioniere auch der Fußball: Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung« (Honigstein 2016, S. 50). Auch im Umgang mit hochtechnologischen Gerätschaften (z. B. Flugzeuge, Panzer, Überwachungsanlagen) sind Standardisierung, Wiederholung und Routine essentielle Bestandteile des Handlungsvollzugs, um menschlicher Überforderung entgegenzuwirken. Exemplarisch hierfür stehen sklavisch abzuarbeitende Checklisten, die all das enthalten, was getan werden muss, damit nichts schiefgeht.
Ginnett (1990, S. 442 ff.) spricht speziell für Cockpit Crews im Luftfahrtbereich von einem festen Handlungsrahmen, dem sich die Besatzungen gegenübersehen, von einem vorgefertigten Gehäuse (preexisting shell) mit fixen Rollenerwartungen und festgelegter Instrumentenanordnung, in das die Crew steigt. Die Verhaltensweisen von Besatzungsmitgliedern sind derart standardisiert, dass es egal ist, wer diese Rollen gerade ausfüllt.
Statistische Auswertungen der US-Flugsicherheitsbehörde zeigen, dass im Luftfahrtbereich gerade dann die meisten Zwischenfälle passierten, wenn die Besatzungen das erste Mal miteinander geflogen waren (vgl. Hackman 2009, S. 95). Es scheinen also jenseits vordefinierter Erwartungen auch zusätzliche Aspekte wie wechselseitige Vertrautheit und eingespieltes Zusammenwirken sowie die darauf aufbauende Fähigkeit, auf unvorhergesehene Ereignisse richtig zu reagieren, im Team eine Rolle zu spielen (vgl. Huckman/Staats 2014, S. 6 f.). Der allgemeinen Bedeutung von Standards in hochkomplexen Situationen tut dies jedoch keinen Abbruch. Die Infobox »Hochleistung unter Lebensgefahr« geht den weiteren Erfolgsbedingungen von Hochleistungsteams genauer auf den Grund.
Infobox »Hochleistung unter Lebensgefahr«
Im Projekt »Lernen in und von Hochleistungssystemen« sind die Forscher Peter Pawlowsky, Peter Mistele und Silke Geithner an der TU Chemnitz der Frage nachgegangen, welche Erfolgsmuster Hochleistungsteams auszeichnen (vgl. Pawlowsky/Mistele/Geithner 2005; Mistele 2007; Mistele 2008; Pawlowsky/Mistele 2008). Untersucht und befragt wurden Formel 1-Boxenteams, Spezialeinheiten der deutschen Polizei (Sondereinsatzkommando, Mobiles Einsatzkommando), medizinischer Rettungsdienst und Feuerwehr – alles Einheiten, die unter Stressfaktoren wie Zeitnot, Entscheidungsdruck, Hektik, Lärm, Eigen- und Fremdgefahr und unvollständigen Informationen in Gestalt intransparenter Einsatzlagen arbeiten.
Es zeigte sich, dass sämtliche Hochleistungsteams auf ähnliche Grundvoraussetzungen zurückgreifen, die ein ruhiges und konzentriertes Arbeiten selbst unter Stress erlauben:
• Zielorientierung: Alle akzeptieren und identifizieren sich stark mit den Zielen (z. B. Menschen retten) und den daraus abgeleiteten Handlungsvorgaben, wobei deren Umsetzung im Einsatz ausreichend Handlungsspielraum lässt. Die Motivation ergibt sich aus dem sichtbaren Erfolg, weniger über Geld und erreichte Kennzahlen.
• Achtsamkeit: Einerseits meint dies eine Geisteshaltung, die die Umwelt und deren Veränderungen ganzheitlich und frühzeitig wahrnimmt. Andererseits ist damit der Blick für Details, für schwache Signale und geringfügige Abweichungen, die potenzielle Fehler signalisieren, gemeint.
• Flexible Einsatzstruktur und Führung: Es gibt immer einen Einsatzleiter, bei dem alle Fäden und Informationen zusammenlaufen und der koordinierend eingreift, d. h. es existiert ein hierarchisch strukturiertes Befehlsschema, doch kommt den Mitarbeitern vor Ort ein hohes Maß an dezentraler Entscheidungsbefugnis zu, um flexibel auf unterschiedliche situative Herausforderungen reagieren zu können. Eine klare Führungsstruktur wird von allen unter Einsatzbedingungen akzeptiert.
• Klares Rollenverständnis und fachliche Redundanzen: Jeder weiß genau, was zu tun ist und wie die eigene Tätigkeit mit den Tätigkeiten der anderen Teammitglieder zusammenhängt. Das Team funktioniert also mit klar definierten und ineinandergreifenden Rollen. Dabei besteht ein hohes Maß an fachlicher Redundanz, so dass im Falle des Ausfalls eines Teammitglieds sofort ein anderes seine Stelle nahtlos übernehmen kann.
• Lernfähigkeit: Gelernt wird im Einsatz, d. h. konkrete Situationen dienen als Lernauslöser und Lerngegengstand. Handlungsbegleitendes Feedback und regelmäßige Kurzreflexionen in Form einer Einsatznachbesprechung dienen dazu, Fehler offenzulegen und auszumerzen ( Kap. 2.3.3). Die Fehlerauswertung und die Analyse kritischer Ereignisse werden als unverzichtbare Lernquelle begriffen.
Das im Vorfeld von Einsätzen stattfindende Einüben und Lernen von Standards ist auch deshalb notwendig, weil die Ergebnisse in Hochleistungsteams im Vergleich zu den meisten herkömmlichen Teams nicht mehr rückgängig zu machen sind. Einsätze – einmal im Gange – lassen sich überdies nicht einfach abbrechen. Und Reflexionspausen sind, wenn überhaupt, nur sehr kurz möglich (vgl. Hagemann/Kluge/Ritzmann 2011, S. 24). Hochleistungsteams müssen eben Entscheidungen unter Echtzeitbedingungen treffen (»naturalistic decision making«), d. h. mit kritischen Zuspitzungen und Situationen, in denen sich Entscheidungspunkte herauskristallisieren, rechnen. An diesen Entscheidungspunkten gibt es mehrere Handlungsmöglichkeiten, und ein erfahrener Einsatzleiter muss rasch darüber entscheiden, welche darunter die richtige ist (vgl. grundsätzlich Klein 2003, S. 30 f.).
1.2.4 Verhandlungsteams
Seltsamerweise führt dieser Teamtyp innerhalb der Teamforschung ein Mauerblümchen-Dasein, obwohl ihm im Alltag eine immense Bedeutung zukommt. Im politischen Bereich etwa zählen Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition, zwischen unterschiedlichen Staaten oder zwischen Konfliktparteien zum Alltagsgeschäft. Im wirtschaftlichen Bereich spielen Verhandlungen zwischen Ministerien und Industrieverbänden, zwischen Unternehmen und diversen Kooperationspartnern, mit denen beispielsweise eine strategische Allianz gebildet wird, eine ebenso wichtige Rolle.
Ein Beispiel für ein Verhandlungsteam im Vertrieb ist ein Selling Team. Dieses ist in der Regel interdisziplinär zusammengesetzt; sein Ziel ist es, dem Kunden ein komplexes Produkt zu verkaufen. Damit ist ein Verhandlungsteam etwas anderes als ein Entscheidungsteam, denn dieses trifft im Gegensatz zum Verhandlungsteam nicht unmittelbar auf eine Gegenpartei, d. h. Positionen müssen nur untereinander geklärt werden. In Verhandlungsteams entstehen qualitativ andere (Gruppen-)Dynamiken.
Wie solche Dynamiken im politischen Bereich aussehen können, haben die stürmischen Verhandlungen zwischen der EU und Griechenland um Finanzhilfen eindrücklich gezeigt. Dabei wurde die Öffentlichkeit von den Akteuren bewusst für die eigenen Zwecke genutzt. Und auch verhandlungstaktische Kniffe kamen zum Einsatz, um die eigene Position zu stärken. Dem (inzwischen ehemaligen) griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis etwa wurde die unredliche Anwendung spieltheoretischer Erkenntnisse – Bluff, scheinbarer Verhandlungsabbruch, unterschwellige Drohungen – unterstellt. Ein aktuelles Beispiel für derartig zähe Aushandlungsprozesse bilden die Verhandlungen zwischen der Volkswagen AG und den US-Behörden um fällige Schadensersatzzahlungen aufgrund softwaremanipulierter Dieselkraftfahrzeuge (»Abgas-Skandal«).
In solchen Verhandlungssituationen geht es, ähnlich wie in Hochleistungsteams, um die richtige taktische Führung, unmittelbares Lernen und dynamische Entscheidungsbildung. Fragen, die sich solchen Teams stellen, sind etwa:
• Was ist unser Verhandlungsziel und bis wohin sind für uns Verhandlungsergebnisse noch akzeptabel?
• Welche Verhandlungstaktiken bieten sich uns? Welche Taktiken könnte die Gegenpartei einsetzen? Und wie reagieren wir hierauf?
• Wie sind die äußeren Rahmenbedingungen zu gestalten?
• Über welche Machtposition verfügen wir und wie riskant können wir entsprechend verhandeln?
• Beinhaltet die Gesprächsführung auch ein Timing der bereitgestellten oder bewusst zurückgehaltenen Informationen?
• Wie nutzen wir vergangene Erfahrungen und inwiefern können wir von anderen Verhandlungsteams im Unternehmen lernen?
• Welche Rollen haben die einzelnen Teammitglieder in der Verhandlung zu übernehmen?
• Welche landes- und organisationskulturellen Eigenheiten gilt es bei der Verhandlungsführung zu beachten (vgl. dazu ausführlicher Portner 2010)?
1.2.5 Entscheidungsteams
Informationen müssen auch in Entscheidungsteams verarbeitet und gewichtend diskutiert werden. Die einzige Aufgabe dieser oft auch mit Leitungsaufgaben betrauten Teams besteht darin, einen finalen Beschluss vorzubereiten und zu treffen. Eine Jury auf der Berlinale hat darüber zu entscheiden, welcher Film einen Bären bekommen soll. Ein Stiftungsrat entscheidet darüber, an welche Stipendiaten Stiftungs- oder Preisgelder vergeben werden. Die Geschäftsführung entscheidet über den strategischen Kurs eines Unternehmens.
Sicherlich haben auch alle anderen hier betrachteten Teamarten fortlaufend Entscheidungen zu treffen, allerdings macht dieser Zweck in Entscheidungsteams den alleinigen Daseinsgrund aus. Entsprechend rückt die Art der Entscheidungsfindung in den Vordergrund: Wie kommen Entscheidungen zustande? Wie frei ist ein Entscheidungsteam von äußeren Zwängen? Gibt es formalisierte Entscheidungsregeln (z. B. vorgegebene Sprechzeiten, erforderliche Mehrheiten bei Dissens)? Wie gelangt das Team zu Informationen und zu Beurteilungen? Welche Rolle spielen Macht und Hierarchie? Welche Formen der Überzeugung werden eingesetzt? Wie wird generell mit Minderheitsmeinungen umgegangen ( Infobox »Die zwölf Geschworenen«)?
Infobox »Die zwölf Geschworenen«
In dem Filmklassiker »Die zwölf Geschworenen« von Sydney Lumet aus dem Jahr 1957 (nach dem Buch von Reginald Rose) soll im Anschluss an ein Gerichtsverfahren eine Jury von zwölf, bis dahin einander unbekannten Menschen in einem abgeschlossenen Raum an einem heißen Sommertag einstimmig darüber entscheiden, ob ein 18-jähriger, lateinamerikanischer Junge aus den Slums seinen Vater mit einem Messer ermordet hat.
Zunächst scheint der Fall klar. Es kommt zu einer Abstimmung, in der allerdings ein Geschworener – gespielt von Henry Fonda – für »nicht schuldig« plädiert, weil er Zweifel darüber hat, ob die Indizienbeweise – u. a. die Tatwaffe und die Aussagen zweier Zeugen – ausreichen, um den Angeschuldigten auf den elektrischen Stuhl zu schicken. Ausgehend von diesem »Ausreißer« und »Störenfried« entspannen sich dann teilweise hitzige, aber auch erkenntnisreiche Diskussionen, in deren Verlauf sich andere Geschworene seiner Einschätzung anschließen.
Allmählich wird deutlich, dass es hier nicht nur um faktenbasierte Meinungsbildung geht, sondern auch um allgemeinere Fragen. Um den Mut, nein zu sagen, um die Frage, wie die Mehrheit mit einer Minderheitsmeinung umgeht und wie die Minderheit auf den Druck der Mehrheit reagiert. Daneben werden viele andere Aspekte, die jede Entscheidungssituation kennzeichnen, berührt:
• (Un-)höflicher Umgang und (in-)effiziente Kommunikation.
• (Un-)Fähigkeit anderen zuzuhören, andere aussprechen zu lassen und Kritik anzunehmen.
• Art der Entscheidungsbildung (z. B. nacheinander einzeln oder geschlossen abstimmend, anonym oder offen abstimmend).
• Individuelle Bereitschaft, sich allgemein einzubringen oder auch die Führungsrolle zu übernehmen.
• Art der wechselseitigen Beeinflussung und Druckausübung.
• Statuskämpfe (Alte gegen Junge, Intellektuelle gegen Arbeiter, Oberschicht gegen Unterschicht, Amerikaner gegen Einwanderer).
Letztlich werden tiefer liegende menschliche Eigenheiten zu Tage gefördert, denn in allen Meinungsäußerungen und Verhaltensweisen offenbaren sich darunterliegende persönliche Einstellungen, Vorurteile und Menschenbilder der Beteiligten, ihre grundsätzliche Beziehungsfähigkeit, ihr Selbstwertgefühl und die sich daraus ableitende Art der Selbstbehauptung.
Dieser Film kann daher als Lehrstück für gruppendynamische Prozesse in Entscheidungssituationen herangezogen werden und zeigt ganz nebenbei, dass die beste Menschenkenntnis derjenige erlangt, der über eine ausreichend ehrliche Selbsterkenntnis verfügt (eine vertiefende Erörterung liefern Ant/Nimmerfroh/Reinhard 2014; sie analysieren die einzelnen Filmszenen unter dem Blickwinkel effizienter Kommunikation).





























