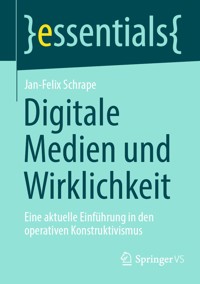8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Die kompakte und gut lesbare Einführung in die Techniksoziologie Von der Strom- und Wasserversorgung über Auto, Fahrrad und Bahn bis hin zu Internet, Smartphone und künstlicher Intelligenz: ein Leben ohne Technik ist nicht mehr vorstellbar. Dieser Band beleuchtet, welche Technikrevolutionen unserer modernen Alltagswelt den Weg bereitet haben, wie technischer und sozialer Wandel ineinandergreifen, welche neuen Möglichkeitsräume und Machtverhältnisse mit der digitalen Transformation entstehen, wie sich die Folgen technischer Innovationen abschätzen lassen und ob sich Technikentwicklung steuern lässt. Eine kurze und verständliche Einführung in die Techniksoziologie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jan-Felix Schrape
Technik und Gesellschaft
Eine kurze Einführung
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962501
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Coverabbildung: iStock / Alexander Sikov
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962501-0
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014676-7
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Einleitung
1 Technik und moderne Lebenswelt
Technik als integraler Bestandteil des Alltags
Vertrauen in funktionierende Technik
Soziale Einbettung von Technik
Verhältnis von Technik und Gesellschaft
2 Fundamentale Technikrevolutionen
Erste Werkzeuge
Agrikultur, Feuerbearbeitung, Städtebau
Schriftlichkeit, Standardisierung, Infrastruktur
Zugpferde, Räderuhren, Buchdruck
Maschinen, chemische Verfahren, Elektrizität
Biotechnologie, Nukleartechnik, Mikroelektronik
Koevolution von Technik und Gesellschaft
3 Digitale Transformation als Langfristprozess
Prämissen und Vorentwicklungen
Erfindung des Computers
Idee der Informationsgesellschaft
Computerisierung der Lebenswelt
Internet und World Wide Web
Web 2.0 und digitale Plattformen
Big Data und künstliche Intelligenz
Digitalisierung als soziotechnischer Prozess
4 Technische Innovation und sozialer Wandel
Von der Erfindung zur Innovation
Inkrementelle und radikale Innovationsprozesse
Gesellschaftliche Verbreitung von Innovationen
Nischen, soziotechnische Systeme und exogene Schocks
Technik und sozioökonomischer Wandel
5 Soziale Konstruktion von Technik
Das Fahrrad und Social Media im Web
Interpretative Flexibilität und Schließung
Verteilte Innovationsprozesse
Institutionalisierung neuer Technik
6 Informatisierung und Plattformisierung
Die Entzauberung der Welt
Das Smartphone und die Informatisierung des Alltags
Plattformisierung von Marktstrukturen
Plattformisierung der Medienkommunikation
Plattformisierung von Organisation und Arbeit
Plattformen als soziotechnische Wirkungszusammenhänge
7 Autonome Technik und künstliche Intelligenz
Situatives Mithandeln von Technik
Autonom operierende Systeme
Kurze Geschichte der künstlichen Intelligenz
Starke und schwache künstliche Intelligenz
Machen Maschinen uns arbeitslos?
8 Technik und gesellschaftliche Ordnung
Ermöglichung, Koordination und Kontrolle
Die Macht der Hersteller und die Macht der Nutzenden
Technik und gesellschaftliche Wirklichkeit
Regulierung und Technikpolitik
9 Technikfolgenabschätzung und Technikzukünfte
Herausforderungen der Technikfolgenabschätzung
Technikutopien und Technikdystopien
Management von Nicht-Wissen
Technikfolgenabschätzung und Techniksoziologie
Schluss: Technik, Fortschritt und Zerstörung
Literaturverzeichnis
Register
[7]Einleitung
Nicht erst seit dem Siegeszug von Internet, Smartphones und künstlicher Intelligenz lässt sich Technik als eine wesentliche Grundlage der modernen Gesellschaft beschreiben. Funktionierende Technik wird in der Regel als schlicht gegeben vorausgesetzt und in ihrer Entstehung und Wirkung nicht weiter hinterfragt. Das gilt für große Infrastruktursysteme wie die Wasser- und Energieversorgung, aber inzwischen auch für die digitalen Ökosysteme führender IT-Konzerne. Selbst wenn wir zeitweise auf die neuesten technischen Errungenschaften verzichten und »Digital Detox« betreiben, kommen wir nicht ohne Technik an sich aus: Sie ist fest in unsere Lebenswelt eingeschrieben. Das fehlerhafte Update einer Windows-Sicherheitssoftware etwa führte Mitte 2024 nicht nur zu weltweiten Computerausfällen, sondern auch zu erheblichen Störungen im Flug-, Bahn- und Zahlungsverkehr.
Dieses Buch bietet einen leicht verständlichen Einstieg in die Techniksoziologie, die sich mit der unauflösbaren Verflechtung von Technik und Gesellschaft beschäftigt. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen, die im Alltag oft aus dem Blick geraten: In welchen Bereichen wird das gesellschaftliche Zusammenleben konstitutiv durch Technik geprägt? Wie greifen technische und soziale Veränderungsdynamiken ineinander? Auf welchen Prämissen baut die fortschreitende digitale Transformation auf? Welche erweiterten Möglichkeitsräume werden dadurch eröffnet? Welche neuen Machtverhältnisse bilden sich heraus? Welche Potenziale und Risiken gehen mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens einher? Und: Lässt sich Technikentwicklung regulieren oder sogar steuern?
[8]In den nachfolgenden Kapiteln geht es insofern nicht um eine möglichst umfassende Rekapitulation aller kursierenden Theorien und Positionen, sondern um eine kompakte Einführung in zentrale Einsichten der sozialwissenschaftlichen Technikforschung, die in unserer stetig intensiver mit Informationstechnologien durchzogenen Gegenwart bedeutsamer denn je erscheinen.
[9]1 Technik und moderne Lebenswelt
Risikogesellschaft, Erlebnisgesellschaft, Organisationsgesellschaft, Wissensgesellschaft, Mediengesellschaft – die moderne Gesellschaft hat viele Gesichter, die in Zeitdiagnosen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden. Eines ist sie spätestens seit der Industrialisierung allerdings stets auch: eine Technikgesellschaft.
Nahezu alle gesellschaftlichen Austauschprozesse und wirtschaftlichen Aktivitäten setzen heute in elementarer Weise auf komplexen technischen Systemen auf, ohne dass ihre Nutzerinnen und Nutzer verstehen müssten, wie diese im Detail funktionieren. Ein »Zusammenbruch der Technik« würde, so hat es der Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann (1927–1998) bereits vor 30 Jahren ausgedrückt, »auch zu einem Zusammenbruch der uns vertrauten Gesellschaft« führen (Luhmann 1997: 532).
Anders gesagt: Wir sind in unserer Lebensweise in einem nie gekannten Maße von technischen Lösungen abhängig, und schon der anhaltende Ausfall einer Teilkomponente in diesem weit verzweigten Netzwerk an technischen Fundamenten der Gesellschaft könnte in einem Kollaps unserer als natürlich gegeben empfundenen Alltagswelt münden. Schon ein vorübergehender Zusammenbruch des Internets, zum Beispiel durch einen Krieg oder eine Katastrophe, würde nicht nur zu Beeinträchtigungen in der Kommunikation, sondern auch zu weitreichenden Unterbrechungen im Lebensmittel- und Warentransport, im Finanzwesen und in der Energieversorgung führen.
[10]Technik als integraler Bestandteil des Alltags
Unabhängig von individuellen Lebensstilen lassen sich technische Strukturen als integraler Bestandteil der alltäglichen Lebenswelt in entwickelten Ländern beschreiben: Nachdem Maschinen und automatisierte Systeme in der Landwirtschaft, der Güterproduktion und dem Transportwesen bereits im 19. Jahrhundert massiv an Relevanz gewonnen hatten, verbreiteten sich technische Geräte nach der flächendeckenden Elektrifizierung und der Wohlstandsexpansion im 20. Jahrhundert auch im privaten Bereich. 1973 verfügten in der Bundesrepublik Deutschland bereits 75 Prozent der Haushalte über einen Waschvollautomaten, 89 Prozent über ein Fernsehgerät und 51 Prozent über ein Kraftfahrzeug. Im Jahr 2022 waren nahezu alle Haushalte mit einem Kühlschrank, Flachbildfernseher, Personal Computer, Internetanschluss und Smartphone ausgestattet; knapp 80 Prozent waren im Besitz eines Automobils (Statistisches Bundesamt 2024).
Entsprechend selbstverständlich greifen wir heute in unserem Tagesablauf auf Technik zurück: Bevor wir die Kaffeemaschine in Betrieb setzen und die Marmelade aus dem Kühlschrank holen, erinnert uns ein elektronischer Wecker daran, zu einer bestimmten Zeit aufzustehen, um mit Bus und Bahn, Fahrrad oder Auto rechtzeitig zu unserer Arbeits- oder Bildungsstätte zu gelangen, sofern wir nicht einfach den Laptop auf dem heimischen Schreibtisch anwerfen können. Auf dem Weg dorthin halten wir uns mit dem Smartphone über Neuigkeiten auf dem Laufenden, tauschen uns mit Bekannten aus oder unterhalten uns mit Videoclips und Videospielen. Wenn wir nicht sicher sind, [11]wie das Wetter wird, konsultieren wir ein Wetterportal. Wenn Verkehrsbehinderungen auftreten, rufen wir einen Kartendienst mit Navigationsfunktion auf, um andere Wege zum Ziel zu finden. Und wenn wir uns nach getaner Arbeit einen ruhigen Abend zu Hause machen wollen, schalten wir den Wohnzimmerbildschirm an, um über Streamingdienste oder Fernsehprogramme eine Serie oder einen Film anzuschauen, nachdem wir auf dem Kochherd oder mit der Küchenmaschine das Abendessen zubereitet haben.
All diese Geräte und technikvermittelten Leistungen sind inzwischen aus der weithin unhinterfragten »Lebenswelt des Alltags« (Schütz & Luckmann 2017: 29) nicht mehr wegzudenken und prägen unsere Erfahrungshorizonte. Es mag in bestimmten Situationen romantisch oder abenteuerlich erscheinen, auf gewohnte technische Hilfsmittel zu verzichten – und beispielsweise im Campingurlaub über offenem Feuer zu kochen. Ebenso bleibt es auf vielen alltäglichen Handlungsfeldern möglich, zeitweise von der Nutzung moderner technischer Lösungen abzusehen – und auch längere Strecken zu Fuß zurückzulegen oder sich der ständigen Erreichbarkeit durch Instant Messaging, Telefon und E-Mail zu entziehen. Eine solche Technikabstinenz geht jedoch nicht nur mit erhöhten Organisationsanforderungen einher, sondern steht oft auch eingespielten gesellschaftlichen Erwartungen entgegen. Natürlich könnte ich dieses Buch statt auf einem Computer auch auf einer der ersten, ab 1874 hergestellten Schreibmaschinen verfassen oder als handschriftliches Manuskript beim Verlag einreichen. Das aber wäre nicht nur mit Mehraufwand verbunden, sondern entspräche auch nicht mehr den Konventionen und könnte einige Irritationen hervorrufen.
[12]Kurzum: Technische Hilfsmittel erleichtern das alltägliche und berufliche Handeln in vielfältiger Weise und werden daher in der Regel bereitwillig genutzt. Ein Verzicht bleibt zwar denkbar, ist aber mit einem hohen Kraft- und Zeitaufwand verbunden. Für die dahinterliegenden und im Alltag oft nicht mehr bewusst wahrgenommenen technischen Kerninfrastrukturen gilt das dagegen nicht mehr: Ohne eine verlässliche Wärme-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung, ohne stabile Kommunikationsstrukturen, ohne intakte Verkehrswege und Lieferketten, ohne industriell bereitgestellte Güter (z. B. Lebensmittel, Bekleidung, Baustoffe) wären wir kaum überlebensfähig. Ein dauerhafter Ausfall dieser kritischen Infrastrukturen wäre alles andere als romantisch oder abenteuerlich, sondern könnte rasch in einem Zerreißen des dünnen Firnis zivilisierten Zusammenlebens münden.
Technik ist in der heutigen Gesellschaft nicht nur allgegenwärtig; funktionierende Technik ist längst zu einer konstitutiven Grundlage der Alltagswelt geworden. Das wird immer dann offenkundig, wenn etwas nicht so funktioniert wie erwartet: Wenn sich keine Internetverbindung herstellen lässt, wenn das Auto nicht anspringt, wenn kein Strom aus der Steckdose kommt, wenn die Wasserversorgung gestört ist, wenn der Heizkörper nicht warm wird oder auch nur, wenn sich im Winter ein Fenster nicht richtig schließen lässt – dann wird ansatzweise spürbar, wie sehr der moderne Mensch auf intakte technische Lösungen angewiesen ist.
Mehr noch: Wir rechnen nicht nur mit funktionierender Technik, sondern wir richten uns – das hat der Technikphilosoph Lewis Mumford (1895–1990) früh [13]herausgearbeitet – auch in unserem Weltverständnis an technischen Funktionslogiken aus und vertrauen darauf, die meisten Herausforderungen durch den Einsatz geeigneter technischer Lösungen bewältigen zu können (Mumford 1934). Wir stellen uns die Welt natürlich nicht mehr als ein großes Uhrwerk vor, das von einem allmächtigen Schöpfer betrieben wird – ein Vergleich, der kurz nach der Verbreitung der ersten Räderuhren an Kirchtürmen im 14. Jahrhundert aufgekommen war. Aber auch unsere heutige Sicht auf die Wirklichkeit ist von technisch gefärbten Sinnbildern geprägt. Keineswegs zufällig erlangte zum Beispiel die Vorstellung der »Netzwerkgesellschaft« (Castells 1996) mit der Verbreitung des Internets ab den 1990er-Jahren schnell allgemeine Bekanntheit.
Vertrauen in funktionierende Technik
Ebenfalls nicht zufällig hat sich der Nationalökonom und Soziologe Max Weber (1864–1920) zeit seines Lebens mit der »Entzauberung der Welt« durch »technische Mittel und Berechnung« auseinandergesetzt, denn er konnte die Technisierung der alltäglichen Lebenswelt sozusagen in Echtzeit beobachten. Diese Lebenswelt war nun nicht mehr, wie in den Jahrhunderten davor, durch den Glauben an Magie und geheimnisvolle Mächte geprägt, sondern durch den Glauben, dass »man vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne« (Weber 1995: 19).
Das bedeutet laut Weber (1988: 465) allerdings nicht, dass das moderne Individuum ungleich mehr über die Welt und seine Lebensbedingungen wüsste als seine Vorfahren: [14]»Kein normaler Konsument weiß heute auch nur ungefähr um die Herstellungstechnik seiner Alltagsgebrauchsgüter, meist nicht einmal darum, aus welchen Stoffen und von welcher Industrie sie produziert werden. Ihn interessieren eben nur die für ihn praktisch wichtigen Erwartungen des Verhaltens dieser Artefakte«. Was ihn von früheren Generationen unterscheide, sei vielmehr »der generell eingelebte Glaube daran, daß die Bedingungen seines Alltagslebens […] prinzipiell rationalen Wesens, d. h. der rationalen Kenntnis, Schaffung und Kontrolle zugängliche menschliche Artefakte seien« (ebd.: 473 f.).
Technische Artefakte, also technische Geräte und Systeme, waren in diesem Sinne schon zu Webers Zeiten in vielen Bereichen zu Prämissen des alltäglichen Handelns geworden. Auf die ersten Eisenbahnreisenden (ab 1825) oder die Nutzerinnen und Nutzer der ersten Fahrstühle (ab 1857) – und später auch die User der ersten Smartphones (ab 2007) – übten die neuen technischen Möglichkeiten zweifellos eine große Faszination aus. Schon wenige Jahre danach aber waren diese Artefakte und das Vertrauen in ihr Funktionieren zu einem festen Teil der alltäglichen Lebenswelt geworden, in die nachkommende Generationen wie selbstverständlich hineinwachsen, ohne noch nachvollziehen zu müssen, welche Konstruktionsleistungen hinter den unmittelbar erfahrbaren Geräten und Systemen stehen.
Das Vertrauen des Einzelnen in funktionierende Technik beruht Max Weber (ebd.: 474) zufolge also nicht auf »Verständnis«, sondern auf »Einverständnis« bzw. sozial kristallisierten Funktionserwartungen. Werden diese Erwartungen beispielsweise durch einen bemerkenswerten [15]Unfall brüchig, kann das rasch das alltagspraktische Ende einer einst gefeierten technischen Errungenschaft bedeuten: Das Überschallflugzeug Concorde etwa galt trotz branchenbekannter Probleme als sicher genug, um ab 1976 jahrzehntelang für Linienflüge über den Atlantik eingesetzt zu werden. Nach dem Absturz einer vollbesetzten Concorde im Jahr 2000 blieben jedoch trotz technischer Verbesserungen die Passagiere aus und der Linienverkehr wurde 2003 eingestellt. Das öffentliche Vertrauen in die Sicherheit der Concorde war schlicht nicht mehr gegeben.
Vertrauen in funktionierende Technik und die dahinterstehenden Organisationsstrukturen ist mithin eine genuin soziale Angelegenheit. Die durchschnittlichen Konsumentinnen und Konsumenten in der digitalisierten Gesellschaft teilen zum Beispiel die Erwartung, dass der elektronische Zahlungsverkehr hinreichend sicher funktioniert und sich das mit dem entsprechenden Fachwissen auch nachprüfen ließe. Da dies aber im Alltag viel zu aufwändig wäre, vertraut der Einzelne auf eingespielte Praktiken, Experteneinschätzungen und kollektive Erfahrungswerte.
Vertrauen ist das wirksamste Mittel, um die Komplexität der modernen Lebenswelt zu reduzieren, ohne sie in all ihren Facetten selbst durchdenken zu müssen. Das wäre ja auch gar nicht mehr möglich. Ein unhinterfragtes Grundvertrauen besteht heute freilich immer weniger gegenüber sozialen Statusgruppen als gegenüber technischen Systemen und »zweckrational geschaffenen Ordnungen« (Weber 1988: 4). Vertrauen ist heutzutage vor allem »Systemvertrauen« (Luhmann 1997: 313). Schon allein deshalb sind Technik und Gesellschaft untrennbar ineinander verwoben.
[16]Soziale Einbettung von Technik
Diese enge Verflechtung von Technik und Gesellschaft tritt erneut hervor, wenn wir der Frage nachgehen, was mit dem Begriff Technik eigentlich genau gemeint ist: Einerseits bezeichnet »Technik« alle künstlich geschaffenen Geräte, Systeme und Infrastrukturen – von Lampen und Leuchten, Smartphones und Spielkonsolen über das Internet und das Stromnetz bis hin zu Virtual-Reality-Headsets und Anwendungen künstlicher Intelligenz. Andererseits werden damit aber auch festgefügte Koordinationsweisen (z. B. Organisationstechniken) sowie eingeübte Fertigkeiten und Methoden (z. B. Arbeitstechniken) benannt.
»Technologie« bezeichnete demgegenüber ursprünglich die Wissenschaft von der Technik. Da es diese Unterscheidung im Englischen jedoch so nie gab und Technik dort seit jeher mit »technology« übersetzt wurde, sind die beiden Begriffe im 20. Jahrhundert auch im deutschsprachigen Raum zu Synonymen geworden – und es ist von digitalen Technologien oder Technologietrends die Rede. Der Soziologe und Anthropologe Heinrich Popitz (1925–2002) hat in dieser Hinsicht eine hilfreiche Abgrenzung eingeführt: Unter »Technik« versteht er alle technischen Maschinen und Systeme. Als »Technologie« bezeichnet er dagegen die »gesamte Logik des Produzierens«, von der »Produktionsidee« über die Methoden und Verfahren des Herstellens bis hin zum konkreten Produkt (Popitz 1995: 13). Für ihn sind technische Artefakte folglich in allen Phasen ihrer Entwicklung immer schon eingebettet in soziale Prozesskontexte.
Die neuere Techniksoziologie greift diese Einsicht auf und streicht dabei noch einmal expliziter das konstitutive [17]Zusammenspiel von sozialen und technischen Prozessen nicht nur in der Entwicklung und Herstellung, sondern auch in der Nutzung und Verwendung von Technik heraus (Rammert 2016): Bereits das Verfassen eines einfachen Textes auf einem Personal Computer oder Smartphone fußt neben dem reibungslosen Zusammenspiel aller Hardware- und Softwarekomponenten auf einer Vielzahl kollektiver Wissensbestände und eingeübter Handlungsroutinen wie etwa dem Schreiben auf einer Tastatur oder einem Touchscreen.
Sachtechnik
(Hardware)
Materielle Artefakte, Systeme und Infrastrukturen
Symboltechnik
(Software)
Regelbasierte Zeichensysteme und Verfahren zur Informationsverarbeitung
Handlungstechnik
(Routinen)
Eingeübte Bewegungen, schematisierte Problemlösungsprozesse
Quelle: Eigene Zusammenstellung (nach Rammert 2016)
Die alltäglichen Artefakte, Strukturen und Systeme, die wir »Technik« oder »Technologie« nennen, sind insofern genauer besehen stets soziotechnische Wirkungszusammenhänge, die auf einer Kombination von sach-, symbol- und handlungstechnischen Prozessen gründen (Tab. 1). Als Sachtechnik bezeichnet die Techniksoziologie dabei materielle Artefakte, die bewusst konstruiert werden, um wiederholbare Wirkungen zu erzielen – vom Hammer bis zum Mikroprozessor. Unter Symboltechnik werden regelbasierte Zeichensysteme und Verfahren der Datenverarbeitung [18]zusammengefasst. Handlungstechnik umfasst eingeübte Arbeitsroutinen, schematisierte Bewegungsabläufe und Problemlösungen, die fixierten Mustern folgen.
Ausgehend von den grundlegenden Überlegungen des Ingenieurs und Technikphilosophen Günter Ropohl (1939–2017) lassen sich diese Einsichten zur unauflösbaren Verwobenheit von sozialen und technischen Abläufen zu einem Prozessmodell soziotechnischer Wirkungszusammenhänge verdichten, das sich wiederum aus mehreren ineinander verschränkten Prozesskontexten zusammensetzt (Ropohl 1979; Weyer 2008; Schrape 2021).
Quelle: Schrape 2021 (vereinfacht)
Im Zentrum dieses Modells steht ein fest gekoppeltes soziotechnisches Kernsystem aus Hardware, Software und [19]Routinen, das im Normalfall nicht mehr durch bewusste Entscheidungen unterbrochen wird (Abb. 1). Der Begriff Hardware fasst die klassische Sachtechnik zusammen, also künstlich hergestellte Artefakte wie Werkzeuge oder Maschinen, die für ein bestimmtes Problem eine verlässliche Lösung bieten. Sobald mehrere Hardware-Elemente ineinanderwirken, wird eine regelbasierte Steuerung über Symbolsysteme notwendig. Diese Software bestimmt, wie die einzelnen Komponenten komplexer Hardwaresysteme (z. B. Computer, Smartphones) interagieren und wann welche Operationen ausgeführt werden. Sämtliche Soft- und Hardwaresysteme sind zudem mit eingeübten Handlungsroutinen verknüpft, also erlernten Arbeitsabläufen oder Bedienungsweisen (z. B. bei der Verwendung eines Touchscreens).
Solche soziotechnischen Kernsysteme sind stets in umfassendere sozioökonomische Prozesskontexte eingebettet: In ihrer Entwicklung und Herstellung wirken spezifische Organisations- und Arbeitsweisen, Markt-, Konkurrenz- und Kooperationsmuster, rechtliche Rahmenbedingungen und eingespielte Lösungsstrategien eng ineinander. Ebenso wird ihre Verwendung und Nutzung durch unterschiedliche individuelle, kollektive und organisationale Aneignungsdynamiken in verschiedenen sozialen Milieus und Weltregionen geprägt, die von den vorherrschenden gesellschaftlichen Erwartungen mitbestimmt werden. Erst im Zusammenspiel all dieser Prozesskontexte ergeben sich mehr oder weniger weitreichende neue soziotechnische Wirkungszusammenhänge, die mitunter die etablierten Ordnungsmuster auf den Kopf stellen. Technik überkommt die Gesellschaft also nicht einfach als disruptive[20]Kraft, die den weiteren Verlauf unaufhaltsam determiniert. Sie ist in ihrer Entwicklung und Anwendung vielmehr in facettenreiche sozioökonomische Kontexte eingelassen, die ihrerseits auf die Technikentwicklung zurückwirken.
Angesichts dieser Gemengelage lässt sich der Verlauf technikzentrierter Innovationsprozesse kaum vorhersagen, so groß der Bedarf für solche Prognosen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auch sein mag: Dass sich das Internet ab den 1990er-Jahren derart rasant durchsetzen würde, konnte sich anfänglich kaum jemand vorstellen. Ähnliches gilt für den Siegeszug des massentauglichen Smartphones, der zur Markteinführung des Apple iPhone im Jahr 2007 noch keineswegs als ausgemacht galt. Das Unternehmen Nokia beispielsweise rechnete zunächst überhaupt nicht damit, dass diese neue, hochpreisige Produktkategorie seiner damaligen Marktführerschaft auf dem Feld der Mobiltelefone gefährlich werden könnte.
Verhältnis von Technik und Gesellschaft
Technische und soziale Prozesse wirken von der Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Anwendung integral ineinander und können nicht abgelöst voneinander betrachtet werden. Das tritt im Anfangsstadium soziotechnischer Umbrüche durchaus auch in das allgemeine Bewusstsein – etwa wenn neue technische Lösungen noch nicht zuverlässig funktionieren, wenn noch unklar ist, für welche Einsatzbereiche sie auf Dauer geeignet sind oder wenn sich die Gesellschaft noch nicht an sie gewöhnt hat.
Wenn sich eine Technik aber erst einmal durchgesetzt [21]hat und ihr Gebrauch zu einer alltäglichen Gewohnheit geworden ist, wird sie sozusagen zur »zweiten Natur« und in ihren Entstehungs- und Funktionsbedingungen, vor allem aber in ihrer handlungsleitenden Kraft kaum mehr hinterfragt. Die Heizung und das elektrische Licht, das Automobil und der öffentliche Personenverkehr oder das Internet und das Smartphone sind mittlerweile zu ebenso selbstverständlichen Bestandteilen der Lebenswelt geworden wie die natürliche Umwelt, die heute in vielen Belangen ebenfalls technisch überformt ist. Die Soziologie setzt sich angesichts ihrer Grundfrage (»Wie ist soziale Ordnung möglich?«) demgegenüber seit jeher explizit mit dem Verhältnis von Technik und Gesellschaft auseinander und analysiert, wie es zu diesem scheinbar selbstverständlichen Ineinandergreifen kommt. In der neueren Techniksoziologie herrschen in dieser Hinsicht drei Betrachtungsweisen vor, die Technik entweder als gesellschaftsformatierende Infrastruktur, als handlungsprägende Institution oder als mithandelnden Akteur beschreiben.
Vorstellungen von Technik als Infrastruktur konzentrieren sich auf große Infrastruktursysteme, die heute die individuellen und gesellschaftlichen Handlungshorizonte grundlegend mitbestimmen (Hughes 2004; Mayntz 1993). Ohne ausgebaute Kommunikations- und Mobilitätsstrukturen zum Beispiel wären viele Formen des modernen Zusammenlebens gar nicht möglich. Auch solche Infrastruktursysteme werden nicht als bloße Konglomerate aus technischen Strukturen verstanden, sondern als komplexe soziotechnische Wirkungszusammenhänge, in denen unzählige technische, ökonomische, rechtliche und politische Prozesse ineinander verwoben sind. Mit der Etablierung [22]neuartiger Infrastruktursysteme (z. B. Eisenbahn, Stromnetz, Internet) haben sich die gesellschaftlichen Möglichkeitsräume seit der Industriellen Revolution erheblich ausgeweitet. Zugleich sind damit aber auch neue Abhängigkeitsverhältnisse entstanden, mit denen sich seit Karl Marx (1818–1883) und Jane Addams (1860–1935) zahlreiche kritische Sozialforschende auseinandergesetzt haben.
Fassungen von Technik als Institution fokussieren dagegen auf die handlungsleitenden Wirkungen technischer Artefakte und Systeme. Als Institutionen bezeichnete Émile Durkheim (1858–1917) sozial kristallisierte Regelungsstrukturen, die einen »äußeren Zwang« auf Individuen ausüben können (Durkheim 1995: 114), darunter Verkehrsregeln, das Bildungssystem, die allgemeine Wirtschaftsordnung – und Technik: Ähnlich wie soziale Regeln, Normen und Erwartungen bestimmen die Eigenheiten technischer Systeme die Spielregeln in ihren Anwendungsbereichen mit und bieten spezifische Anreizstrukturen. Die Anfang des 20. Jahrhunderts in Fabriken eingeführten Fließbänder etwa veränderten nicht nur den Arbeitsrhythmus, sondern die dortigen Organisationsmuster insgesamt. Ebenso legen Internetplattformen wie TikTok oder Instagram durch ihre Grundanlagen und in die Technik eingeschriebene Setzungen (z. B. Minuten- oder Zeichenlimits) bestimmte Kommunikationsweisen nahe, während sie andere deutlich erschweren (Dolata & Werle 2007; Dolata & Schrape 2023).
Beschreibungen von Technik als Akteur schließlich charakterisieren technische Geräte und Systeme als mehr oder minder eigenständige Handlungsträger, die soziale Situationen mitgestalten. Der Philosoph und Soziologe Bruno [23]Latour (1947–2022) vertrat die Überzeugung, dass menschliche und technische Akteure heute in vielerlei Hinsicht symmetrisch zusammenhandeln (Latour 2007) und Sozialfiguren wie »der Soldat« oder »die Influencerin« erst durch die Kombination von Mensch und Technik zustande kommen (z. B. Mensch und Waffe; Mensch, Smartphone und Internetplattform). Pragmatischere Ansätze gehen von einem situativen Mithandeln von Technik oder von »hybriden Konstellationen« aus, in denen »Menschen und autonome Technik