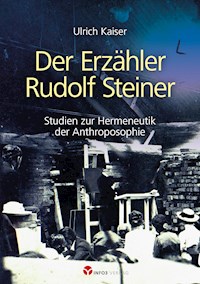8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kosmos
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Golf ist anders – und Golfer sind es auch! Sind Golfer gewalttätig, weil sie eine Lady schlagen? Und warum wollen alle Golfer weniger Brutto? Die Kurzgeschichten von Autor Ulrich Kaiser sind ein amüsanter Lesespaß für alle Jäger nach dem weißen Ball und geben selbst Nicht-Golfern einen guten Einblick in die skurrile Welt der Golfer. Jeder, der Golf gern von der heiteren Seite sieht, wird hier brillant unterhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Statt dessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
Hauptteil
1 › Golf ist anders
Ortega y Gasset hat gemeint, Golf ist anders.
Das ist eine ebenso eindeutige wie nichtssagende Äußerung, was bei Philosophen so selten auch wieder nicht vorkommt. Der Spanier hat uns nämlich keinesfalls verraten, anders als was?
Natürlich ist Golf anders als Fußball, weil einem dabei keiner gegen das Schienbein tritt. Es ist auch anders als Tennis, weil der Ball ruhig daliegt und wartet, geprügelt zu werden. Golf ist das einfachste Spiel der Welt, wenn man den Wind, die Sonne, den Regen, die Graslänge, die Hanglagen, die Karpfenteiche, die Sandlöcher, die Kreuzschmerzen, das Ziehen in der Schulter und die völlig unzulänglichen Schläger zu beherrschen oder zu vermeiden versteht. Golf ist außerdem ein trügerisches Spiel, weil kein normalsterblicher Spieler es so kann, wie es immer im Fernsehen dargestellt wird; hier schlagen sie und wandeln anschließend zum weithin sichtbaren Ball, um wieder zu schlagen. Der normalsterbliche Spieler verbringt mindestens die Hälfte seiner Zeit beim Suchen seines Balles in hüfthohen Brennnesseln oder sumpfigen Feuchtbiotopen.
Wenn Golf – laut Ortega – tatsächlich anders sein sollte, als andere Sportarten, dann höchstens aus dem Grunde, dass Golfspieler ständig verreist sind. Golfer sammeln Golfplätze wie andere Leute vielleicht Briefmarken. Das hat sogar eine ziemlich plausible Erklärung: Ein Tennisplatz hat überall auf der Welt die gleichen Maße – so wie der Hundertmeterlauf bei den Olympischen Spielen immer gerade hundert Meter lang ist. Aber es gibt keinen Golfplatz, der so aussieht wie der andere. Um noch einmal den spanischen Philosophen zu strapazieren: Ortega lässt einen englischen Admiral (wen sonst?!) einmal näseln, dass er es als sehr angenehm empfände, dass man Madrid so dicht an die Golfplätze gebaut habe. Das ist ein Beispiel für Golf-Logik.
Die Reiselust der Golfspieler ist keineswegs mit einer gewissen Abenteuerlust zu verwechseln. Egal, ob es sich um die schottischen Dünen handelt, die ondulierten Grüns in Florida, die mitten in die Wüste gelegten Wiesen in Dubai, jenen seltsamen Country Club in Moskau oder all das, was man in den letzten Jahrzehnten an der spanischen Costa del Sol an Löchern in den Böden gebohrt hat: Man kann auch in den entlegenen Golfwinkeln der Erde immer damit rechnen, den ewig gleichen Zeremonien und Realitäten zu begegnen. Es steht dort immer ein Clubhaus mit einem Büro, in dem man seine Gebühr, das Greenfee, zu entrichten hat, es gibt den immer gleichen Hinweis, wo sich der erste Abschlag (Tee) befindet, es gibt den immer gleichen Frust und die immer gleiche Freude auf den 18 Löchern während der nächsten knapp vier Stunden, es gibt schließlich überall ein mehr oder weniger gutes Restaurant, in dem je nach Landschaft entweder schreckliche Sandwiches oder auch sehr gute Gerichte serviert werden. Die Qualität dieser Nahrungsmittel spielt im Grunde genommen keine allzu große Rolle, weil ein müder und hungriger Golfspieler alles isst, was ihm vorgesetzt wird. Oder zumindest fast alles.
Das Clubhaus, das Restaurant, die Bar, manchmal auch das Hotel; das alles fassen die Golfspieler unter dem Begriff des »19. Lochs« zusammen. Hier geschehen mitunter wahre Wunder: Es kann passieren, dass beispielsweise einer, der die schlechteste Runde des Jahres gespielt hat, nach zwei Stunden schon gewisse positive Perspektiven in seinem Unglück zu erkennen vermag, nach drei Stunden sind die Doppelbogeys bereits zu einem Par geschrumpft, nach vier Stunden klingt die Erzählung bereits so, als habe er gerade die »Open« gewonnen. Das kann natürlich auch an der Qualität der verzehrten Erfrischungsgetränke liegen – es ist aber auch nicht auszuschließen, dass Golfspieler über eine besonders hoch entwickelte Phantasie verfügen.
Das kommunikationsfördernde Phänomen am 19. Loch des Clubhauses besteht darin, dass mindestens 100 Menschen zur gleichen Zeit ihre Erlebnisse kundtun und dass man tatsächlich jemanden findet, der auch noch zuhört, obgleich dieser Zuhörer offensichtlich nur wartet, bis der Erzähler einmal Luft holen muss, um dann sofort mit seiner eigenen Geschichte zu beginnen. Golfspieler lernen auf diese Weise sehr viele fremde Menschen kennen, was beispielsweise Boxern oder Tischtennisspielern weniger oft widerfährt. Vielleicht hat Ortega das gemeint, als er sagte, Golf sei anders.
Es muss hier unbedingt von der Kommunikationsfreudigkeit gesprochen werden, die sicherlich ein starkes Merkmal aller Golfspieler ist. Es wird dabei keineswegs von der letzten Scheidung oder der vorletzten Firmenpleite gesprochen, die leider eintraten, weil der Gatte oder der Chef es vorzogen, ihre gesamte Aufmerksamkeit diesem Spiel zu widmen – man redet einzig und allein vom Golf. Man tut das auch über Runden, die Jahre zurückliegen – es soll vorkommen, dass es Menschen gibt, die unglaublich spannend berichten, wie sie im September 1963 in Portugal am fünften Loch bei starkem Gegenwind mit einem wagemutigen 8-Meter-Putt ein Birdie erzielten.
Der Vorteil der vielen Reisen der Golfspieler liegt sicherlich darin, dass es ihnen kaum einmal langweilig wird. Es kann zwar passieren, dass jemand von seinem 18-Loch-Ausflug zurückkehrt und einen heiligen Eid schwört, nie wieder Golf zu spielen, und seine Schläger tatsächlich in den nächsten Teich wirft; es handelt sich immer um einen Meineid mit der Folge eines Tauchversuchs, um die Tasche mit den 14 unhandlichen Prügeln wieder aus dem Gewässer zu retten. Am nächsten Tag kann man solche Menschen vor Tau und Tag auf der Übungswiese stehen sehen, wo sie versuchen, ihren Slice loszuwerden. Der Nachteil, den die Golfreisenden auf sich nehmen müssen, besteht darin, dass sie neben ihrem normalen Koffergepäck auch noch den Schlägersack schleppen müssen. Wenn man davon ausgeht, dass es Spieler gibt, die am liebsten ihre Schläger mit ins Bett nehmen, ist die Trennung am Flughafenschalter für Sperrgepäck bis zu jenem Moment, in dem der Sack am Ziel wieder auf dem Gepäckband auftaucht, fast so schwerwiegend wie die Trennung von einem Kind. Bis vor kurzem haben fast alle Fluglinien diese Liebe honoriert, indem sie für den Transport keine Extragebühr verlangten – das hat sich fast überall verändert. Vielleicht liegt es daran, dass die Golfspieler dazu neigten, den Schlägersack bei der Heimreise mit schmutziger Wäsche und ungeputzten Schuhen vollzustopfen – ist nicht sicher, könnte aber sein.
Ob das alles ausreicht, um die Ortega-Aussage zu beantworten, ist die Frage. Warum ist Golf anders? Das Spiel beruht auf dem Prinzip der Hoffnung. Es ist nämlich so, dass jedem Golfer hin und wieder ein Schlag unterläuft, den auch der Weltmeister nicht besser zu bewerkstelligen vermag. Und nun gibt er sich der Hoffnung hin, diesen Schlag wiederholen zu können. Die Hoffnung auf diese Wiederholbarkeit ist trügerisch und so leichtfertig, als würde man im Hinblick auf die Finanzierung eines Lottoscheins einen Bankkredit aufnehmen.
Selbst die größten Meister dieses Spiels haben zugegeben, dass höchstens zehn oder zwölf Prozent der Schläge so gelingen, dass sie zur vollen Zufriedenheit anregen – bei den ewigen Lehrlingen sind es demnach zwei oder drei Prozent. Aber die Hoffnung ist unzerstörbar. Ähnliche Gefühle lassen sich übrigens in der entsprechenden Literatur nachlesen – beispielsweise bei Dostojewski (»Der Spieler«).
Was man nicht außer Acht lassen darf: Im Golf gibt es Witze. Das ist erwähnenswert, weil Sport in der Regel witzlos ist. Es gibt keine Witze übers Boxen, Radfahren, Turnen oder Schwimmen – es sei denn, sie sind aus anderen Gebieten des Witzes übernommen und umgedichtet. Die internationale Witzforschung, die angeblich durchaus eine ernstzunehmende Wissenschaft ist, kennt Witze aus Politik, Familie, Krankheit, Rasse, Kirche. Niemand erzählt so schöne jüdische Witze wie der jüdische Freund. Über das Golfspiel gibt es ebenfalls schöne Witze. Im Englischen kann man dicke Bücher mit Golfwitzen kaufen, die von der Sucht handeln, makaber sind, witzig sind, kaum Zoten.
Absurd ist der Witz, der zu den bärtigen Oldtimern gehört. Er geht so: Da unterbricht ein Mann auf dem 18. Grün die Vorbereitungen zu seinem voraussichtlich letzten Putt, weil auf der nahen Straße ein Trauerzug vorbeizieht; er verharrt in stiller Andacht, bis die Trauergesellschaft verschwunden ist. Sein Mitspieler spendet ob dieser Pietät höchste Bewunderung und staunendes Lob. Der Mann meint darauf: »Das war ich ihr schuldig – schließlich waren wir vierzig Jahre verheiratet!«
Natürlich behauptet jeder Golfspieler, dass er sofort damit aufhören könne, dass sein Familienleben intakt sei, dass er seinem Beruf ordentlich nachgehe. Aber selbst diese Aussagen haben eine verzweifelte Ähnlichkeit mit jenen, die man von Leuten erhält, die irgendeiner Sucht verfallen sind – und sei es nur die Zigarette nach dem Essen. Da es sich aber bei jeder Sucht um eine eher ernsthafte Angelegenheit handelt, wäre hier der Unterschied zu anderen sportlichen Zeitvertreiben am leichtesten zu beweisen: Golf ist eine verdammt ernste Angelegenheit, nicht um Leben oder Tod, sondern wichtiger. Diese Auffassung ist für Außenstehende nicht besonders logisch und auch nur schwer begreiflich zu machen, aber Nichtgolfer sind für Golfer sowieso kaum die richtigen Gesprächspartner. Man könnte Ortega y Gasset insofern leicht ergänzen: Golf ist anders, klar – aber Golfspieler sind es auch.
2 › Was es mit diesem Spiel auf sich hat
Mit dem Golf hat es Folgendes auf sich: Es gilt, einen viel zu kleinen Ball mit einem äußerst unhandlichen Gerät mit möglichst wenig Schlägen in ein viel zu kleines Loch zu befördern, welches sich mehrere 100 Meter weit entfernt befindet.
Es gibt kein anderes Spiel, das so trügerisch wäre wie Golf. Im Fernsehen zeigen sie erwachsene Männer und mitunter auch Frauen in ziviler Freizeitkleidung, wie sie über grüne Wiesen schreiten und auf die Kugel klopfen, die zumindest ungefähr dort hinfliegt, wo sie sie hinhaben wollen. Aus diesem Bild schließt der Zuschauer, dass es das Einfachste der Welt ist, und da simples Spazierengehen langweilig werden kann, entscheidet er sich, Golf zu spielen. Dem Menschen, der diese Entscheidung fällt, ist zu prophezeihen, dass er in absehbarer Zeit Beruf und Familie vernachlässigen wird, dass ihn Politik und Finanzen nur noch peripher interessieren werden, kurz: Er ist verloren.
Das Schlimme am Golf liegt bei diesem gut 45 Gramm schweren Ball: Ein Tennis- oder Fußball fliegt, vom Mit- oder Gegenspieler, bewegt in die eine oder andere Richtung, was wiederum die eigene Reaktion zur Folge hat. Ein Golfball liegt nur da und benötigt keine Reaktion. Er verhupft nicht wie beim Tennis und er fliegt nicht vorbei wie beim Fußball, sondern glotzt wie ein Wiesenchampignon. Vor der Bewegung eines Golfballs durch das erwähnte unhandliche Gerät hat der Mensch unendlich viel Zeit, sich Gedanken über die Art des Schlages zu machen, er vermag über den Wind nachzudenken, über die Höhe des Grases und über die Entfernung zum Ziel. Wenn der Mensch dann endlich einen Entschluss gefasst hat, der so endgültig ist wie die Betätigung des Abzughahns beim Scheibenschiessen, stellt sich heraus, dass ein Golfball ein erstaunliches Eigenleben entwickelt. Es kann sein, dass er trotz heftigem Schlag einfach liegen bleibt oder nur zwei Meter weit rollt oder sich tatsächlich zu majestätischem Flug erhebt, um dann allerdings seine Reise in sumpfigen Biotopen, dschungelartigem Unterholz, hüfthohen Brennnesseln, forellenführenden Gewässern oder sandgefüllten Tälern zu beenden. Dass auch die besten Golflehrer nie eine rationale Erklärung für dieses unkontrollierte Flugverhalten geben können, bestätigt nur die Feststellung des Eigenlebens. Ernsthafte Psychologen glauben erkannt zu haben, dass der Mensch zu viel denkt beim Golf, woraus man schlussfolgern müsste, dass das Denken schädlich ist beim Golfspiel.
Die weit verbreitete Annahme, dass es beim Golf besonders fein zugeht, kann aus den vorstehenden Gründen hier nicht bestätigt werden. Im Gegenteil: Das Eigenleben des Balles und seiner unbequemen Landezonen weckt nicht selten niedere Instinkte und ruft drastische Reaktionen hervor. Die groben Wörter auf Golfplätzen zeugen durchaus von erheblichem Einfallsreichtum. Auf manchen Golfkursen befinden sich Teiche, deren Wasserspiegel im Laufe der Zeit dramatisch angestiegen sind, weil dort Unmengen an Schlägern wutentbrannt hineingeschleudert wurden. Bestenfalls bietet der frustrierte Golfmensch sein Gerät sofort nach dem Spiel zum Verkauf an – es handelt sich dann immer um ein besonders günstiges Angebot. Es zeugt allerdings von einer gewissen Gestörtheit, dass der Verkäufer sich gleich am nächsten Tag eine neue Ausrüstung zu einem Preis zulegt, für den man bequem einen gebrauchten Wagen der Mittelklasse kaufen könnte.
Vorstehendes ist als Warnung für alle jene Menschen zu betrachten, die die Absicht hegen, ihren gesamten Lebensablauf durch das Golfspiel zu verändern. Unverständlicherweise gibt es auch Typen, die das für einen wunderschönen Zeitvertreib halten.
3 › Slice
Das Wichtigste an diesem Spiel ist der Slice. Das ist leicht zu beweisen: Wovon handelt jedes zweite Golflehrbuch, welches Thema wird von jeder Fachzeitschrift regelmäßig behandelt, wovon spricht die Mehrzahl der Spieler? Richtig! Das Slice-Thema ist unglaublich populär.
Natürlich will keiner einen Slice haben, oder die, die ihn haben, möchten ihn loswerden; aber das ändert nichts an seinem Vorhandensein. Schließlich will auch keiner das Ozonloch, die Rezession, die Krise und den Rinderwahnsinn. Aber es wird laufend darüber geredet. Natürlich habe ich auch einen Slice. An glücklichen Tagen ist es nur ein Fade, aber meistens ist es ein primitiver Slice: fünfzig Meter geradeaus und dann im rechten Winkel rechts in die Wildnis.
Selbstverständlich ist es kinderleicht, einen Slice zu kurieren, sagt der Pro. Er sagt: »Das werden wir gleich haben!« Ich sage gar nichts, weil ich genau weiß, dass es mit den Grundsätzen zusammenhängt, die ich für mich etwas individuell interpretiere. Der Pro will meine Lebenseinstellung ändern. Er sagt: »Am besten ist es, wenn Sie alles vergessen, was Sie bisher gemacht haben, und noch einmal von vorn beginnen. Dann dauert es höchstens zwei Jahre und sie schlagen weit und geradeaus!« Ich will aber keine zwei Jahre warten, sondern übermorgen bei dem Turnier mitspielen.
Es kann auch sein, dass der Pro eine Blitz-Kur vornimmt: Dann sortiert er die Finger um den Griff, stellt die Füße ein bisschen anders, richtet die Schulter aus, fixiert meinen Schädel und rät, unbedingt den linken Arm gerade zu halten. Es ist kinderleicht; der Ball fliegt schnurgerade und verschwindet im Morgendunst.
Der Pro sagt: »Diesen Bewegungsablauf müssen Sie sich einprägen!« Ich schlage erneut – die Flugbahn verläuft sanft ansteigend und gerade. Der Pro sagt: »Und gleich noch einmal!« Ich schlage wieder, und wieder, und wieder, einen Eimer voller Bälle, alle geradeaus. Der Slice ist weg für alle Zeiten.
Mit diesem Hochgefühl gehe ich an den ersten Abschlag. Der Ball steigt fünfzig Meter, dann bricht er abrupt nach rechts ins Dickicht. Deshalb ist der Slice solch ein wichtiges Thema.
4 › Gene Sarazen – ein Schlag, der das Masters machte
Wenn man so will, hatte Eugenio Saraceni seine Golfkarriere einer Lungenentzündung zu verdanken. Da war er 15 Jahre alt, die Eltern bestellten den Geistlichen, der ihn mit den letzten Sakramenten versah. Stille im Haus, Tränen. Aber irgendwie war das kleine Kerlchen wohl doch zäher, als der Arzt annahm: er kam durch. Und weil die Heilkundigen oft glauben, frische Luft sei ein ganz besonders wirksames Mittel, verschrieb man ihm viel Bewegung im Freien. Mutter Adela hätte dem Wiederauferstandenen sowieso alles gestattet. Vater Federico hatte zum ersten Mal nichts dagegen, dass der Junge sich auf dem Golfplatz herumtrieb.
Federico Saraceni war aus Sizilien eingewandert und ließ sich in einem Ort namens Harrison im US-Staat New York nieder. Er war Zimmermann und mit der englischen Sprache hatte er bis zum Tod seine Schwierigkeiten. Er hätte es gerne gesehen, wenn sein Sohn ebenfalls den Zimmermannsberuf gelernt hätte, aber der hegte andere Vorstellungen von seinem Leben. Er verkaufte Zeitungen, sammelte Altmetall, zündete die Gaslaternen an, arbeitete als Obstpflücker und trug den Golfspielern die Tasche. Selbstverständlich versuchte er es selber. Viele Golferkarrieren jener Jahre begannen auf diese Weise. Obgleich er die wenigen Dollars, die man ihm gab, alle brav zu Hause ablieferte, betrachtete der Vater die Tätigkeiten seines schmächtigen Sprösslings mit einigem Misstrauen. Er zwang den Jungen in seinen Beruf, aber bevor der noch lernte, einen Nagel gerade durch den Balken zu schlagen, geschah die Sache mit der Lungenentzündung.
Den ersten Job im Golfclub erhielt Eugenio Saraceni, als er siebzehn Jahre alt war. Für acht Dollar die Woche machte er den Proshop sauber, putzte Schläger und Schuhe. Zwei Jahre später, es war 1919, zog er nach Florida, begleitet von den Tränen der Mama und den unwillig hervorgebrachten Wünschen des Herrn Papa. Er nahm an einigen Turnieren teil und gewann sogar ein bisschen Geld. 1921 beschloss er, seinen Namen zu ändern – er hieß nun Gene Sarazen. Er meinte, der alte Name würde eher zu einem Geigenspieler als zu einem Golf-Professional passen. Gene Sarazen arbeitete eine Weile im Fort Wayne Country Club im Staat Indiana, dann in Pittsburgh/Pennsylvania. 1922 gewann er die Southern Open, das erste etwas größere Turnier. Niemand nahm von ihm besonders Notiz, als er in Skokie/Illinois eintraf, wo die US Open stattfanden. Er spielte mittelmäßige Runden von 72, 73 und 75 Schlägen. Vor dem Finale lag er vier Schläge hinter der Spitze, zu der immerhin Walter Hagen und Bobby Jones gehörten. Am Abend hatte er die letzte Runde in 68 Schlägen gespielt und war US Open-Sieger; er war gerade zwanzig Jahre alt. Einige Wochen später holte er sich auch noch die US PGA Championship. Gene Sarazen war auf einmal berühmt.
Sarazen hatte bis dahin nie eine Lehrstunde gehabt. Er spielte so, wie er es für richtig hielt und wie es für ihn wohl auch richtig war. Vor allem sein Griff am Schläger bereitete den Golflehrern jener Jahre Schmerzen: Er umklammerte den Schläger mit einem sehr individuellen »interlocking grip«: den linken Daumen legte er dabei über das Handgelenk der Rechten. Mit einem orthodoxen Schwung könnte kein Mensch auf diese Weise einen geraden Ball schlagen, aber an Gene Sarazens Schwung gab es wenig Orthodoxes zu sehen. Wenn ihn die stilvollen Schwung-Fetischisten allerdings darauf aufmerksam machten, hatte er das beste Argument aller Erfolgreichen bei der Hand: »Gezählt wird, wer den Ball mit den wenigsten Schlägen ins Loch bringt – sonst nichts!«
Aber er war ja immer noch ein sehr junger Mann, und irgendwann haben ihn die kritischen Kollegen wohl auch genervt. Kurz: Sarazen beschloss, die klassischen Lehren des Spiels zu erlernen und zu beherzigen. Das Ergebnis dieser Umstellung war fürchterlich. Alles das, was bisher praktisch von alleine so flüssig von seinem Schläger geflogen war, wurde nun verkrampft, eckig, unkontrolliert. Der klassische Griff, den er nun anwendete, brachte nie eine harmonische Verbindung zu seinem Werkzeug zustande. Die flache Flugbahn seiner Bälle, die ihm zuvor Distanz und Präzision bescherte, war nun höher geworden, aber er verlor an Länge. Er packte Gewicht an seinen Driver, was das Problem auch nicht löste – Gene Sarazen gewann in drei Jahren nur ein Turnier. Er reiste zu den British Open, wo er nach einer Runde mit 85 Schlägen nicht einmal die damals notwendige Qualifikation schaffte, beim nächsten Mal durfte er zwar teilnehmen, aber sein Ergebnis mit 83, 75, 84 und 81 Schlägen reichte natürlich nicht aus, irgendeine Rolle zu spielen. Das Einzige, was die Nachwelt dieser schlimmen Zeit der Karriere des Gene Sarazen zu verdanken hatte, war ein Vorläufer des heute gebräuchlichen Sandwedges: Man spielte den Ball damals meistens mit einem »Niblick« aus dem Sand, dessen Loft einem modernen Eisen 8 entsprach. Sarazen bastelte mehr Loft an den Schläger und veränderte seine Sohle so, dass er besser durch den Sand zu gleiten vermochte.
Es dauerte fast zehn Jahre, bis er zu seinem alten Spiel zurückfand, jenem ursprünglichen Spiel, das nur wenig mit der klassischen Schule zu tun hatte, aber für ihn erfolgreich war. Gene Sarazen holte sich 1932 innerhalb weniger Wochen den Sieg bei den British Open und den US Open, 1933 dazu die US PGA Championship.
In Augusta/Georgia hatte Bobby Jones sich um diese Zeit mit dem Bau des National Golf Club seinen Wunsch erfüllt, einer Anlage, wie sie es vorher nie gegeben hatte. 1934 schrieb Jones erstmals das »Augusta National Invitation Tournament« aus, kein Mensch sprach damals vom »Masters«. Das Turnier, zu dem nur die größten Namen eingeladen wurden, war nicht gerade erfolglos, aber man konnte sicherlich auch nicht behaupten, dass die Welt davon besonders bewegt wurde. Es war eine Schlagzeile, die dieses Meeting in Augusta berühmt machte, und es war Gene Sarazen, der für diese Schlagzeile sorgte.
Er hatte dieses »Augusta Invitational« 1935 ordentlich mit Runden von 68 und 71 Schlägen begonnen, aber nach der dritten Runde (73) lag er drei Schläge hinter Craig Wood. Er spielte zusammen mit Walter Hagen, der aber mit 79 Schlägen im Feld verschwand. Sarazen »ackerte« sich in gewohnter Weise über den Kurs, nicht schlecht, aber auch nicht sehr gut. Er hoffte auf irgendetwas Besonderes, ein Wunder. Craig saß bereits im Clubhaus, man gratulierte ihm und traf Vorbereitungen für die Siegerehrung. Sarazen hatte noch vier Löcher zu absolvieren. Er musste mindestens drei Birdies spielen, um Craig einzuholen und ein Stechen zu erzwingen. Auf der 15. Bahn, einem 485 Yards langen Par 5, gelang ihm ein guter Abschlag; natürlich wusste Sarazen, dass das Birdie auf der langen Bahn eine Pflicht war. Die Fahne war etwa 220 Yards entfernt für den zweiten Schlag. Gene Sarazen griff zum Holz 4. Er sagte später: »Ich habe mit allem draufgeschlagen, was ich besaß!« Der Ball überflog das Wasser dort, landete kurz vor dem Grün und rollte und rollte und rollte und verschwand im Loch. Es soll damals ein Schrei über dem Kurs gelegen haben, der die Fenster des Clubhauses erzittern ließ. Es war ein Schlag, wie ihn nur die Besten erleben, und dann auch höchstens einmal in ihrem Leben. Es gab am nächsten Tag keine Zeitung in Amerika, die nicht darüber berichtete. Es war diese Geschichte, die das »Invitation Tournament« auf einen Schlag berühmt machte und aus ihm das »US Masters« werden ließ. Sarazen spielte übrigens nach diesem Albatross die drei letzten Löcher Par. Am nächsten Tag gab es das damals übliche Stechen über 36 Löcher. Sarazen spielte 144 Schläge, Craig 149. Es war der siebte und letzte Major-Titel, den Gene Sarazen gewann. Sarazen war damit der Erste, dem ein Erfolg bei allen vier Major-Turnieren gelang.
Gene Sarazen, geboren am 27. Februar 1902 in Harrison im US-Staat New York als Eugenio Saraceni, starb hochbetagt in Naples/US-Staat Florida am 13. Mai 1999.
5 › Der Kampf mit der Natur
Die Natur verhält sich gegenüber dem Menschen grundsätzlich feindlich. Man denke nur an reißende Ströme, unüberwindlichen Dschungel, gnadenlose Wüsten, sogenannte Feuchtbiotope. Der Säbelzahntiger gilt zwar als ausgestorben, aber als Ersatz dafür gibt es Wühlmäuse oder Maulwürfe, die dem Menschen das Leben nicht erleichtern. Grabende Tiere kommen sogar in den Regeln dieses Spiels vor – beim Fußball werden Spiele deswegen sogar abgesagt. Es gibt allerdings auch Menschen, die das Leben in der freien Natur über alles schätzen und sich erst wohl fühlen, wenn sie zwischen himmelhohen Wäldern ein Spiel betreiben, bei dem es gilt, einen Ball über kilometerweite Entfernungen in ein winziges Löchlein zu befördern. Jeder weiß, was hier bisher nicht erwähnt wurde.
Wie wir alle von den Olympischen Spielen wissen, gibt es wunderbare Sportarten wie die Rhythmische Gymnastik, das Boxen, das Gewichtheben, den Stabhochsprung oder auch das Beachvolleyballspiel der Damen, wo man für die Teilnehmer leicht erreichbare und womöglich überdachte Plätze herrichtet und die Zuschauer erfreut. Das Spiel, das bis hierher – wie gesagt – noch nicht erwähnt wurde, wird in wilden Landschaften ausgetragen, und wenn die Landschaft nicht wild genug ist, treten fantasievolle Landschaftsgestalter auf, um die Natur nach ihrem Gefallen zu verändern. Diese Menschen buddeln tiefe Löcher in das Land, die sie mit Sand füllen; sie bekommen es fertig, umfangreiche Seenplatten herzustellen, sie pflanzen Busch und Bäume und wahrscheinlich auch Brennnessel, gar nicht zu reden von der reichen Flora, die einem das Leben erschwert. Die erwähnten Landschaftsgestalter oder Golf-Architekten, deren Ziel es ist, dem Menschen einen zeitlich begrenzten Frieden zu schenken, sitzen derweil mit dem Fernglas auf der Clubhaus-Terrasse und lachen sich halb kaputt über ihre Opfer. Die Menschen, die es lieben, in dieser Umgebung ihrer Freizeitbeschäftigung nachzugehen, werden von ihren Mitmenschen recht oft als leicht behämmert angesehen.
Es handelt sich hier um Naturfreunde, die das Golfspiel als die Erfüllung ihres Lebens betrachten und deshalb den Kampf gegen die Wildnis bei Sturm und Regen ignorieren. Sie verlassen Weib und Kind, mitunter auch Mann und Kind, sie trotzen Blitz und Donner und verlassen die hoffnungsvollsten Schreibtische in Politik und Wirtschaft. Wenn in diesen unruhigen Zeiten so oft von den Krisen die Rede ist, so wäre es vielleicht nicht falsch, die Ursachen einmal bei einem Spiel zu suchen, welches seinen Ursprung in der wilden Natur hat, die sich nach Jahrhunderten zur Wehr setzt – ein Gesichtspunkt, der bei den Regierenden dieser Welt bisher nie in Betracht gezogen wurde.
Ein leider unentbehrliches Requisit dieses Spiels ist ein Ball in der Größe eines mittleren Wiesenchampignons. Während der Wiesenchampignon aber – wie das Wort schon sagt – auf einer Wiese liegt, breit und bräsig anzuschauen, wird der Ball sofort unsichtbar, nachdem er auf seine kleine Reise geschickt wurde. Wenn man Glück hat, tritt man bei der Suche nach dem Ball auf denselben. In der Regel handelt es sich dabei um den Ball eines Mitspielers. Man hat die Wahl, den Mitspieler auf den Fund aufmerksam zu machen, man kann den Ball aber auch etwas tiefer in den Boden treten. Auf diese Weise trägt die Natur dazu bei, die Freundschaft unter den Golf-Menschen zu fördern.