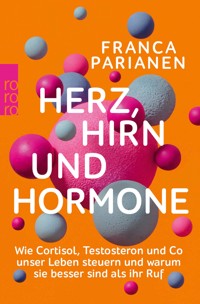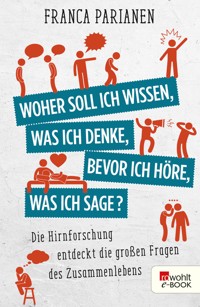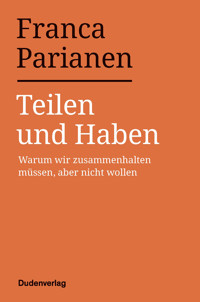
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliographisches Institut
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Duden - Sachbuch
- Sprache: Deutsch
Teilen heißt überleben, zumindest aus Sicht der menschlichen Evolution. In unserer stürmischen Entwicklung hat sich die Verteilung von Arbeit, Wissen und Risiken als unsere größte Stärke und zugleich einzige Chance herausgestellt. Bis heute prägt sie Gehirn und Gesellschaft - vom solidarischen Sozialstaat über die Lust, Informationen zu tauschen (oder Katzenfotos), bis zur komplexen Arbeitsteilung in jedem Lebensbereich (vor allem WG-Küchen). Was aber, wenn Teilen nicht mehr als Grundbedingung gilt, sondern nur noch als Verlustgeschäft? Wenn Besitz das Gleichgewicht aus Kosten, Nutzen und Risiken kippt? Und wenn dabei alles, was wir einst geteilt haben - ob Bildung, Nahrung oder Care-Arbeit - als Erstes unter den Tisch fällt? Weltweit wehren sich immer mehr Menschen gegen Ungleichheit und Ausbeutung. In der Krise und an den Grenzen unserer Ressourcen wird Verteilungsgerechtigkeit wieder zur Überlebensfrage. Franca Parianen zeigt: Wenn wir eine Zukunft haben wollen, müssen wir die verlorene Kunst des Teilens schleunigst wiederentdecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch
Teilen heißt überleben, zumindest aus Sicht der menschlichen Evolution. In unserer stürmischen Entwicklung war die Verteilung von Arbeit, Wissen und Risiken unsere größte Stärke und zugleich einzige Chance. Bis heute prägt sie Gehirn und Gesellschaft – vom solidarischen Sozialstaat über die Lust, Informationen zu tauschen (oder Katzenfotos), bis zur komplexen Arbeitsteilung in jedem Lebensbereich (vor allem WG-Küchen). Was aber, wenn Teilen nicht mehr als Grundbedingung gilt, sondern nur noch als Verlustgeschäft? Wenn Besitz das Gleichgewicht aus Kosten, Nutzen und Risiken kippt? Und wenn dabei alles, was wir einst geteilt haben – ob Bildung, Nahrung oder Care-Arbeit–, als Erstes unter den Tisch fällt? Weltweit wehren sich immer mehr Menschen gegen Ungleichheit und Ausbeutung. In der Krise und an den Grenzen unserer Ressourcen wird Verteilungsgerechtigkeit wieder zur Überlebensfrage. Franca Parianen zeigt: Wenn wir eine Zukunft haben wollen, müssen wir die verlorene Kunst des Teilens schleunigst wiederentdecken.
Die Autorin
Dr. Franca Parianen, geboren 1989, ist Kognitions- und Neurowissenschaftlerin, Science-Slammerin und Buchautorin mit einem Hintergrund in Sozialforschung und globaler Entwicklung. Nach ihrem Bestseller Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? (2017) erschien von ihr zuletzt Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt (2020). Franca Parianen lebt in Berlin.
© Duden 2021
Bibliographisches Institut GmbH,
Mecklenburgische Straße 53, 14197 Berlin
Redaktion Dr. Ludger Ikas
Herstellung Alfred Trinnes
Layout und Umschlaggestaltung Schimmelpenninck.Gestaltung, Berlin
Satz L101 Mediengestaltung, Fürstenwalde
E-Book-Herstellung und Auslieferung readbox publishing, Dortmund, www.readbox.net
ISBN 978-3-411-91346-6 (E-Book)
ISBN 978-3-411-75635-3 (Buch)
www.duden.de
Es war einmal eine Spezies, die ziemlich allein auf der Welt war. Erst waren sie die letzten Zweibeiner, dann die letzten Menschen. Vor allem waren sie mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das ist ziemlich bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass sie fast alles auf ihrem Planeten selbst gestaltet hatten. Sie hatten das Licht entfacht, den Boden bewirtschaftet, Sandbänke aufgeschüttet und dekorative Straßenlaternen aufgestellt. Sie saßen im Winter im Warmen, im Sommer am Meer, und ihre Fressfeinde saßen im Zoo. Aber egal, wo sie saßen, sie waren ziemlich oft unglücklich. Selbst diejenigen unter ihnen, die Medizin und Nahrung hatten und außer Montagen gar kein Problem.
Nachdem sie lange Zeit dem Wetter die Schuld gegeben und sich sehr ausdrücklich darüber beklagt hatten, kamen die Vertreter dieser Spezies irgendwann zum einzig logischen Schluss: Die Hölle, sagten sie sich, das sind die anderen. Immerhin ergab sich fast alles an Sorgen und Ärger ja aus dem, was die Menschen um sie herum sagten, dachten und machten. Aus ihrer Unhöflichkeit, Raffgier und Gewalt oder, noch schlimmer, aus ihrem Humor.
Spätestens als die anderen nicht nur die Hölle waren, sondern auch noch ansteckend, fiel den Menschen auf, dass sie alle ziemlich dicht beisammenstanden. Viele fragten sich, ob man die ganze Idee von Gesellschaft nicht grundsätzlich überdenken sollte. Andere fanden, man sei mindestens seit dem Anbau von Kohlehydraten auf dem Holzweg. Selbst eingefleischte Großstädter träumten plötzlich vom Land (oder zumindest einem Schrebergarten). Alles in allem wirkten einsame Orte plötzlich sehr attraktiv: Tundren, Vulkaninseln, abgeschiedene Täler, hohe Berge oder Brandenburg (jedenfalls dort, wo man keine Brandenburger traf). Hauptsache, ein Stückchen Welt ganz für uns allein. Mit einem kleinen Zaun, der die Deppen fernhält – wenigstens die ohne Maske. Wär’ das nicht schön?
Dann also Schluss mit Optimismus. Aus, vorbei, Klappe zu, Affe tot, wir haben es versucht. Wie soll man auch ein Buch über die erstaunliche Sozialkompetenz des Menschen schreiben, wenn sich vor dem Fenster die Konflikte so atemlos aneinanderreihen, dass man bei jeder Pinkelpause Angst hat, einen wichtigen Teil der Handlung zu verpassen? (Scherz, es nehmen ja eh alle ihre Handys mit aufs Klo.) Ständig laufen die Twitter-Trends heiß, weil wieder irgendwas passiert (oder mindestens Dieter Nuhr). Und ziemlich häufig ist das, was uns daran stresst, nicht mal so sehr dieser tägliche Katastrophenticker, sondern die permanente Koordination mit den anderen, die nötig ist, um damit umzugehen. Die Regeln, die wir neu erfinden müssen – für Politik, Einkauf, Schulen und U-Bahn-Vierer. Zusammenleben heißt teilen, sich arrangieren, Kompromisse finden. Das ist nicht immer schön, und darum ziehen die meisten von uns irgendwann aus WGs aus. Allerdings müssen wir uns dann immer noch den Planeten teilen, und das jüngste Weltgeschehen hat uns gezeigt, dass wir das ja mal so überhaupt nicht hinkriegen.
Dabei waren wir gerade ein bisschen warm geworden mit der Menschheit. Nachdem die Sozialpsychologie erst mal die langen Schatten der 1930er- und 1940er-Jahre aufarbeiten musste, mit wilden Experimenten zu Gehorsam und Gruppenzwang, und andere Wissenschaften sich sicherheitshalber aufs neutrale Terrain des ich-bezogenen Homo oeconomicus zurückzogen, hatten Psychologie und Hirnforschung für eine kleine Revolution gesorgt. Die Entdeckung der Spiegelneuronen im Jahr 1996 löste eine ganze Welle bahnbrechender Erkenntnisse aus, über die erstaunlich soziale Neigung der Spezies Mensch: In unserem Kopf simulierten wir nicht nur die Bewegungen anderer Menschen, sondern auch deren Gefühle und Gedanken. Alles in allem betrachtet, müssten wir tolle Gruppenarbeitspartner sein!
Natürlich kamen die Erkenntnisse damals schon mit einigen Fußnoten – zehn zehn Jahre nach den Spiegelneuronen entdeckte die Neurowissenschaft die Schadenfreude und die Grenzen unseres Mitgefühls gegenüber den Anhängern anderer Fußballmannschaften. Und außerdem gab es ja immer noch das Problem mit der Realität (»Also, irgendwie finde ich diese supersozialen Menschen nie in meiner Arbeitsgruppe!«). Trotzdem gaben diese Experimente unserem positiven Menschenbild Aufwind, inspirierten zahllose Bücher über das empathische Herz und weckten die Hoffnung auf ein kooperatives Zeitalter. Kurzum, eine Zeit lang sah es gut für uns aus. Bis jetzt. Denn von unserer menschenfreundlichen Aufbruchstimmung ist leider nicht allzu viel übrig. Das Einzige, was uns gerade wirklich überzeugend verbindet, ist eine globale Untergangsstimmung.
Mit welchen Sozialkompetenzen die Natur Menschen auch immer ausgestattet hat – sie scheinen nicht auszureichen. Jedenfalls nicht in einem Maße, das uns in sehr naher Zukunft noch einen bewohnbaren Planeten lässt.
Wobei manche Leute wahrscheinlich anmerken würden, dass sie das Problem weniger bei der menschlichen Sozialkompetenz sehen als beim globalen Kapitalismus. Der globale Kapitalismus wiederum würde sagen, dass das Schöne an ihm ja gerade ist, dass Menschen gar nicht sozial kompetent sein müssen, solange sie nur produktiv sind. Aber ganz egal, auf welcher Ebene wir das Problem vermuten, bei der Lösungssuche kommen wir am Menschen nicht vorbei. Schließlich sind wir es nun mal, die unsere Welt gestalten, und wir müssen damit leben. Da drängt sich die Frage ja förmlich auf, warum das so schlecht klappt. Ohnehin zwingen uns die gehäuften Konflikte und Krisen der jüngsten Zeit dazu, nach gemeinsamen Ursachen zu suchen. Nach einem zugrunde liegenden Muster, das über »Dieses verdammte Jahr!« hinausgeht. Kein Problem sticht dabei so sehr hervor wie dieses: Verteilung.
Fast alle Bewegungen unserer Zeit drehen sich um das Teilen und Haben. Von #FridaysForFuture über #BlackLivesMatter und #wirhabenplatz bis #metoo: Sie alle fragen, was wem zusteht und wer etwas abgeben muss. Wer auf dieser Welt den Löwenanteil an Geld, Macht, Ressourcen und dem Streben nach Glück bekommt – und wer dafür bezahlt, wenn dabei aus Versehen 2000 Tonnen Öl auslaufen.
Auf der Gegenseite erstarkt wiederum eine Strömung, die findet, dass sie von dem vielen oder wenigen, was sie hat, am liebsten gar nichts abgeben möchte und dass sie außerdem ungern »alte weiße Männer« genannt wird. Dafür verweist sie umso lieber auf ein imaginäres volles Boot, was wiederum ein ziemlich verqueres Bild ist, wenn man es Leuten entgegenschleudert, die in einem echten vollen und außerdem sinkenden Boot sitzen. Von Erderwärmung über White Supremacy bis Klopapier – im Jahr 2020, während ich dieses Buch schreibe, trifft alles krachend aufeinander.
Gleich im Januar sprechen die Zeichen der Zeit eine eindeutige Sprache, als Australien in Flammen steht und die Australier mindestens genauso wütend auf die Brände sind wie auf ihren Premierminister und dessen Nähe zur Kohleindustrie. Oder als die gesammelte Jugend der USA plötzlich ihre Hoffnung in einen Sozialisten setzt (oder, wie man in Europa sagt, einen Mitte-links-Kandidaten). Oder als im Februar Parasite den Oscar gewinnt, ein Film über die ziemlich buchstäbliche Angst vor dem sozialen Abstieg – vom lichtdurchfluteten Haus ins Souterrain, in den Keller. Der koreanische Film stößt offenbar bis ans andere Ende der Welt auf Resonanz. Mindestens bis Berlin, wo man im gleichen Monat versucht, den explodierenden Mietpreisen einen Deckel aufzusetzen. Die Enteignungsdebatte tobt, und die Sozialismusvergleiche blühen, doch im Mai ist es erst mal die Black-Lives-Matter-Bewegung aus den USA, die nach dem Mord an George Floyd auch die deutsche Hauptstadt erfasst. Ende August läuft vor der mauritischen Küste ein Tanker auf Grund, bricht auseinander und leckt tonnenweise Öl. Am selben Tag, als dort Hunderttausende gegen lasche Umweltpolitik demonstrieren, versammeln sich in Berlin Corona-Demonstranten unter einer beunruhigenden Anzahl von Reichskriegsflaggen. Im September brennen das brasilianische Pantanal und das Flüchtlingslager in Moria. Der Himmel über Kalifornien färbt sich erst orange und dann blutrot.
Der Kampf um die Verteilung der Erde ist in vollem Gange, und wir können nicht mal behaupten, man habe uns nicht gewarnt. Die meisten Konflikte schwelen schon lange, begleitet von ausdrücklichen Vorwarnungen durch Wissenschaft, Aktionstage und den ein oder anderen Glückskeks. In Deutschland gab es das erste Beben ja schon ein Jahr vorher, als die komplette Jugend beschloss, ein fünfzigminütiges Video zu gucken, in dem ein Youtuber namens Rezo erst Ungleichheit und dann den Klimawandel erklärt, ehe er den Regierungsparteien Untätigkeit in beidem vorwirft. (In gewisser Weise ist es ein Thema, denn die reichsten 1 Prozent besitzen nicht nur mehr als die untere Hälfte, sie verbrauchen auch mehr als doppelt so viel CO2.) Konnte ja keiner ahnen, dass sich das Thema mit der Antwort »Hey Rezo, du alter Zerstörer« und einem 11-seitigen Antwort-PDF der CDU nicht erledigen lässt.
Unser Verteilungsproblem ist nichts Neues, aber als plötzlich die Nudelregale leer sind, sind wir dann doch überrascht. In dieser Form haben wir es wirklich nicht kommen sehen. Eine Pandemie müsste eigentlich gar keine Verteilungskonflikte verursachen, denn das Einzige, was da verteilt wird, sind Viren, und die will per Definition keiner haben. Aber am Ende tut sie’s natürlich doch, und das nicht nur, weil abstrakte Verteilungsfragen sehr greifbar werden, wenn plötzlich Desinfektionsmittel alle sind. Vielmehr, weil aus den Rissen im sozialen Gefüge plötzlich tiefe Gräben werden.
Auf einmal wird wirklich allen sehr offensichtlich klar, was wir als Gesellschaft eigentlich nie ganz geklärt haben: wer für die Kosten von Care-Arbeit verantwortlich ist oder wie viele Kostbarkeiten ein Einzelner ansammeln darf (wahlweise Ravioli). Warum vermeintlich essenzielle Mitarbeiter nie einen essenziellen Anteil am Kuchen abbekommen und Berufsgruppen, die wir im Lockdown kaum vermissen, die ganze Bäckerei. Was uns aber am allermeisten verdattert, ist, dass wir uns offenbar auf gar nichts mehr einigen können: nicht auf die zu ergreifenden Maßnahmen, nicht auf die Fakten, ja nicht einmal auf ein gemeinsames schützenswertes Ziel – Menschenleben. Man kann es den Einzelnen kaum verübeln, dass sie mittlerweile das System und/oder gleich die Zivilisation infrage stellen. Oder sich zumindest fragen, ob sie sich nicht doch überzeugendere Gruppenmitglieder hätten aussuchen sollen.
Also doch lieber auf eine einsame Insel, oder versuchen wir es noch mal miteinander?
Idealistisch gesehen, ist die Sache klar: Wir mögen es zu teilen. Edel soll es sein, hilfreich und gut. Wir verehren Jesus und Lady Di, die barmherzigen Samariter und den Freund, der immer so viel Trinkgeld gibt. Je nach Informationsblase auch Bill Gates. Auf jeden Fall identifizieren wir uns mit all denen lieber als mit Scrooge, dem Dickens’schen Geizhals. Wer will schon zugeben, dass er auf Weihnachtsbesuch von drei Geistern wartet, bevor er seine Praktikantinnen angemessen bezahlt?
Auch unseren Kindern versuchen wir Werte wie Solidarität und Sorge um die Schwächeren mitzugeben (»Was auch immer sie später vom BWL-Studium abhält«). »Kinder müssen teilen lernen« heißt das Mantra liebevoller erzieherischer Kleinarbeit und pädagogisch wertvoller Kinderbücher: Der Regenbogenfisch teilt seine Schuppen so freigiebig, dass einige den Autor Kommunist nennen, und der kleinen Dinosaurier Bronto teilt mindestens ein Eis. Beide geben allerdings etwas ab, um nicht mehr gemobbt und verhauen zu werden, und wenn das der einzige Grund zum Teilen ist, dann haben wir womöglich ein ganz anderes pädagogisches Problem. In Kirsten Boies Juli tut Gutes teilt Juli zwar großzügig wie Sankt Martin, aber auch nur, weil ihn seine Mutter dazu zwingt.
Es scheint gar nicht so einfach zu sein, uns die pure Freude am Teilen zu vermitteln. Aber das hat wohl auch kein Elternteil erwartet, das schon mal dabei zugesehen hat, wie sich seine Zwillinge im Sandkasten einen Boxkampf um den Schaufelbagger liefern. Im Notfall halten wir uns eben an den Anstandsrest – das letzte Stück, das niemand zu essen wagt, bis es kalt wird – und ansonsten an die goldene Regel, wonach das Kind, das die Schokolade teilt, niemals auswählen darf, welches Stück es selbst bekommt. Wobei die Kinder unseren Erziehungsversuchen wahrscheinlich weitaus skeptischer gegenüberstünden, wenn sie wüssten, dass wir danach ins Büro fahren zu unserer designierten Kaffeetasse und der handbeschrifteten Tupperdose. Oder dass sich das, was wir mit den Armen teilen – im Gegensatz zu geteilter Schokolade –, steuerlich absetzen lässt.
Auch Erwachsene muss man anscheinend erst einmal zum Teilen schubsen, möglicherweise mit weniger Regenbogenfischen und mehr göttlicher Erleuchtung. Im Hinduismus bringt das Teilen Karmapunkte, im Alten Testament zeugt es von Gottgefälligkeit. Im Buddhismus teilt man noch den letzten Bissen, und in einer islamischen Erzählung teilt eine Familie mit ihrem Gast, auch wenn sie dann selbst nichts mehr hat. Letzteres verheimlicht sie mittels geschickter Beleuchtung, und das würde auch den anderen Glaubensrichtungen gefallen, denn sie sind sich einig: Für Geschenke soll man weder Gegenleistung noch Anerkennung erwarten. Wobei der Hinduismus hinzufügt, dass es gut ist, wenn man auch die Gefühle des Empfängers im Blick hat. Falls Sie als Kind regelmäßig Socken geschenkt bekommen haben, hätten Sie Ihrer Oma einen Religionswechsel vorschlagen sollen.
Der religiöse Ansatz ist durchaus effektiv. Menschen, die man schüttelt und an den Herrgott erinnert, benehmen sich daraufhin freigiebiger (und bestrafungsfreudiger, aber das ist ein anderes Thema).1 Und damit könnte die Frage, warum wir überhaupt teilen, eigentlich erledigt sein. Der ungläubige Rest der Menschheit findet in der Geschichte sicherlich eine Menge humanistischer Vorbilder, die ihm das Teilen nahelegen. Verteilungsproblem gelöst! Ich hoffe, Sie haben sich noch ein anderes Buch in den Urlaub mitgenommen?
Dummerweise sind wir mit der Umsetzung unserer (quasi-)religiösen Prinzipien dann doch wieder inkonsequent. Nicht umsonst findet man Buddha im Baumarkt direkt neben den Whirlpools (von wegen, das Leben ist Leiden!). Ein kommunistisches Parteibuch schützt nicht vor dem Traum vom Eigenheim, und das, was wir neulich ins Tauschregal gegeben haben, war streng genommen nicht unser letztes Hemd, sondern ein Wollpullover, der kratzt.
Es fühlt sich ja auch alles nicht ganz fair an. Schließlich haben wir uns das, was wir haben, sauer verdient, im Schweiße unseres Angesichts, auf einem unbequemen Bürostuhl (okay, gestern war ein ruhiger Tag, aber davor lagen ein paar sehr volle Wochen). Haben dafür alles erledigt, was wir sollten: den Auslandsaufenthalt und das unbezahlte Praktikum, Überstunden, grenzwertige Vorgesetzte und berufsbedingte Umzüge. Da ist es doch wahrlich nicht zu viel verlangt, dass man sich von der ganzen Arbeit jetzt ein paar wohlverdiente schöne Dinge kaufen und genießen kann, ohne dass einem jemand deshalb ein schlechtes Gewissen macht. Wir haben gestern erst Fairtrade-Kaffee gekauft!
Teilen ist nicht immer schön. Besonders, wenn man sich selbst gefühlt sehr stark eingebracht hat und die anderen sich eher so mittel. Außerdem kommt man sich reichlich komisch vor, wenn man mal großzügig ein paar Euro mehr abgibt und am nächsten Morgen direkt um ein paar weitere gebeten wird.
Am Ende erübrigen wir zähneknirschend etwas Kleingeld für den Gitarrenspieler oder den Geburtstagsstrauß an die nervigste Kollegin, über das Jahr verteilt ein paar Spenden und zu Weihnachten sogar mal eine, die man spürt – allein schon wegen der drei Geister. Bei den Kleckerbeträgen, die da zusammenkommen, kann man sich schon fragen, ob sie den Stress und das schlechte Gewissen wert sind.
Sucht man das Wort »Teilen« auf Wikipedia, zeigt das Titelbild zwei Kinder, die mit Strohhalmen aus derselben Limonadenflasche trinken. Beide sehen eher unglücklich aus.
Wenn uns ohnehin weder der kleine Dino noch irgendeine höhere Macht wirklich dazu bringt, zu teilen, könnten wir die Moralpredigten doch genauso gut bleiben lassen.
Natürlich war es zu Sankt Martins Zeiten mal wichtig, seinen Mantel mit einem frierenden Armen zu teilen. Der hatte mit Sicherheit keine Krankenversicherung. Heute hat sich aber doch der Staat dieses Problems angenommen, und wir persönlich müssen nichts weiter tun, als Parteien zu wählen, die dafür sorgen, dass das so bleibt. (»Bin ich wie Mutter Teresa? Na ja, sagen wir, ich habe noch nie die FDP gewählt.«) Was also, wenn wir unsere individuellen Bemühungen im Bereich großzügiges Teilen und unser ewiges schlechtes Gewissen einfach mal runterschrauben?