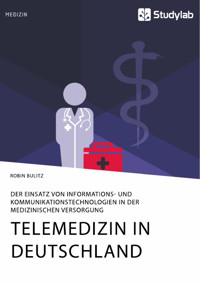
Telemedizin in Deutschland. Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in der medizinischen Versorgung E-Book
Robin Bulitz
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Dadurch wächst auch die Zahl der chronischen Erkrankungen, die das deutsche Gesundheitssystem vor neue Herausforderungen stellt. Gerade die flächendeckende medizinische Versorgung benötigt dringend effektive Lösungen. Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien kann eine solche moderne Lösung sein. Die Telemedizin wendet neue Technologien im Gebiet der Medizin an und bietet so einen vielversprechenden Weg, die Probleme des Gesundheitssystems zu beheben. Durch die Verwendung von Telekommunikation und Informatik unterstützen telemedizinische Anwendungen die Interaktion zwischen Ärzten und Patienten sowie zwischen Ärzten untereinander. Die medizinische Versorgung wird auf diese Weise über räumliche Grenzen hinweg möglich. Darüber hinaus verbessert sie auch die Qualität, Transparenz und Wirtschaftlichkeit medizinischer Leistungen. Aber wie weit und wie vielversprechend ist der Einsatz von Telemedizin in Deutschland wirklich? Dieser Frage geht Robin Bulitz in seiner Publikation nach. Der Autor zeigt dabei auf, in welchen Bereichen noch Nachholbedarf besteht und wo Deutschland bereits eine Vorreiterrolle einnimmt. Bulitz sieht die Telemedizin als ein wichtiges Zukunftsfeld in der medizinischen Versorgung des 21. Jahrhunderts und damit als entscheidenden Faktor für die Zukunft des gesundheitlichen Versorgungssystems in Deutschland. Aus dem Inhalt: - Telemedizin; - Gesundheitswesen; - Digitalisierung im Gesundheitswesen; - Telematik; - e-Health
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2018 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abstract und Einleitung
1.1 Vorgehensweise
2 Einordnung der Telemedizin in das Gesundheitswesen
2.1 Warum brauchen wir die Telemedizin?
2.2 Gründe für den notwendigen Einsatz der Telemedizin
2.3 Chancen und Ziele der Telemedizin
3 Definition der Begrifflichkeiten
3.1 e-Health
3.2 Telematik
3.3 Telemedizin
3.4 Weitere telemedizinische Begrifflichkeiten
4 Bereiche und Anforderungen an die Telemedizin
4.1 Die Vorteile und Nachteile der Telemedizin
4.2 Die Anwendungsbereiche und beteiligten Parteien der Telemedizin
4.3 Die Anforderungen an die Telemedizin
4.3.1 Recht
4.3.2 Technik
4.3.3 Wirtschaft
5 Geschichte, Entwicklung und Stand der Telemedizin
5.1 Die Anfänge und der Werdegang der Telemedizin
5.2 Die Telemedizin im weltweiten Fokus
5.3 Telemedizinische Entwicklungen in Deutschland
5.4 Der Stand der Telemedizin in Deutschland im Jahr 2016
6 Beispielhafte Telemedizin-Projekte in Deutschland
6.1 Bayern als Vorreiter dank TEMPiS, Steno und Co.
6.2 Das EU-Modellprojekt „CCS Telehealth Ostsachsen“
6.3 Überblick zu weiteren „erfolgreichen“ Projekten
7 Das Projekt „TeleArzt“
7.1 Idee und Entstehung
7.2 Bestandteile, Aufbau und Ablauf
7.3 VERAH im Fokus
7.4 Status Quo und Ausblick
8 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Entwicklung der Gesundheitsausgaben in Deutschland von 2000 bis 2015 (Vgl. Statistisches Bundesamt)
Abbildung 2: Die Leistungsausgaben der GKV und PKV je Versichertem von 2006 bis 2014 (Vgl. BMG 2016)
Abbildung 3: Die Altersstruktur der Bevölkerung in Deutschland von 1950 bis 2060 (Vgl. Statistisches Bundesamt und Demografieportal)
Abbildung 4: Der Anteil der über 65- und über 80-Jährigen in Deutschland von 1950 bis 2060 (Vgl. Statistisches Bundesamt und Demografieportal)
Abbildung 5: e-Health als Oberbegriff für die Telematik und Telemedizin (Vgl. Burchert 2002)
Abbildung 6: : Entwicklung der Begrifflichkeiten (Vgl. Jedamzik 2014 S. 9)
Abbildung 7: Definition der Telemedizin (Vgl. Gnann 2001 S. 20)
Abbildung 8: Beispielhafte Darstellung einer Telemonitoring-Anwendung (Vgl. Positionspapier des GKV-Spitzenverbands 2016 S. 8)
Abbildung 9: Ein Überblick telemedizinischer Anwendungsfelder (Eigene Darstellung)
Abbildung 10: Potenziale der Telemedizin (Vgl. Nagel 2009 S. 21)
Abbildung 11: Die unterschiedlichen Ebenen telemedizinischer Anwendungsbereiche (Vgl. Nagel 2009 S. 19)
Abbildung 12: Die Anzahl der Publikationen zur Telemedizin (Vgl. Medline 2017)
Abbildung 13: Die verschiedenen telemedizinischen Institutionen in Deutschland (Vgl. DGTeleMed 2017)
Abbildung 14: Anzahl der Telekonsile im TEMPiS-Netzwerk 2003-2015 (Vgl. TEMPiS Jahresbericht 2016)
Abbildung 15: Die Funktionsweise des „TELnet@NRW“ Projekts (Vgl. telenet.nrw 2017)
1. Abstract und Einleitung
Die Telemedizin wird in Zukunft eine tragende Rolle im gesundheitlichen Versorgungssystem der Bundesrepublik Deutschland spielen und zu einem der wichtigsten und bedeutendsten Zukunftsfelder in der medizinischen Versorgung des 21. Jahrhunderts werden. Die flächendeckenden Anwendungen der Telematik und Telemedizin werden eine bessere und effizientere Versorgung von Patienten, beispielsweise in ländlichen Regionen, in denen bereits jetzt ein Ärztemangel zu verzeichnen ist ermöglichen und neue Perspektiven schaffen. Wartezeiten beim Arzt gehören der Vergangenheit an, ältere Patienten können in ihrem häuslichen Umfeld behandelt werden und die Notfallmedizin wird dank telemedizinischer Anwendungen revolutioniert und professionalisiert.[1] Dies sind grob zusammengefasst die theoretischen Ausblicke bei dem Gedanken an die Telemedizin. Wie es sich jedoch tatsächlich in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts, genauer gesagt im Jahr 2016 darstellt, auf welchem Stand die Telemedizin in Deutschland ist, in welchen Bereichen und bei welchen Themen Nachholbedarf besteht oder schon Vorreiterrollen eingenommen werden konnten, gilt es im Folgenden zu betrachten. Dabei spielen rechtliche, technische und ökonomische Fragen eine ebenso große Rolle wie die Akzeptanz der Telemedizin in der Bevölkerung und bei allen Beteiligten im Gesundheitswesen. Darüber hinaus muss betrachtet werden welche Rolle der Gesetzgeber in dem Bezug auf Fragen zur Telemedizin einnimmt und inwiefern seine letzten Bestrebungen zukunftsträchtig sind und bereits gegriffen haben. Dabei stehen das E-Health-Gesetz und die E-Health-Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit ebenso im Fokus wie die mehr als schleppend verlaufende Einführung der Telematikinfrastruktur in Deutschland, die bisher mehrere Millionen Euro verschlungen hat. Benchmarks anderer Länder müssen in diesem Zusammenhang ebenso betrachtet werden wie bereits erfolgreich etablierte deutsche Telemedizin-Projekte. Anhand dessen kann schließlich festgestellt werden wo Deutschlands Telemedizin im Jahr 2016 steht und welche Schritte noch zu gehen sind, um einen erfolgreichen, effizienten und ganzheitlichen Einsatz zu gewährleisten. Wie dies im Rahmen der vorliegenden Arbeit geschehen soll, soll im Folgenden kurz erläutert werden, um anschließend mit den aktuellen Herausforderungen des Gesundheitswesens in die Thematik einzusteigen.
1.1 Vorgehensweise
2 Einordnung der Telemedizin in das Gesundheitswesen
Das deutsche Gesundheitswesen ist und wird mit großen Herausforderungen, Aufgaben und Fragestellungen konfrontiert, die es unter der Zuhilfenahme verschiedenster neuer oder noch nicht zur Gänze etablierter Verfahren zu lösen und zu beantworten gilt. Diese Herausforderungen sind zum einen der demographische Wandel und der medizinisch-technologische Fortschritt und zum anderen die regionalen Probleme der flächendeckenden Versorgung.[2] Die Entwicklung der deutschen Bevölkerungsstruktur und die damit verbundene Alterung der Bevölkerung bedingt einen Fokus auf die Behandlung chronischer Erkrankungen, die in der Gesellschaft im Allgemeinen und der Medizin im Speziellen immer mehr zunehmen und an Bedeutung gewinnen. Parallel zu den etablierten Versorgungsformen, aber auch weit darüber hinaus, bringt diese Entwicklung schon jetzt und auch in Zukunft weiterhin den Einsatz moderner Kommunikations- und Informationstechnologien ins Spiel.[3] Der Gesundheitstelematik und der Telemedizin werden hier, als besonders Erfolg versprechende Innovationen, große Chancen eingeräumt, um mit Innovationen und Lösungen den aktuellen und kommenden Problemen zu begegnen. Die Telemedizin ist dabei heute nicht mehr nur eine sinnvolle Ergänzung zu klassischen Versorgungsmethoden, sondern liefert bereits Ansätze und Lösungen, die es weiter zu verfolgen und auszubauen gilt. Sie wird sich, da sind sich fast alle Experten einig, als feste Größe der modernen Gesundheitsversorgung etablieren und im Zusammenspiel aus staatlicher und privater Gesundheitsökonomie eine tragende Rolle einnehmen.[4]
Hierbei spielen nicht nur demographische Aspekte, medizinisch-technologische Fortschritte und allgemeine Entwicklungen in unserer Gesellschaft eine Rolle. Das Gesundheitswesen hat sich darüber hinaus und wird sich auch insgesamt zum wirtschaftlich bedeutsamsten Faktor der Wissensgesellschaft im 21. Jahrhundert entwickeln. Die Erklärung für diese Entwicklung und Tatsache liefert die Theorie des russischen Wirtschaftswissenschaftlers Nikolai Kondratieff. Demnach treten in einer Marktwirtschaft nicht nur kurze und mittlere Wirtschaftsschwankungen auf, sondern auch lange Zyklen mit einer Periode von 40 bis 60 Jahren. Sie beruhen auf den von Kondratieff identifizierten Basisinnovationen, welche die Wirtschaft aller Länder in einen Wachstumsprozess führen, der substanzielle Veränderungen und Innovationen nach sich zieht. Sie gelten als Auslöser ganzer Wirtschaftszyklen, die man auch Kondratieff-Zyklen nennt. So waren die Dampfmaschine, die Elektrotechnik, die Chemie und die Kommunikationstechnologie eben solche Basisinnovationen, die man seither in fünf Kondratieff-Zyklen eingeteilt hat. Sie haben das Tempo und die Richtung des Innovationsprozesses weltweit über mehrere Jahrzehnte bestimmt. Mit substanziellen Entwicklungen und Innovationen in der modernen Medizin befindet sich die Weltwirtschaft nach den oben genannten Basisinnovationen wieder am Beginn oder vielmehr bereits in einem neuen Zyklus, dem nunmehr sechsten Kondratieff-Zyklus. Der Megamarkt des nächsten Zyklus ist der Gesundheitssektor. Gesundheit wird hierbei nach Leo A. Nefiodow ganzheitlich verstanden: körperlich, seelisch und geistig, ökologisch und sozial. Dabei werden die Informations- und Kommunikationstechnologien für die Erschließung und Weiterentwicklung der Gesundheitsmärkte unverzichtbar und Gesundheitstelematik und die Telemedizin nehmen einen wichtigen Bestandteil in diesem Veränderungsprozess ein und avancieren zum Zukunftsgut.[5]
Bei chronischen Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus II oder akuten Vorfällen, wie z.B. einem Herzinfarkt, steht Telemedizin darüber hinaus für eine innovative Behandlungsform. Diese nutzen elektronische Mittel für die Vorsorge und Behandlung und werden in Deutschland bereits in zahlreichen Projekten, auf die im weiteren Verlauf der Arbeit noch eingegangen wird, genutzt, umgesetzt und fortlaufend weiterentwickelt. Dies ist unter dem Gesichtspunkt, dass es sich bei den genannten Erkrankungen um diejenigen mit der weitesten Verbreitung und dem höchsten Kostenfaktor handelt, von besonderer Bedeutung.[6] Das Potential und die weitreichenden Erfahrungen der Telemedizin in anderen Ländern lassen erkennen, dass sich die Telemedizin auch in Deutschland langfristig durchsetzen wird und bereits auf einem guten Weg ist, wie diese Arbeit im weiteren Verlauf ebenfalls zeigen wird. Unter Berücksichtigung der Zunahme des Lebensalters und dem Anstieg der Anzahl chronischer Erkrankungen werden medizinische wie gesundheitsökonomische Aspekte im Umfeld der Versorgung immer wichtiger. Alleine in Deutschland leben 1,8 Millionen Menschen mit Herzinsuffizienz und über fünf Millionen Menschen mit koronarer Herzkrankheit, die es angemessen zu versorgen gilt. Weitere chronische Krankheiten wie Diabetes oder periphere Verschlusskrankheiten kommen noch hinzu. Die Gesundheitstelematik und die Telemedizin zeigen hierfür bereits praktikable und gute Lösungen auf.[7] Der medizinische Nutzen der Telemedizin ist darüber hinaus durch zahlreiche, wenn auch noch nicht ausreichende Studien belegt und sie wird bereits international erfolgreich eingesetzt. So ist z.B. in den USA ein starkes Wachstum des Gesundheitsmarktes zu beobachten und Telemedizin gilt als probates Mittel, um die Kosteneffizienz der Behandlung zu steigern. Telemedizin ist darüber hinaus ein Mittel, um die strategischen Ziele des „eHealth Action Plan“ für alle Bürger der Europäischen Union zu erreichen. Die von der Europäischen Kommission darin formulierten Ziele sind: besserer Zugang, bessere Qualität und höhere Effizienz hinsichtlich der Gesundheitsdienste. Alles zusammen – der demographische Wandel, der medizinisch-technologische Fortschritt, Funktionalität und politischer Rahmen – deutet auf eine vielversprechende Zukunft gesundheitstelematischer Innovationen hin und rückt damit die Bedeutung der Telemedizin in den Fokus.[8]
Gleichzeitig verursachen die Innovation gesundheitstelematischer und telemedizinischer Anwendungen und Lösungen noch Probleme. Die Aufnahme in die Regelleistungskataloge der Krankenkassen und die breite Akzeptanz in Ärzte- und Patientenkreisen sind noch strittig und gehen nur schleppend voran. Die Finanzierung einer „telemedizinischen Revolution“ wird kritisch diskutiert und sie wird zum Gegenstand einer richtigen Mischung von Markt und Plan im deutschen Gesundheitswesen. Hinzu kommen datenschutzrechtliche Bedenken.[9] Erhalten die verschiedenen Elemente der Gesundheitstelematik und der Telemedizin zwar im Koalitionsvertrag der CDU/CSU und SPD geführten Bundesregierung von 2013 bis 2017 Aufmerksamkeit, so sind die genauen gesundheitspolitischen Konsequenzen einer breiten Einführung gesundheitstelematischer und telemedizinischer Technologien und Verfahren zum Teil ungeklärt. Die Akteure im Gesundheitswesen liegen häufig im Streit, wenn es um die geeignete Nutzung telemedizinischer Verfahren und ihre Implementation im deutschen Gesundheitssystem geht.[10]
2.1 Warum brauchen wir die Telemedizin?
Der Bereich der Telemedizin wird nichtsdestotrotz oder gerade deswegen in den kommenden Jahren weiterhin an Bedeutung gewinnen. Expertengruppen beurteilen die Telemedizin weltweit als eine Methode, um den aktuellen Herausforderungen der Gesundheitssysteme besser gerecht zu werden. Ziel ist es, die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern und dabei gleichzeitig die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Da der Gesundheitssektor jedoch seit Jahren zunehmendem Wettbewerbsdruck unterliegt, ist unter Beibehaltung der derzeitigen Praktiken mit weiteren Kosteneinsparungen und dementsprechend mit einem Qualitätsverlust in der Versorgung zu rechnen. Der demographische Wandel und die Zunahme chronischer Krankheiten verstärken den Druck auf das Gesundheitswesen und nicht zuletzt auf die Sozialsysteme zusätzlich. Insbesondere trägt auch eine gewisse Ineffizienz in einem zwischen Staat und Markt oszillierenden Gesundheitswesen zu hohen Kosten und ärztlicher Unterversorgung in bestimmten Regionen bei.[11]
Telemedizin gilt angesichts dieser Herausforderungen und Missstände im deutschen Gesundheitswesen als einer der Hoffnungsträger, der eine effiziente und effektive Gesundheitsversorgung mit ökonomischem Potential garantieren kann. Die technischen Möglichkeiten zur Anwendung von Telemedizin sind heute vorhanden, jedoch besteht der aktuelle Markt aus einer Vielzahl von Produkten und Firmenstrategien, was die Entwicklung einer homogenen Infrastruktur erschwert. Hierbei will jedoch der Staat als Vorreiter gelten und eine ganzheitliche Telematikinfrastruktur, die „gematik“ schaffen.[12] Schwierigkeiten und ein subtiles Misstrauen zwischen den Leistungsträgern, den Leistungserbringern und – last but not least - den Patienten, führt jedoch zusätzlich zu Unübersichtlichkeit und Unbehagen. Dies verhindert noch, dass Telemedizin erfolgreicher und effizienter eingesetzt wird.[13]
Das Hauptproblem aber damit auch gleichzeitig der Motor für eine funktionierende Telemedizin ist jedoch das deutsche Gesundheitssystem, welches zunehmend mit Herausforderungen, wie Unter-, Über- und Fehlversorgung zu kämpfen hat. Der demographische Wandel wird in Verbindung mit einer flächendeckenden und effizienten Versorgung immer mehr zum Problem. Er verursacht Kostensteigerungen und Einnahmedefizite. Insbesondere bedingt er auch die Zunahme chronischer Krankheiten wie Herzinsuffizienz und Diabetes mellitus. Es besteht Handlungsbedarf, um den zukünftigen Herausforderungen, die im Folgenden in drei Kategorien betrachtet werden, angemessen zu begegnen.[14] Diese drei Kategorien sollen somit exemplarisch als Hauptgründe dienen, um zu zeigen, warum es von größter Wichtigkeit ist, eine funktionierende und effiziente Nutzung der Telemedizin zu verfolgen und zu gewährleisten.
2.2 Gründe für den notwendigen Einsatz der Telemedizin
Warum es der Telemedizin bedarf und weshalb sie schnellstmöglich und vor allen Dingen erfolgreich flächendeckend eingeführt, umgesetzt und angewandt werden sollte, wurde bereits im Allgemeinen angerissen. Nun soll es zur klaren Einordnung noch an drei Hauptgründe, den steigenden Kosten im Gesundheitswesen, den sinkenden Einnahmen im Gesundheitswesen und der Ineffizienz im Gesundheitswesen festgemacht werden. Hiernach sollte deutlich werden, warum die Telemedizin schnellstmöglich und in vollem Umfang zur Anwendung kommen sollte. Im Anschluss wird noch einmal auf die Chancen, wie auch die Ziele der Telemedizin in diesem Zusammenhang eingegangen.
Steigende Ausgaben
Die Ausgaben im Gesundheitssektor steigen allem voran aufgrund der Zunahme chronischer Krankheiten, welche bedingt durch die immer älter werdende Bevölkerung zum größten Kostentreiber in der Gesundheitsversorgung des 21. Jahrhunderts geworden sind. Hinzu kommt der technische Fortschritt, der immer bessere, aber auch teurere Behandlungsmethoden ermöglicht und damit die hohen Ansprüche der Patienten sowie der Leistungserbringer an den Gesundheitssektor bedingt – obwohl das Preis-Leistungs-Verhältnis im Gesundheitswesen zwischen Markt und Staat nicht stimmig organisiert ist.[15] Demnach sind die Gesamtausgaben für ambulante Leistungen im deutschen Gesundheitswesen zwischen 2000 und 2015 um fast 100 Prozent gestiegen. Bei stationären und teilstationären Einrichtungen ist ein Anstieg um knapp 75 Prozent zwischen 2000 und 2015 festzustellen.[16]
Abbildung 1: Entwicklung der Gesundheitsausgaben in Deutschland von 2000 bis 2015 (Vgl. Statistisches Bundesamt)
Chronische Herzkrankheiten (auch ischämische Herzkrankheiten genannt), wie z.B. die koronare Herzkrankheit, Angina Pectoris, Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen waren im Jahr 2015 die häufigste Todesursache in Deutschland mit 356.625 Todesfällen. Knapp 39 Prozent aller Todesfälle wurden somit durch Herz-Kreislaufkrankheiten verursacht. Insgesamt verursachten Erkrankungen des Kreislaufsystems, darunter Herzkrankheiten und Hypertonie (Bluthochdruck) laut Statistischem Bundesamt die meisten stationären und ambulanten Behandlungen.[17]





























