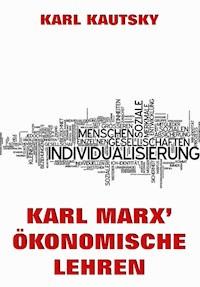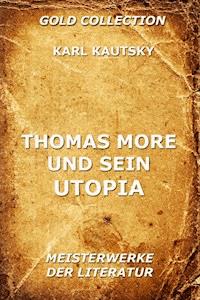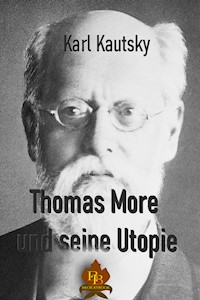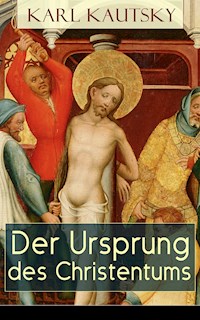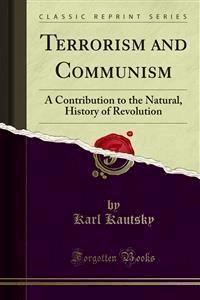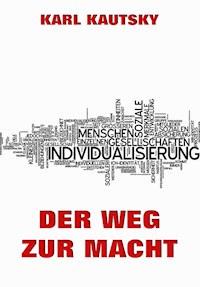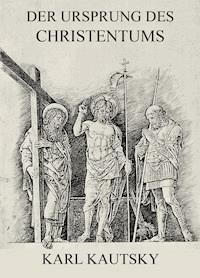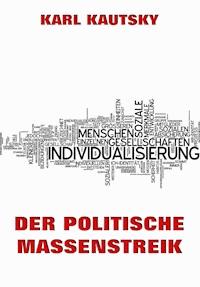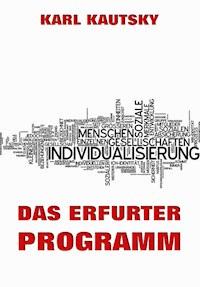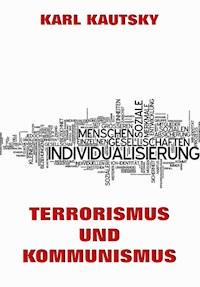
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution. Kautsky beschreibt die Unterschiede der Kommune, auf die sich die Gründer der Sozialdemokratie immer wieder beriefen, zu den terroristischen Zuständen im damaligen Bolschewismus. Inhalt: Vorwort 1. Revolution und Terrorismus 2. Paris 3. Die große Revolution 4. Die erste Pariser Kommune 5. Die Tradition der Schreckensherrschaft 6. Die zweite Pariser Kommune 7. Die Milderung der Sitten. 8. Die Kommunisten an der Arbeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Terrorismus und Kommunismus
Karl Kautsky
Inhalt:
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Terrorismus und Kommunismus
Vorwort
1. Revolution und Terrorismus
2. Paris
3. Die große Revolution
4. Die erste Pariser Kommune
a) Das Pariser Proletariat und seine Kampfmittel
b) Die Ursachen des Schreckensregiments
c) Der Mißerfolg des Terrorismus
5. Die Tradition der Schreckensherrschaft
6. Die zweite Pariser Kommune
a) Der Ursprung der Kommune
b) Arbeiterrat und Zentralkomitee
c) Die Jakobiner in der Kommune
d) Die Internationalisten in der Kommune
e) Der Sozialismus der Kommune
f) Zentralismus und Föderalismus
g) Der terroristische Gedanke in der Kommune
7. Die Milderung der Sitten.
a) Bestialität und Humanität
b) Zwei Tendenzen
c) Bluttaten und Schreckensherrschaft
d) Die Milderung der Sitten im 19. Jahrhundert
e) Die Wirkungen des Krieges
8. Die Kommunisten an der Arbeit.
a) Expropriation und Organisation.
b) Das Reifen des Proletariats.
c) Die Diktatur
d) Die Korruption.
e) Die Wandlung des Bolschewismus
f) Der Terror
g) Die Aussichten der Sowjetrepublik
h) Die Aussichten der Weltrevolution
Terrorismus und Komunismus, Karl Kautsky
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849628970
www.jazzybee-verlag.de
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Sozialistischer Schriftsteller, geb. 16. Okt. 1854 in Prag, verstorben am 17. Oktober 1938 in Amsterdam. Studierte 1874 bis 1878 in Wien Geschichte und Philosophie, war 1880–82 in Zürich als Schriftsteller tätig, begründete 1883 die sozialistische Revue »Die Neue Zeit« (Stuttg.), die er 1885–88 von London aus, seit 1890 in Stuttgart redigierte; jetzt lebt er in Berlin. K. schloss sich schon als Student der Sozialdemokratie an. Er ist entschiedener Anhänger von K. Marx und Fr. Engels, deren Ideen er zu verbreiten und weiterzubilden bestrebt ist. Er schrieb neben zahlreichen kleineren Abhandlungen: »Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft« (Wien 1880); »Karl Marx' ökonomische Lehren, gemeinverständlich dargestellt und erläutert« (Stuttg. 1887, 8. Aufl., 1904); »Thomas More und seine Utopie« (das. 1887); »Die Klassengegensätze von 1789« (das. 1889); »Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil erläutert« (5. Aufl., das. 1904); »Der Parlamentarismus, die Volksgesetzgebung und die Sozialdemokratie« (das. 1893); »Die Agrarfrage« (das. 1899,2. Aufl. 1902); »Bernstein und das sozialdemokratische Programm« (das. 1899); »Handelspolitik und Sozialdemokratie« (das. 1901); »Die soziale Revolution« (Berl. 1903). In der »Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen« (Stuttg. 1894 ff.) schrieb er »Die Vorläufer des neuern Sozialismus«, 1. Teil, und den Abschnitt über »Thomas More«.
Terrorismus und Kommunismus
Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde vor fast einem Jahre begonnen, jedoch durch die Revolution des 9. November unterbrochen. Diese stellte mir zunächst andere Aufgaben als theoretische und historische Forschungen. Erst nach Monaten konnte ich zu ihnen zurückkehren, um, wenn auch mit wiederholten Unterbrechungen, meine Schrift fertig zu stellen.
Der Einheitlichkeit der Darstellung war dieser Werdegang nicht günstig. Sie wurde noch erschwert dadurch, daß im Fortgang der Untersuchung das Thema sich ein wenig verschob. Meinen Ausgangspunkt bildete das zentrale Problem des heutigen Sozialismus, die Stellung der Sozialdemokratie zu den bolschewistischen Methoden. Da der Bolschewismus sich mit Vorliebe auf die Pariser Kommune von 1871 beruft als seinen Vorgänger und sein Vorbild, das die Sanktion von Marx erhalten habe, und da die Kommune der heutigen Generation nur wenig mehr bekannt ist, unternahm ich es, eine Parallele zwischen Kommune und Sowjetrepublik zu ziehen.
Um die Kommune verständlich zu machen, mußte ich auf die erste Pariser Kommune, und damit auf die französische Revolution und ihr Schreckensregiment zurückgreifen. Damit ergab sich eine neue Parallele zur Sowjetrepublik, und wurde zur Untersuchung der Kommune die des Terrorismus, seiner Wurzeln und seiner Früchte, hinzugefügt.
So sind es zwei Gedankengänge, die sich in dieser Schrift miteinander verschlingen, von denen der eine gelegentlich vom andern ablenkt. Ich empfand das selbst als störend, und erwog, ob es nicht anginge, die eine Arbeit in zwei getrennte zu zerlegen, eine Darlegung der Kommune und eine Erörterung des Terrorismus gesondert zu geben. Doch stehn im Hinblick auf meinen Ausgangspunkt, die Sowjetrepublik, diese beiden Erscheinungen in so engem Zusammenhange, daß es mir unmöglich erschien, sie getrennt zu behandeln. Ich hoffe, es ist mir trotz der Schwierigkeiten, die sich aus dem Doppelcharakter des Themas ergaben, doch gelungen, die Einheitlichkeit des Aufbaues der Gedanken zu bewahren.
So akademisch den Leser manche meiner Ausführungen anmuten mögen, sie sind alle von höchster Aktualität eingegeben, wie das in einer so wild-gährenden Zeit gar nicht anders möglich ist. Das soll natürlich nicht sagen, daß ich die Wahrheit den Bedürfnissen des Augenblicks angepaßt habe, wohl aber, daß ich überall, auch dort, wo ich in die entfernteste Vergangenheit zurückging, nur jene Seiten hervorhob, die geeignet sind, Licht in das Chaos zu bringen, das uns umtobt.
Betrachtet man nur dieses russische und deutsche Chaos, dann ist der Anblick und Ausblick, den es uns augenblicklich bietet, nicht sehr erfreulich: eine Welt, versinkend in ökonomischem Ruin und scheußlichem Brudermord: hier wie dort Sozialisten in den Regierungen, die gegen andere Sozialisten mit der gleichen Grausamkeit vorgehn, die vor einem halben Jahrhundert das gesamte internationale Proletariat voll verachtungsvoller Entrüstung an den Versailler Schlächtern der Kommune brandmarkte.
Doch der Ausblick wird heller, wenn wir die Internationale betrachten. Die Arbeiter Westeuropas haben sich erhoben, an ihnen liegt es, mit würdigeren Methoden Wirksameres zu erzielen, als es uns bis jetzt im Osten gelang.
Dazu aber ist es notwendig, daß sie von uns lernen, daß sie die verschiedenen Methoden des Kämpfens und des Aufbauens an ihren Ergebnissen erkennen.
Nicht blinde Verherrlichung der bisherigen Methoden der Revolution, sondern ihre strengste Kritik ist notwendig, ist am dringendsten notwendig gerade jetzt, wo die Revolution und die sozialistischen Parteien in ihr eine schwere Krisis durchmachen, in der verschiedene Methoden miteinander um Geltung ringen. Der Erfolg der Revolution wird nicht zum wenigsten davon abhängen, ob es der richtigen Methode gelingt, sich im Proletariat durchzusetzen.
Unsere Methoden zu prüfen, ist heute unsere oberste Pflicht. Bei dieser Prüfung zu helfen und dadurch die Revolution zu fördern, ist die Aufgabe der vorliegenden Schrift.
Charlottenburg, Juni 1919.
K. Kautsky.
1. Revolution und Terrorismus
Bis in weite Kreise der Sozialdemokratie hinein hatte sich in der Zeit vor dem Kriege die Meinung festgesetzt, die Zeit der Revolutionen sei nicht bloß für Westeuropa, sondern auch für Deutschland und Österreich vorüber. Wer anders dachte, wurde als Revolutionsromantiker verhöhnt.
Nun haben wir die Revolution, und sie nimmt Formen von einer Wildheit an, die auch der phantastischste Revolutionsromantiker unter uns nicht erwartet hätte.
Die Aufhebung der Todesstrafe war für jeden Sozialdemokraten eine selbstverständliche Forderung geworden.
Die Revolution aber bringt uns den blutigsten Terrorismus, ausgeübt von sozialistischen Regierungen. Die Bolschewiki in Rußland gingen voran, aufs schärfste deswegen verurteilt von allen Sozialisten die nicht auf dem bolschewistischen Standpunkt standen, darunter auch die deutschen Mehrheitssozialisten. Aber kaum fühlen diese sich in ihrer Herrschaft bedroht, greifen sie zu den Mitteln des gleichen Schreckensregiments, das sie eben noch im Osten gebrandmarkt. Noske tritt kühn in Trotzkys Fußstapfen, allerdings mit dem Unterschied, daß er selbst seine Diktatur nicht als die des Proletariats ansieht. Beide aber rechtfertigen ihre Blutarbeit mit dem Rechte der Revolution.
Es ist in der Tat eine weitverbreitete Auffassung, als gehöre der Terrorismus zum Wesen der Revolution, wer diese wolle, müsse sich mit jenem abfinden. Als Beweis wird immer wieder die große französische Revolution angeführt. Sie gilt als die Revolution par excellence.
Eine Untersuchung des Terrorismus, seiner Bedingungen und Erfolge geht daher am zweckmäßigsten von einer Kennzeichnung des Schreckensregiments der Sansculotten aus. Mit ihr wollen wir beginnen. Das wird uns wohl etwas weitab von der Gegenwart führen, aber doch diese besser verstehen lehren. Es ist ganz auffallend, wie viele Übereinstimmungen zwischen der großen französischen Revolution und den Revolutionen von heute bestehen, namentlich der russischen.
Und dennoch sind die Revolutionen unserer Tage grundverschieden von der des 18. Jahrhunderts. Das zeigt schon eine Vergleichung unseres Proletariats, unserer Industrie, unserer Verkehrsmittel mit den entsprechenden Erscheinungen jener Zeit.
2. Paris
Die jetzige deutsche Revolution hat kein Zentrum, die französische dagegen wurde beherrscht von Paris. Sie und in ihr das Schreckensregiment sind gar nicht zu verstehen ohne Einblick in die ökonomische und politische Bedeutung, die Paris für Frankreich erlangt hatte. Keine Stadt hat im 18. Jahrhundert und noch ins 19. hinein solche Macht geübt wie sie. Das hängt zusammen mit der Bedeutung, die die Residenz, das Regierungszentrum, im modernen bureaukratisch-zentralistischen Staat besitzt, so lange nicht die ökonomische Dezentralisation einsetzt, die der entwickelte industrielle Kapitalismus durch die Entwicklung des Verkehrswesens mit sich bringt.
Im feudalen Staat sind die Machtbefugnisse seines Zentrums, des Monarchen, nur gering, seine Funktionen nicht umfangreich, und dementsprechend auch sein Regierungsapparat klein. Dieser läßt sich sehr wohl von einer Stadt oder Burg in die andere versetzen, und der Monarch ist um so häufiger gezwungen, das zu tun, je weniger das Transportwesen entwickelt ist, je weniger eine einzelne Lokalität, auf ihre eigenen Mittel angewiesen, ausreicht, auf die Dauer das Gefolge des Monarchen zu erhalten, und je häufiger dieser Veranlassung hat, sich in den verschiedenen Teilen seines Gebiets persönlich zu zeigen, weil er sie nur dadurch in Treue und Gehorsam zu erhalten vermag. So wird in jenen Zeiten das monarchische Gewerbe meist im Umherziehen betrieben. Wie der Nomade, sucht der Monarch eine fette Weide nach der andern auf und verläßt sie, wenn sie kahl gefressen ist.
Doch im Laufe der Zeiten wächst der Regierungsapparat, namentlich infolge der Zunahme der Warenproduktion, die die Geldwirtschaft aufkommen läßt, an Stelle schwer transportabler Tribute in Naturalien Steuern setzt, die in leicht transportablem Geld entrichtet werden. Mit dem Ertrag der Steuern wächst die Macht der Monarchen, wächst aber auch ihr Regierungsapparat in Form der Bureaukratie und stehender Armeen. Er verträgt nicht mehr das Wandern. Er muß fixiert werden. Waren von jeher einzelne größere Städte an Knotenpunkten des Handels, im Zentrum des Reiches gelegen, reicher als die kleinen Landstädte, Hauptstädte gewesen, die der Monarch als seinen Wohnsitz bevorzugte, so wurde jetzt eine von ihnen zum ständigen Sitz der Regierung, zur Residenz. Hier nun sammelte sich alles, was mit der Regierung zu tun hatte, hier flossen die Steuern des ganzen Reiches zusammen, und nur ein Teil davon ging wieder ins Reich zurück. Hier setzten sich auch die Lieferanten für Regierung und Hof fest sowie die Geldmenschen, die als Steuerpächter oder Bankiers mit dem Staate Geldgeschäfte machten.
Gleichzeitig wuchs die Macht des Monarchen über den Adel, dessen Selbständigkeit gebrochen wurde. Der Monarch wollte nicht länger dulden, daß der große Adel fern von ihm auf seinen Schlössern weilte. Er sollte an seinen Hof, unter seine persönliche Aufsicht, einzig dem Monarchen dienend, aber nur durch eiteln, unnützen Hofdienst. Seine selbständigen Funktionen in der Verwaltung des Gemeinwesens wurden ihm genommen und den Bureaukraten übertragen, die der Monarch einsetzte und bezahlte. Die Adligen wurden immer mehr zu Drohnen, die nur eine Aufgabe hatten, am Hofe des Monarchen die Einnahmen aus ihren Landgütern zu verzehren. Was sie ehedem auf ihren Burgen und Schlössern inmitten ihrer Hintersassen konsumiert, floß nun in die Residenz, vermehrte deren Reichtum. Dort bauten sie neue Paläste neben denen des Monarchen, dort brachten sie ihre Einnahmen durch in bloßem Genußleben, da ihnen ja alle ernsthaften Funktionen genommen waren. Und die kapitalistischen Parvenus, die neben ihnen aufkamen, suchten es ihnen an Aufwand gleich zu tun.
So wurden die Residenzen im Gegensatz zum flachen Land und den Landstädten – der „Provinz“ – nicht nur zum Zentrum alles Reichtums des Landes, sondern auch zum Zentrum des Genußlebens, das eine starke Anziehungskraft auf jeden im Lande, und mitunter auch auf manchen vom Auslande ausübte, der die Mittel hatte, sich zu vergnügen, oder der über die Neigung und die Fähigkeit verfügte, als Diener oder Dienerin der Freude die nach Lust Begehrenden auszubeuten.
Doch auch ernsthaftere Elemente wurden von der Residenz angezogen. Wenn dem Adel auf seinen Schlössern fast nur die roheren Arten des Zeitvertreibs zu Gebote standen, Fressen, Saufen, Jagen, die Mägde der Umgebung molestieren, so erzeugte die Stadt feinere Sitten und Vergnügungen. Der Adel gewann Interesse an den Künsten, und die Patronisierung der Wissenschaften wurde Mode. So strömten auch Künstler und Gelehrte nach der Residenz, wo sie am ehesten Förderung erhofften. Je mehr die Bourgeoisie in der Residenz erstarkte, desto mehr fanden Schriftsteller und Künstler auch in ihr neben dem Adel einen Markt für ihre Produkte.
Daß dabei zahlreiche Industrielle und Händler angezogen wurden, um den Bedürfnissen aller dieser Elemente zu genügen, ist klar. Nirgends hatte man eher Aussicht, sein Glück zu machen, als in der Residenz. Ihr strömte alles zu, was Geist, Selbstvertrauen und Energie besaß, aus dem ganzen Lande.
Doch nicht jeder erreichte sein Ziel. Zahlreich waren die gescheiterten Existenzen, und sie bildeten ein weiteres Charakteristikum der Hauptstadt, die Massen von Lumpenproletariat, die in der Hauptstadt ihr Fortkommen suchten, weil sie sich dort am ehesten verbergen und am ehesten Wechselfälle des Glücks erwarten durften, deren kecke Ausbeutung ihnen vorwärts helfen sollte – eines Glücks, das sie nicht selten selbst korrigierten, wie jener Riccaut de la Marlinière.
Nicht nur Kunst und Wissenschaft, sondern auch zügelloses Genußleben neben bitterster Armut und zahlreichem Verbrechertum wurden zum Kennzeichen der Residenz.
Ihrer sozialen Eigenart entsprach eine Eigenart des Geistes, der ihre Bevölkerung beseelte. Doch war dieser nicht in allen Residenzen der gleiche. Auch hier schlug die Quantität in die Qualität um.
In einem Kleinstaat oder in einem ökonomisch rückständigen Gemeinwesen war die Residenz eine Kleinstadt, da konnten sich viele der hier gekennzeichneten Charakterzüge nur wenig entwickeln. In einer solchen trat am deutlichsten zu Tage eine Abhängigkeit der Bewohnerschaft vom Hofe, nicht nur eine ökonomische und politische Abhängigkeit, sondern auch eine geistige. Die Gesinnung des Höflings wurde da gröber, plumper, naiver, zur Gesinnung der Bürgerschaft. Das wirkte auf die Landbevölkerung zurück, der das Licht aus der Hauptstadt kam.
Daher jene starke monarchische und servile Gesinnung in Deutschland mit seiner Kleinstaaterei. Eine Gesinnung, die in den Zeiten der Blüte der bürgerlichen Demokratie deren Vorkämpfer so außer sich brachte. Sie veranlaßte Börne zu dem verzweifelten Ausruf: die andern Völker seien Knechte, die Deutschen seien Bediente, ein Gedanke, den Heine spöttischer in dem Satz äußert:
„Deutschland, die fromme Kinderstube, Ist keine römische Mördergrube.“
Anders gestaltete sich der Geist in einer großen Residenz. Je größer die Stadt, um so mehr trat die höfische Bevölkerung an Zahl und Einfluß gegenüber den anderen Elementen zurück, die dort ihr Glück suchten. Desto größer die Zahl der Enttäuschten und Unzufriedenen, desto größer ihre Masse und damit auch ihre Kraft. Das verlieh nicht nur ihnen Mut, sondern auch der Opposition derjenigen, die, ohne persönlich unzufrieden zu sein, die Schäden in Staat und Gesellschaft klar erkannten. Solche Opposition gab es überall. In der kleinen Residenz verbarg sie sich, in der großen durfte sie es wagen, sich zu äußern.
Unter den großen Residenzen des europäischen Festlandes war im 17. und 18. Jahrhundert die größte Paris, die Hauptstadt des damals wichtigsten Staates Europas. Sie zählte am Ende des 18. Jahrhunderts etwa 600 000 Einwohner. Weimar, die Residenzstadt, die damals den geistigen Brennpunkt Deutschlands bildete, rund 10 000!
Schon früh zeichnete sich die Bewohnerschaft von Paris durch ihren rebellischen Geist aus. So erhob sie sich z. B. 1648 in der Bewegung der Fronde, die davon ausging, daß die Regierung mit dem Pariser Parlament, dem obersten Gerichtshof, in Konflikt geriet. Barrikaden wurden gebaut, schließlich mußte der König aus Paris fliehen – 1649, in demselben Jahre, in dem Karl I. von England geköpft wurde. Bis 1652 dauerte der Kampf, in dem sich schließlich die Monarchie zu einem Frieden der Verständigung bequemen mußte, der freilich bald eine Neubefestigung des Absolutismus nach sich zog. Die Hauptstadt hatte sich bei ihrem Kampf mit dem Hochadel verbündet, und das bildete ein zu ungleiches Paar von Bundesgenossen. Und der Hochadel vermochte sich nirgends mehr mit Erfolg gegen das Königtum zu behaupten. Paris besaß daher damals Ludwig gegenüber nicht die gleiche Widerstandskraft wie London gegen Karl.
Der Kampf der Fronde fällt in die Jugend Ludwig XIV. Der Aufstand der Pariser, seine Flucht vor ihnen, machte tiefen Eindruck auf ihn. Um nicht ein zweitesmal die gleiche Demütigung zu erleben, verlegte er seine Residenz aus Paris heraus. Freilich, den Regierungsapparat mußte er dort lassen, aber zum Sitz seines Hofstaates wählte er einen Ort, der nahe genug von Paris war, um eine stete und rasche Verbindung mit der Residenz zu gestatten, und doch weit genug entfernt, um vor einem Straßenaufstand geschützt zu sein. Im Jahre 1672 begann der Bau seiner neuen Residenz, die ihn, oder vielmehr sein Volk, eine Milliarde Francs kosten sollte, in Versailles, 18 Kilometer von Paris entfernt. Es sollte mehrere Male in den kommenden Jahrhunderten zeigen, daß es dem rebellischen Paris zum Trutz erbaut worden war.
So entschieden Paris gegenüber der staatlichen Zentralgewalt oft auftrat, seine Stellung zu ihr war keine ganz einheitliche. Auf der einen Seite strebte es nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit von der Staatsgewalt, und doch beruhte sein Reichtum und seine Kraft auf der Größe des Reiches und auf der Macht der Staatsgewalt im Reiche. Es mußte nach der Autonomie der Gemeinde verlangen und zog doch den größten Gewinn aus der staatlichen Zentralisation, die es selbst schon durch sein bloßes Bestehen förderte.
Was im Laufe des 18. Jahrhunderts die verschiedenen zusammeneroberten Provinzen Frankreichs zu einer festen nationalen Einheit verband, das war vor allem die alle Reichsteile überragende Stellung von Paris. Was hätte wohl den Elsässer mit dem Bretonen verbunden, oder den Flämen von Dünkirchen mit dem Gascogner? Aber sie alle hatten Beziehungen zu Paris, ihre besten Söhne fanden sich dort und verschmolzen dort zu einer einheitlichen Nation. Daß Paris gleichzeitig die stärkste Stütze der zentralisierenden Staatsmacht und ihre kräftigste Opposition bildete, dieser Widerspruch spiegelte sich in der Stellung von Paris zur Provinz. In Paris wurden am ehesten die Schäden und Mißbräuche entdeckt, an denen das Reich krankte. Paris fand am ehesten den Mut, sie bloßzulegen und zu brandmarken. Es gewann am ehesten die Kraft, ihnen zu Leibe zu gehen. So wurde es der Vorkämpfer des ganzen leidenden Frankreich. Die Provinzbewohner, in ihrer Zerstreuung über das Land geistig rückständig, mutlos und kraftlos, sahen in Paris ihren Vorkämpfer, ihren Retter, dessen Führung sie oft begeistert folgten.
Doch nicht immer. Denn dieses selbe Paris wurde groß und stark nicht nur durch die Arbeit seiner Bewohner, sondern auch durch die Ausbeutung der Provinzen, dadurch, daß der Löwenanteil des in den Provinzen geschaffenen Mehrwerts in Paris zusammenströmte, um dort teils verjubelt zu werden, teils zur Akkumulierung von Kapital, zur Bereicherung und zur Kräftigung der Ausbeuter des Landes zu dienen.
So bildete sich neben dem Vertrauen zum fortschrittlichen Paris ein Haß gegen das ausbeutende Paris, ein Gegensatz zwischen der Residenz und der Provinz. Je nach der historischen Situation überwog einmal die eine, ein andermal die andere Seite.
Der ökonomische Gegensatz wurde noch verschärft durch Gegensätze der Anschauungen, die aus der Verschiedenheit des sozialen Milieus hervorgingen. Auf dem flachen Land und in der Provinz fand man ökonomische Stagnation, daher Konservativismus, Festhalten an den überlieferten sittlichen Anschauungen. Auch wer sie nicht anerkannte, mußte sie heucheln, denn in den kleinen Kreisen des Dorfes und der Kleinstadt stand jeder unter der Kontrolle der ganzen Gemeinschaft.
Diese Kontrolle fehlte gänzlich in der Riesenstadt. Da durfte man es wagen, offen den überkommenen Sitten Hohn zu sprechen, und sie wurden von oben und von unten aus attackiert, ebenso vom übermütigen, genußsüchtigen Adel und von kapitalistischen Kreisen, die es ihm gleichtun wollten, wie von den Massen der untersten Schichten, die in ihrem Elend und der steten Unsicherheit ihrer Existenz weder vor den Schranken des Eigentums haltmachten, noch die Bindungen des Familienlebens beachteten. Zwischen ihnen standen breite Schichten von Glücksrittern und Intellektuellen, oft in gleichem Elend, gleicher Unsicherheit der Existenz, wie die Lumpenproletarier, aber zugelassen zum Anteil an dem Genußleben des Residenzadels und der großen Geldmenschen.
Kein Wunder, daß die biederen Kleinstädter und Bauern ebensosehr die krasse Sittenlosigkeit des Seinebabels verabscheuten, wie die witzigen Pariser das öde Philistertum und die bornierten Vorurteile der Provinzler verlachten.
Und wie in der Moral, zeigte sich der gleiche Gegensatz in der Religion. Für den Bauern in seiner Weltabgeschiedenheit war der Geistliche der einzige Intellektuelle, der sich um ihn kümmerte, der seinen Verkehr mit der Außenwelt vermittelte, der ihm ein den Bereich seines Kirchturmhorizontes überschreitendes Wissen beibrachte. Daß dieses Wissen längst durch die Entwicklung der Wissenschaften überholt war, davon konnten die Analphabeten des flachen Landes keine Vorstellung gewinnen. Sie hingen an Kirche und Religion, jedoch zeigten sie Respekt nur vor deren geistigen Schätzen. Sich den Grundbesitz der Kirche anzueignen, trugen sie keine Bedenken.
Für die Pariser dagegen waren die Kirchengüter weniger wichtig, als die Herrschaftsstellung der Kirche und die Anschauungen der Religion.
Wenn im Mittelalter die Kirche das Mittel wurde, die Wissenschaft zu erhalten, so war seit der Renaissance die städtische unkirchliche Wissenschaft längst über die kirchliche hinausgegangen. Den Städtern erschien die Kirche nicht mehr als ein Mittel, Wissen zu verbreiten, sondern als eines, diese Verbreitung zu hindern. Der Gegensatz wurde verschärft durch die Versuche der geistlichen Intellektuellen, sich der Konkurrenz der weltlichen Intellektuellen, der sie sich immer weniger gewachsen fühlten, durch staatliche Zwangsmaßregeln zu erwehren. Die weltlichen antworteten mit den schärfsten geistigen Waffen, mit vernichtendem Hohn, wie mit gründlichster wissenschaftlicher Forschung, und sie führten den Kampf gegen die Kirche um so eher und lieber, als sie dabei unter Umständen, wenn sie vorsichtig vorgingen, die Unterstützung oder wenigstens die Neutralität der herrschenden Aristokraten und Bureaukraten gewannen. Diese verlachten nicht nur die Lehren der überlieferten Religion, ihnen wurde die katholische Kirche auch oft unbequem, weil sie sich dem staatlichen Herrschaftsapparat nicht widerspruchslos eingliedern wollte. Der Kampf gegen die Kirche war also weniger gefährlich, als der gegen den Absolutismus, und wurde von der auftauchenden Opposition im Staate früher aufgenommen.
Aber auch hier finden wir eine gewisse Zwiespältigkeit. Die regierenden Schichten widersetzten sich der Kirche, wo diese als selbständige Organisation auftreten wollte, aber sie erschien ihnen unentbehrlich als Mittel, die unteren Klassen zu beherrschen. Dieser Zwiespalt machte sich bis weit in die Kreise der oppositionellen Intellektuellen hinein bemerkbar. Voltaire prägte das Wort: „Ecrasez l’infame – zerschmettert die infame (Kirche)“, aber er fand, dem Volke müsse die Religion erhalten bleiben.
Ein ähnlicher Zwiespalt machte sich auch in den unteren Schichten der Pariser Bevölkerung und ihrer Wortführer geltend. Freilich, sie alle bekämpften die Kirche, wollten von ihr nichts wissen. Aber entsprechend der Klassenlage des Proletariats, die stets zu rücksichtslosem Ziehen der letzten Konsequenzen, zu radikalen Lösungen drängt, propagierten die einen den weitestgehenden Atheismus und Materialismus. Andere dagegen fühlten sich von diesen Denkweisen abgestoßen, weil es die der aristokratischen und kapitalistischen Ausbeuter – notabene der vorrevolutionären Zeit – waren. Der Gegensatz zwischen gottgläubigen und atheistischen Sozialisten erhielt sich in Frankreich bis ins 19. Jahrhundert. Noch Louis Blanc stellt sich in seiner Geschichte der französischen Revolution ganz auf die Seite Rousseaus und Robespierres, die im Gegensatz zu den Atheisten Diderot und Anacharsis Cloots am Gottesglauben festhielten:
„Sie begriffen, daß der Atheismus die Unordnung unter den Menschen heiligt, indem er die Anarchie im Himmel voraussetzt.“ (Ausgabe Brüssel, 1847, I, S. 124)
Louis Blanc übersah, daß für den Atheisten der Himmel ebensowenig existiert wie der Herrgott.
Wie die direkten Klassengegensätze, mußten auch alle diese Widersprüche und Gegensätze durch eine so riesenhafte Erschütterung, wie die große Revolution, zeitweise zu den schärfsten Konflikten führen.
3. Die große Revolution
Ludwig XIV., derselbe, der aus Furcht vor den Parisern Versailles zu seiner Residenz wählte, vermochte die letzten Selbständigkeitsgelüste des Adels zu brechen und wurde stark genug, im Kampfe gegen alle seine Nachbarn sein Königreich zum größten und stärksten Staate Europas zu machen. Doch erreichte er das nur durch eine Reihe von Kriegen, die Frankreich völlig erschöpften und an den Rand des Abgrundes brachten.
Sein letzter Krieg, der spanische Erbfolgekrieg, der von 1701 bis 1714 dauerte, und ohne Erfolg für Frankreich endete, hätte schon eine Revolution herbeigeführt, wenn eine starke revolutionäre Klasse vorhanden gewesen wäre. Die Erbitterung gegen den Monarchen war ungeheuer. Das zeigte sich bei seinem Tode, 1715.
„Sein Leichenbegängnis wird auf das einfachste veranstaltet, um ‚die Kosten und die Zeit zu sparen‘; das Volk von Paris, das sich von unerträglichem Joche befreit glaubt, verfolgt den Sarg des ‚großen Königs‘ bei der Fahrt durch die Straßen nicht allein mit Schimpfreden und Flüchen, sondern mit Schmutz- und Steinwürfen. Rings, in der Provinz erhob sich ein mit Verwünschungen gegen den Verstorbenen gemischter Freudenschrei, überall wurden Dankgebete gehalten, das Glück, von diesem Despoten erlöst zu sein, zeigte sich offen und ohne Scheu. Frieden, freie Bewegung, Verminderung der Steuern erhoffte man von dem Regenten.“ (M. Philippson, Das Zeitalter Ludwigs XIV., S. 518)
Das Volk von Frankreich mußte noch bittere Erfahrungen mit den Nachfolgern des „Königs Sonne“ machen, ehe es daran ging, in der großen Revolution seine Geschicke in die eigene Hand zu nehmen.
Kaum begann das Land sich einigermaßen zu erholen, so wurde es in neue Kriege gestürzt. 1733–35 hatte es Krieg mit Österreich um Polens und Lothringens willen zu führen, von 1740–48 nahm es am österreichischen Erbfolgekrieg an der Seite Preußens gegen Maria Theresia und England teil, 1756–63, im Siebenjährigen Kriege, kämpfte es an der Seite Maria Theresias gegen Preußen und England, 1778–83 führte es Krieg gegen England zur Unterstützung des Unabhängigkeitskampfes der Vereinigten Staaten.
Diese Kriege ruinieren nicht bloß das Land, sie werden zumeist elend geführt, schaffen ihm nicht einmal Kriegsruhm (Roßbach!).
Der Absolutismus hatte mit Hilfe der aufstrebenden Bourgeoisie den Feudaladel niedergeworfen, aber nicht, um ihn zu beseitigen, sondern um ihn unumschränkt zu beherrschen. Der Monarch fühlte sich als seine Spitze, der Adel war ihm unentbehrlich, er wählte mit Vorliebe aus den Kreisen des ihm ergebenen Hofadels die Leiter der Staatspolitik und der Armeen, während er denselben Adel gleichzeitig seiner Selbständigkeit beraubte, ihn zu bloßem Genußleben degradierte, daher moralisch wie geistig verkommen ließ und seinem ökonomischen Ruin entgegenführte.
Je offenkundiger der moralische, intellektuelle, ökonomische Bankerott des Adels, desto höher seine Ansprüche an seine Bauern, desto maßloser deren Bedrückung und Auspowerung, desto mehr verkam ihre Landwirtschaft, die ökonomische Grundlage des Staates. Gleichzeitig wuchsen aber auch dessen Ansprüche an die unglücklichen Bauern als die Hauptsteuerträger, denn die Adligen, nicht zufrieden, den Staat durch ihre Diplomatie und Kriegführung zu ruinieren, suchten auch durch dessen Plünderung sich für den ökonomischen Niedergang ihrer Besitzungen schadlos zu halten. Sie fanden dabei die Unterstützung der Monarchie und der Kirche, die den größten Grundbesitzer im Staate darstellte.
Diesen verzweifelten Zuständen stand Paris gegenüber mit einer starken, rasch emporstrebenden Bourgeoisie, mit einer zahlreichen Intelligenz, die schärfer die Übel der Staats- und Gesellschaftsordnung erkannte, sie schonungsloser brandmarkte, vernichtender geißelte, als es die Intellektuellen einer anderen Großstadt Europas vermochten. Und unter ihnen ein Kleinbürgertum, das kraftvollste und selbstbewußteste Europas, und ein Proletariat, wie es massenhafter, konzentrierter, verzweifelter nirgends zu finden war.
Ein furchtbarer Konflikt wurde unvermeidlich, sobald diese Gegensätze einmal aufeinanderprallten.
Er brach aus, als schließlich das Königtum nicht mehr weiter konnte, als seine Verschuldung so angewachsen war, daß ihm der finanzielle Zusammenbruch drohte, kein Finanzmann mehr ihm Kredit schenken wollte.
Die feudalen Reichsstände, die seit 1614 nicht zusammengetreten waren, eine ständische Vertretung des Adels, der Geistlichkeit, der bürgerlichen Menge, sollten helfen, sollten neue Steuern und Anleihen bewilligen und damit den Kredit des bankerotten Absolutismus heben, ihm seine Existenz weiterfristen. Die Wahlen für die einzelnen Stände wurden 1789 ausgeschrieben und die Erwählten an den Sitz des Königs, nach Versailles, einberufen.
Doch außer den Höflingen waren alle Klassen zu erbittert gegen das herrschende System. Die Stände machten sich nach ihrem Zusammentritt, 5. Mai 1789, sofort daran, ihm nicht neue Steuern und Anleihen zu bewilligen, sondern es zu reformieren. Darunter verstanden freilich Adel und Geistlichkeit etwas anderes als die Bourgeoisie. Diese siegte im feindlichen Zusammenstoß der Stände. Die Generalstände wurden zu einer konstituierenden Nationalversammlung, die Frankreich eine neue Verfassung gab.
Die Macht der Nationalversammlung war zunächst nur eine moralische: sie beruhte in dem Bewußtsein, daß die ungeheure Mehrheit der Nation hinter ihr stand. Doch das schützte sie noch nicht gegen einen Staatsstreich physischer Gewalt. Noch verfügte die Monarchie über eine solche, über das Heer, und sie war willens, sie zu gebrauchen.
Aber sie mußte sich der Fronde erinnern, der physischen Gewalt, über die Paris verfügte. Nur wenn man mit Paris fertig wurde, durfte man hoffen, die Nationalversammlung auseinanderjagen oder beugen zu können. Daher wurden zahlreiche Truppen in Paris zusammengezogen, und als man dadurch gesichert zu sein glaubte, erfolgte der Staatsstreich, die Entlassung des Ministers Necker, den die Nationalversammlung dem König aufgedrängt hatte (12. Juli 1789).
Nahm Paris das ruhig hin oder wurde es im Kampfe mit den Truppen geschlagen, dann war einstweilen das Schicksal der Revolution besiegelt. Aber Paris erhob sich, die Truppen des Königs versagten, die proletarischen und kleinbürgerlichen Massen erbrachen das Invalidenhaus, entnahmen ihm 30.000 Gewehre, und erstürmten die Zwingburg, die vor den revolutionären Vorstädten lag, die Bastille (14. Juli 1789).
Nun knickten der König und seine Höflinge zusammen, nun aber empörte sich auch die Bauernschaft im ganzen Lande. Schon vorher hatte es vereinzelte bäuerliche Unruhen gegeben, die leicht niedergeschlagen wurden. Dem allgemeinen Sturm, der sich jetzt erhob, vermochte keine Macht zu widerstehen. Paris hat damals die Revolution gerettet und zu einer allgemeinen gemacht.
Doch allmählich schien sich der Sturm wieder zu legen. Der König und sein feudaler Anhang faßten wieder Mut, er begann, sich gegen Beschlüsse der Nationalversammlung ablehnend zu verhalten und von neuem Truppen zusammenzuziehen. Da kamen die Pariser zur Überzeugung, sie seien nicht sicher, so lange die Häupter des Staates, König und Nationalversammlung, in Versailles weilten. Sie wollten sie direkt unter ihre Aufsicht und ihren Einfluß bringen. Am 5. Oktober 1789 zogen große Volksmassen aus der Hauptstadt nach Versailles und holten den König zu sich.
Nun hoffte das Volk, Ruhe zu haben, sich ungestört dem Ausbau der Verfassung und praktischer Arbeit hingeben zu können, von der es unter den neuen Verhältnissen gesicherten Wohlstand erwartete. Am 14. Juli 1790 schwor Ludwig XVI. der neuen Verfassung Treue. Aber sehr mit innerem Widerstreben. Er fühlte sich in den Tuilerien gefangen, alle Akte seiner Regierung waren ihm in der Seele zuwider.
Noch war kein Jahr seit seinem Schwur auf die Verfassung vorüber, da entfloh er heimlich (21. Juni 1791), und er war unvorsichtig genug, ehe er sich in Sicherheit befand, die Volksmasse über sich aufzuklären. Er hinterließ eine Schrift, in der er alle seine Erlasse seit dem Oktober 1789 für erpreßt und ungültig erklärte. Das war sehr voreilig von ihm, denn er wurde auf der Flucht erkannt, festgenommen und wieder nach Paris zurückgebracht.
Bereits damals forderte ein großer Teil der erbitterten Masse der Pariser die Absetzung des Königs, doch saß die monarchistische Tradition noch zu tief in der Gesamtmasse des Volkes, als daß dieser Schritt schon gelungen wäre. Er hätte Ludwig zum Heile gereicht. Damals drohte ihm nur Absetzung.
Schlimmer gestaltete sich sein Los, als Frankreich unter seinem Königtum in Krieg mit den verbündeten Monarchen Europas geriet (April 1792). Das war kein Krieg nach Art der bisherigen, um mehr oder weniger Land. Es war ein Krieg des Feudaladels und des Absolutismus Europas gegen ein Volk, das sich befreit hatte, und das nun wieder unterjocht werden sollte, ein wahrer Bürgerkrieg, mit all der Grausamkeit, die Bürgerkriege kennzeichnet. Der Landesfeind drohte dem revolutionären Volke völlige Vernichtung an, und der Verbündete des Landesfeindes war der eigene König.
In dieser Situation verlor der monarchische Gedanke rasch seine Kraft, trotzdem konnte sich die Nationalversammlung noch nicht entschließen, ihn preiszugeben. Wieder waren es die Pariser, die es erzwangen, daß Ludwig gefangengenommen und eine neue Nationalversammlung einberufen wurde, der Konvent genannt, die Frankreich eine neue, republikanische Verfassung geben sollte (10. August 1792). In seiner ersten Sitzung beschloß der Konvent mit Einstimmigkeit die Abschaffung des Königtums (21. September 1792).
Doch die Pariser glaubten die Republik nicht gesichert, so lange Ludwig XVI. noch lebte. Sie verlangten, daß ihm der Prozeß wegen Landesverrats gemacht wurde. Davor schreckte die Mehrheit des Konvents zurück. Doch wurde die Wut der Pariser unwiderstehlich, als sie erfuhren, daß ein Geheimschrank in den Tuilerien entdeckt worden sei, in dem Ludwig eine Reihe von Dokumenten versteckt hatte. Diese Dokumente bezeugten, daß der König eine Reihe von Parlamentariern, darunter Mirabeau, gekauft hatte, daß er mit dem Landesfeind Verbindungen unterhielt, daß ein Teil seiner Garden, die in den Reihen der Österreicher gegen Frankreich fochten, auch während des Krieges noch von ihm ihren Sold bezogen hatten.
Trotzdem suchte eine Fraktion des Konvents den König zu retten. Sie wollte an das Volk von Frankreich appellieren; durch eine Volksabstimmung sollte Ludwigs Schicksal entschieden werden.
Dieser Versuch, die Provinz gegen Paris auszuspielen, begegnete dem energischsten Widerstand der Pariser. Die Furcht vor ihnen überwog schließlich im Konvent. Die Befragung des Volkes wurde mit 423 gegen 276 Stimmen abgelehnt. Damit war Ludwigs Schicksal entschieden, am 21. Januar 1793 bestieg er das Schafott.
Diejenige Partei der Republikaner, die sich am meisten für den König einsetzte, waren die sogenannten Girondisten, die ihren Namen daher hatten, daß diejenigen Abgeordneten; die den ersten Kern der Partei bildeten, im Departement der Gironde (Südfrankreich) gewählt worden waren. Sie wurden die wütendsten Hasser von Paris, dessen Vormachtstellung sie aufheben wollten. Frankreich sollte ein Föderativstaat werden.
„Vier Tage nach der Eröffnung des Konvents wiederholt der Girondist Lasource unter dem Beifall seiner Parteigenossen die Worte: Ich will nicht, daß Paris, von Intriganten geleitet, das für Frankreich werde, was Rom einst für das römische Reich gewesen ist. Der Einfluß von Paris muß auf den 83. Teil reduziert werden, auf den Anteil, den jedes andere Departement auch hat.“ (Cunow, Die Parteien der großen französischen Revolution, S. 349)
Der Gegensatz zwischen den Girondisten und Paris nahm schließlich die wildesten Formen an. In den Aufständen vom 31. Mai bis 2. Juni 1793 setzten die Pariser beim Konvent die Ausstoßung und Verhaftung von 34 Girondisten durch. Die Antwort bildete die Ermordung Marats durch die Girondistin Charlotte Corday aus der Normandie (13. Juli) und bald der Versuch der Girondisten, die Normandie, die Bretagne und Südfrankreich zur Empörung gegen den Konvent aufzurufen – mitten im Kriege. Daraufhin blieben wieder die Pariser die Antwort nicht schuldig und setzten die Hinrichtung der in Paris befindlichen Girondisten durch (31. Oktober).
4. Die erste Pariser Kommune
a) Das Pariser Proletariat und seine Kampfmittel
Wir haben bisher immer von den „Parisern“ gesprochen. Natürlich ist darunter nicht die ganze Bevölkerung von Paris zu begreifen, die ja in sehr gegensätzliche Klassen zerfiel. Unter den Parisern war die große Masse der Bevölkerung der Hauptstadt zu verstehen, Kleinbürger und Proletarier.
Bei den letzteren haben wir freilich nicht an moderne, großindustrielle Proletarier zu denken. Wohl gab es einige Manufakturen in Paris, aber der größte Teil seiner Arbeiterschaft war entweder mit Diensten mannigfachster Art beschäftigt, als Handlanger und Lastträger, oder sie waren Handwerksgesellen, die selbst einmal selbständige Handwerker werden wollten. Daneben gab es zahlreiche kleine Handwerker und Heimarbeiter sowie Zwischenhändler aller Art, die in bitterster Armut und quälendster Unsicherheit lebten.
Diese Armut und Unsicherheit machte ihre soziale Lage zu einer proletarischen, aber ihrer Klassenlage, das heißt, den Quellen ihres Einkommens nach waren sie Kleinbürger, eine behagliche, kleinbürgerliche Existenz ihr Ideal. Nichts irreführender, als das Verwechseln der Einkommenslage mit der Klassenlage, wie es Lassalle tat und wie es jetzt diejenigen unserer russischen Genossen tun, die glauben, der arme Bauer hätte andere Klasseninteressen als der wohlhabende Bauer, und er hätte die gleichen Klasseninteressen, wie das Lohnproletariat der Städte. Das ist ebenso falsch wie die Rechnung derjenigen, die glauben, die kleinen Kapitalisten hätten andere Klasseninteressen als die großen, und ihr Gegensatz gegen das Finanzkapital falle mit dem Klassengegensatz des Proletariats gegen das Kapital zusammen. Die kleinen Kapitalisten wollen große werden, die kleinen Bauern wollen auch ihren Besitz vergrößern, das und nicht eine sozialistische Gesellschaft ist ihr Ziel. Die einen wie die andern wollen ihr Einkommen vergrößern auf Kosten der Arbeiter, jene durch niedere Löhne und lange Arbeitszeit, diese durch hohe Preise der Lebensmittel.
So waren auch die armen Schichten von Paris zur Zeit der großen Revolution ihrer Klassenlage nach Kleinbürger, trotz ihrer proletarischen Existenzbedingungen. Diese gaben ihnen keine Ziele, die von denen der bessergestellten Kleinbürger verschieden waren, wohl aber legten sie ihnen Methoden des Kampfes nahe, die den wohlhabenderen Kleinbürgern weniger sympathisch waren.