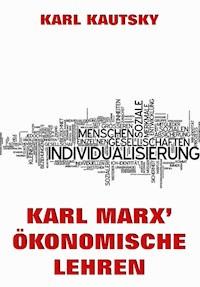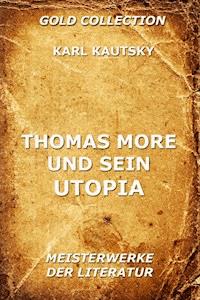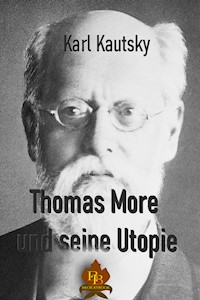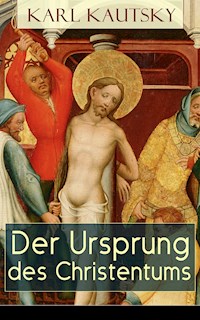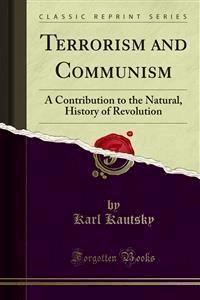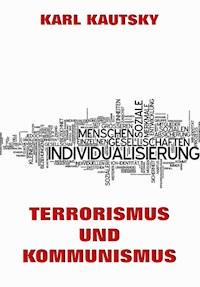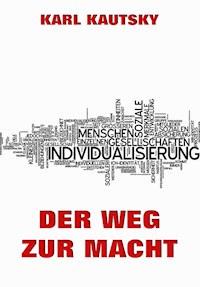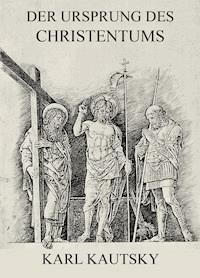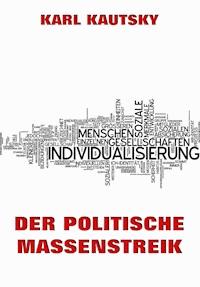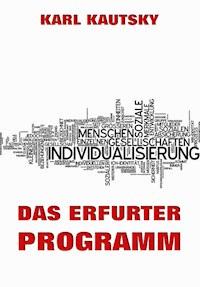
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach dem Fall des Sozialistengesetzes 1890 kehrte Kautsky nach Deutschland zurück und lebte von 1890 bis 1897 in Stuttgart, wo Die Neue Zeit erschien. 1891 bereitete er zusammen mit August Bebel und Eduard Bernstein das Erfurter Programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) vor. Inhalt: Vorwort zur ersten Auflage Vorrede zur fünften Auflage I. Der Untergang des Kleinbetriebs II. Das Proletariat III. Die Kapitalistenklasse IV. Der Zukunftsstaat V. Der Klassenkampf
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Erfurter Programm
Karl Kautsky
Inhalt:
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Das Erfurter Programm
Vorwort zur ersten Auflage
Vorrede zur fünften Auflage
I. Der Untergang des Kleinbetriebs
1. Kleinbetrieb und Privateigentum
2. Ware und Kapital
3. Die kapitalistische Produktionsweise
4. Der Todeskampf des Kleinbetriebs
II. Das Proletariat
1. Proletarier und Handwerksgeselle
2. Der Arbeitslohn
3. Die Auflösung der Proletarierfamilie
4. Die Prostitution
5. Die industrielle Reservearmee
6. Die wachsende Ausdehnung des Proletariats: Das kaufmännische und das „gebildete“ Proletariat
III. Die Kapitalistenklasse
1. Handel und Kredit
2. Arbeitsteilung und Konkurrenz
3. Der Profit
4. Die Grundrente
5. Die Steuern
6. Das Sinken des Profits
7. Das Wachstum der Großbetriebe. Die Kartelle
8. Die wirtschaftlichen Krisen
9. Die chronische Überproduktion
IV. Der Zukunftsstaat
1. Soziale Reform und Revolution
2. Privateigentum und genossenschaftliches Eigentum
3. Die sozialistische Produktion
4. Die wirtschaftliche Bedeutung des Staats
5. Der Staatssozialismus und die Sozialdemokratie
6. Der Aufbau des Zukunftsstaates
7. Die „Abschaffung der Familie“
8. Die Konfiskation des Eigentums
9. Die Verteilung der Produkte im „Zukunftsstaat“
10. Der Sozialismus und die Freiheit
V. Der Klassenkampf
1. Der Sozialismus und die besitzenden Klassen
2. Gesinde und Bediententum
3. Das Lumpenproletariat
4. Die Anfänge des Lohnproletariats
5. Die Erhebung des Lohnproletariats
6. Der Widerstreit der das Proletariat erhebenden und der es herabdrückenden Tendenzen
7. Die Philanthropie und die Arbeiterschutzgesetzgebung
8. Die Gewerkschaftsbewegung
9. Der politische Kampf
10. Die Arbeiterpartei
11. Die Arbeiterbewegung und der Sozialismus
12. Die Sozialdemokratie – die Vereinigung von Arbeiterbewegung und Sozialismus
13. Die Internationalität der Sozialdemokratie
14. Die Sozialdemokratie und das Volk
Das Erfurter Programm, Karl Kautsky
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849629038
www.jazzybee-verlag.de
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Sozialistischer Schriftsteller, geb. 16. Okt. 1854 in Prag, verstorben am 17. Oktober 1938 in Amsterdam. Studierte 1874 bis 1878 in Wien Geschichte und Philosophie, war 1880–82 in Zürich als Schriftsteller tätig, begründete 1883 die sozialistische Revue »Die Neue Zeit« (Stuttg.), die er 1885–88 von London aus, seit 1890 in Stuttgart redigierte; jetzt lebt er in Berlin. K. schloss sich schon als Student der Sozialdemokratie an. Er ist entschiedener Anhänger von K. Marx und Fr. Engels, deren Ideen er zu verbreiten und weiterzubilden bestrebt ist. Er schrieb neben zahlreichen kleineren Abhandlungen: »Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft« (Wien 1880); »Karl Marx' ökonomische Lehren, gemeinverständlich dargestellt und erläutert« (Stuttg. 1887, 8. Aufl., 1904); »Thomas More und seine Utopie« (das. 1887); »Die Klassengegensätze von 1789« (das. 1889); »Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil erläutert« (5. Aufl., das. 1904); »Der Parlamentarismus, die Volksgesetzgebung und die Sozialdemokratie« (das. 1893); »Die Agrarfrage« (das. 1899,2. Aufl. 1902); »Bernstein und das sozialdemokratische Programm« (das. 1899); »Handelspolitik und Sozialdemokratie« (das. 1901); »Die soziale Revolution« (Berl. 1903). In der »Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen« (Stuttg. 1894 ff.) schrieb er »Die Vorläufer des neuern Sozialismus«, 1. Teil, und den Abschnitt über »Thomas More«.
Das Erfurter Programm
in seinem grundsätzlichen Teil erläutert
Vorwort zur ersten Auflage
Gelegentlich der Diskussionen über den Entwurf des neuen Programms der Sozialdemokratischen Partei schlug ich in der Neuen Zeit vor, es solle ein populärer Kommentar zum Programm verfaßt werden, der dessen kurze nackte Sätze weiter ausführe, begründe und erläutere.
Aufgefordert, meinen Vorschlag selbst durchzuführen, machte ich mich ans Werk, fand aber bald, daß es geradezu unmöglich sei, in dem engen Rahmen eines Manifests, wie ich geplant, eine umfassende und gemeinverständliche Darstellung aller der Grundsätze zu geben, die für die Beurteilung unserer Partei in Frage kommen. Ich hätte mich entweder darauf beschränken müssen, sie kurz zu kennzeichnen, und dann im besten Fall einen dürftigen Abklatsch des „Kommunistischen Manifests“ liefern können, der gleich diesem zu seinem Verständnis bereits gewisser ökonomischer und historischer Vorkenntnisse bedurfte. Oder ich hätte mich auf die Erörterung einiger weniger Hauptsätze beschränken müssen, wie ich auch in einer Broschüre getan, die gleichzeitig mit vorliegendem Büchlein erscheint.
Aber diese erfüllt für sich allein nicht den Zweck, den mein Vorschlag im Auge gehabt. Neben kurzen Broschüren, welche die Massen auf unsere Bestrebungen aufmerksam machen, brauchen wir eine Art Katechismus der Sozialdemokratie, einen Leitfaden für denjenigen, der sich mit ihrem Gedankengang vertrauter machen will, sowie einen Leitfaden für den Agitator, der andere in diesen Gedankengang einführen soll. Eine derartige Schrift fehlt bisher unserer Literatur. Alle die Werke der deutschen sozialistischen Literatur, die den Umfang einer Broschüre überschreiten, sind Monographien, von denen jede nur eine oder mehrere, aber keineswegs alle Seiten des modernen Sozialismus behandelt. Allerdings ist diese Literatur bereits so umfangreich, daß sie eine allseitige Erfassung unserer Prinzipien ermöglicht. Wer z. B. das Kapital von Marx, ferner die Schriften von Engels über die Lage der arbeitenden Klasse in England, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft und über den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, dann Bebels Die Frau und der Sozialismus sowie endlich das schon erwähnte Kommunistische Manifest, dessen Gedankengang sich wie ein roter Faden durch alle diese Werke zieht , gelesen und begriffen hat, der muß bereits imstande sein, die Gedankenwelt des modernen Sozialismus nach allen Seiten zu erfassen.
Aber das Lesen aller dieser Bücher, namentlich des Kapital, ist nicht jedermanns Sache, und es fehlte bisher ein Zwischenglied zwischen den Broschüren und den Spezialwerken der sozialistischen Literatur, es fehlt eine populäre und dabei doch eingehendere zusammenfassende Darlegung und Begründung der gesamten Grundsätze der Sozialdemokratie.
Vorliegende Schrift macht den Versuch, diese Lücke auszufüllen. An der Hand des Erfurter Programms will sie in allgemeinverständlicher Weise jede Seite der sozialistischen Ideenwelt, die wesentlich und für das Verständnis der Sozialdemokratie von Bedeutung ist, zur Darstellung bringen. Es handelt sich hier selbstverständlich nicht um eine systematische, wissenschaftliche Grundlegung, sondern in erster Linie um das Erschließen des Verständnisses für die praktische Tätigkeit der Sozialdemokratie. Daher sind die allgemeinen grundlegenden Theorien nur kurz berührt, nur die Resultate der Forschung ohne Begründung und Auseinandersetzung gegeben worden. Ein näheres Eingehen auf diese Theorien ist Sache des Spezialstudiums. Dagegen wird eine Reihe näherliegender Einzelfragen, die augenblicklich lebhaft diskutiert werden, eingehender erörtert, so der Untergang des Kleinbetriebs, die Kartelle, die Überproduktion, das Verhältnis der Arbeiterklasse zur politischen und gewerkschaftlichen Tätigkeit usw., namentlich aber die Frage des „Zukunftsstaates“.
Im ganzen und großen bietet vorliegende Schrift schon ihrer Anlage nach nur eine Übersicht der in den grundlegenden Werken der sozialdemokratischen Literatur bereits niedergelegten Ideen. Aber eben diese umfassende Anlage machte es auch hin und wieder notwendig, Gebiete zu berühren, die von unserer Parteiliteratur noch nicht oder nicht in dem Zusammenhange wie hier behandelt worden sind. Wir hoffen daher, daß in dieser Schrift nicht nur jene Leser, die unserer Partei bisher ferne gestanden, sondern auch diejenigen, die unsere Literatur kennen, manchen neuen Gedanken finden werden.
Zum Schlusse erfülle ich die angenehme Pflicht, meinem lieben Freund und Mitarbeiter Eduard Bernstein an dieser Stelle für die Förderung zu danken, die er dieser wie mancher anderen meiner Arbeiten durch seine Ratschläge und die kritische Durchsicht des Manuskripts zuteil werden ließ.
Stuttgart, im Juni 1892
K. Kautsky
Vorrede zur fünften Auflage
Vor einem Dutzend Jahren erschien die erste Auflage dieser Schrift. Seitdem hat sich Manches verändert in den Dingen und den Köpfen, so sehr, daß hier und da in der Sozialdemokratie selbst die Frage auftauchte, ob ihr Programm und daher auch dieser Kommentar dazu nicht schon veraltet und mit den Tatsachen unvereinbar geworden sei.
Kein Zweifel, daß die früheren Auflagen der vorliegenden Schrift in manchen Punkten veraltet sind, aus formellen Gründen, weil sie sich auf Material stützen, das durch neue Tatsachen und neue Mittheilungen überholt ist. Namentlich darin sind sie veraltet, daß sie ihre statistischen Illustrationen meist aus der Berufszählung von 1882 holten, die seitdem durch die von 1895 ganz in den Hintergrund gedrängt wurde. Ich habe in der neuen Auflage selbstverständlich an Stelle der alten neuere Ziffern gesetzt.
Aber nicht bloß die Illustrationen des Gedankenganges, nein, dieser selbst soll völlig veraltet und als unrichtig erwiesen sein, so daß für die Sozialdemokratie eine wesentliche Änderung ihres Programms gefordert wird.
Ich habe auch daraufhin die vorliegende Schrift genau geprüft, aber nichts von Belang zu ändern gefunden, außer in einem Punkte, auf den ich noch zu sprechen kommen werde. Alle die Kritiken der „Verelendigungs-“ und der „Katastrophentheorie“ haben mich nicht veranlaßt, ein Iota zu ändern, schon deshalb nicht, weil in meiner Schrift weder von der einen noch von der anderen dieser „Theorien“ die Rede ist. Es sind Theorien, die man erst einige Jahre nach der Abfassung des Erfurter Programms trotz aller Proteste in dieses hineingelesen hat. Gerade zur Zeit der Entstehung des Erfurter Programms war die Wahrscheinlichkeit, daß das Proletariat ohne Katastrophe in manchen Ländern, zum Beispiel England, die politische Macht erobere, größer, als heute. Marx selbst hatte für England die Möglichkeit einer friedlichen Entwicklung zugegeben. Wenn er für die Großstaaten des europäischen Festlandes an diese Möglichkeit nicht glaubte, lag das nicht an irgend einer besonderen Katastrophentheorie, sondern an der Einsicht in den besonderen Charakter der Staatsgewalt auf dem Festland Europas. Damit war noch keine Katastrophentheorie gegeben, ebensowenig wie die Tatsache, daß man das Herausziehen eines Gewitters konstatiert, eine Theorie des Gewitters gibt. Da meine Schrift nur die prinzipiellen Grundlagen der Anschauungen der Sozialdemokratie, nicht die Grundlagen ihrer Taktik für bestimmte Fälle entwickelt, hatte ich gar keine Ursache, hier irgend eine Katastrophentheorie auszustellen und zu verfechten.
Und ebensowenig hatte ich eine Theorie der Verelendung zu entwickeln. Zur Zeit der Abfassung des Erfurter Programms waren die konsequenten Marxisten schon längst einig darüber, daß die Emanzipation des Proletariats nicht durch das steigende Elend, sondern durch den wachsenden Klassengegensatz und den daraus entspringenden Klassenkampf des Proletariats herbeigeführt werde. Gerade in dieser Überwindung der dem vormarxistischen Sozialismus eigenen Theorie der Verelendung der Massen durch die Theorie des Klassenkampfes sahen wir damals schon eine der größten Errungenschaften des Marxismus. Die Erkenntnis der dem Kapital naturnotwendig innewohnenden Tendenz, die Summe des Elends, des Druckes, der Ausbeutung zu vermehren, war von diesem Standpunkt aus wichtig, weil diese Tendenz die Notwendigkeit der stetigen Ausdehnung und Verschärfung des Klassenkampfes begreifen ließ. Aber es fiel Niemand unter uns ein, die Notwendigkeit einer zunehmenden Verkommenheit des Proletariats daraus zu folgern. Die Verelendungstheorie spielt in dieser Schrift über das Erfurter Programm keine Rolle. Ebensowenig wie wegen der Katastrophentheorie brauchte ich ihretwegen auch nur einen Satz zu „revidiren“.
Neben diesen beiden Theorien wurde noch lebhaft angezweifelt eine Theorie, die Marx wirklich aufgestellt, seine Krisentheorie. Diese Theorie war aufgebaut auf die Erfahrungen eines halben Jahrhunderts. Weitere Erfahrungen einiger Jahrzehnte, die ihrer Aufstellung folgten, hatten sie glänzend bestätigt. Nun wurde die Theorie mit einem Male 1898 für falsch erklärt; weil damals drei, sage und schreibe drei volle Jahre der Prosperität sich eingestellt hatten. Hätte die deutsche Sozialdemokratie sich damals von dieser Kritik imponieren lassen und den von den Krisen handelnden Passus des Erfurter Programms entsprechend revidiert, so wäre ihr die angenehme Aufgabe erwachsen, nach zwei Jahren wieder diesen Passus von Neuem zu revidieren. Wer einmal derartigen kurzatmigen Kritiken, die in der Regel nichts sind als flüchtige Einfälle und Stimmungen, einen richtunggebenden Einfluß auf Überzeugung und Programm einräumt, der kommt aus dem Revidieren nicht mehr heraus, der wird zum Spielball der Ereignisse statt zu dem sie überschauenden Meister, der sie seinen großen, unverrückbar festgehaltenen Zielen dienstbar macht.
Nur in einem Punkte mußte ich das in den früheren Auflagen Gesagte etwas einschränken: in den Erwartungen über den Rückgang des Kleinbetriebs in der Landwirtschaft. Die Auflösung des bäuerlichen Kleinbetriebs vollzieht sich in den letzten zwei Jahrzehnten nicht so rasch, wie ehedem, stellenweise gewinnt er sogar an Boden. Das lag 1892 noch nicht so klar zu Tage. Hier mußte ich mich jetzt reservierter ausdrücken, als damals. Das ist aber auch alles. Es liegt nicht der geringste Grund vor, an Stelle der alten eine neue, gegensätzliche Tendenz auf Verdrängung des Großbetriebs durch den Kleinbetrieb in der Landwirtschaft anzuerkennen. Dazu sind die vorliegenden Daten viel zu wenig bestimmt. Sie deuten nicht eine veränderte Entwicklungsrichtung an, sondern ein Stocken der bisherigen Entwicklung, soweit sich’s um die Betriebsgröße handelt. Die Veränderungen sind nur unbedeutend, die sich während der letzten zwei Jahrzehnte in der Bodenfläche der einzelnen Betriebskategorien vollzogen haben, und sie gehen nicht überall in der gleichen Richtung vor sich. In einigen Gegenden weicht der Großbetrieb zurück, in anderen macht er Fortschritte. Dabei aber ist der Zeitraum, in dem dies Stocken sich merkbar macht, noch viel zu kurz, um uns zu berechtigen, aus so wenig ausgeprägten Tatsachen Schlüsse zu ziehen, die die Erfahrungen eines Jahrhunderts über den Haufen werfen würden. Ließen wir uns da zu vorschnellen Schlüssen verleiten, dann ginge es uns in der Agrarfrage leicht so wie manchen Revisionisten in der Krisenfrage. Endlich aber muß bemerkt werden, daß mit der Konzentration des Kapitals, wie sie Marx auffaßte, nicht nur das Weiterbestehen, sondern sogar eine gewisse Zunahme des Kleinbetriebs in einzelnen Produktionszweigen vereinbar ist, und zwar nicht bloß in der Landwirtschaft, sondern auch in der Industrie und im Handel. Gerade wenn man im Sinne der Marxschen Dialektik denkt, wird man diese Zunahme leicht begreifen. Jede Tendenz erzeugt Gegentendenzen, die danach trachten, jene aufzuheben. Aber auch dort, wo ihnen das gelingt, bewirken sie damit nicht eine bloße Rückkehr zu dem Zustand, wie er vor der Herrschaft der aufgehobenen Tendenz bestand, sondern erzeugen sie etwas wesentlich Neues. So erzeugt zum Beispiel das Elend, das der Kapitalismus naturnotwendig über das Proletariat verhängt, dessen Kampf gegen das Elend. Aber dort, wo der proletarische Klassenkampf stark genug wird, das vom Kapital erzeugte Elend zurückzudrängen, ist das Resultat nicht etwa eine vorkapitalistische Arbeiteridylle. Weiter aber, wenn das Proletariat strebt, sich zu organisieren und dadurch das Machtverhältnis zu verschieben, das zwischen dem einzelnen Lohnarbeiter und dem einzelnen Kapitalisten besteht, so erzeugt dies Streben auf der anderen Seite wieder den Drang nach Organisierung der Unternehmer. Wo nun der Arbeiterorganisation der Unternehmerverband gegenübertritt, scheint das alte Machtverhältnis zwischen dem einzelnen Lohnarbeiter und dem einzelnen Unternehmer wiederhergestellt zu sein. Indes ist in Wirklichkeit das neue Machtverhältnis doch ein ganz anderes. Wie kraftvoll auch die Kapitalisten durch ihre Organisationen werden können, so wie der einzelne Kapitalist mit dem isolierten Arbeiter darf eine Unternehmerorganisation mit der proletarischen Organisation doch nicht mehr umspringen. Und das Bewußtsein wie die Taktik der organisierten Arbeiter bleiben unter allen Umständen andere als die der vereinzelten.
Ein gleicher dialektischer Prozeß bewirkt auch, daß aus der Konzentration des Kapitals selbst wieder unter Umständen eine Vermehrung des Kleinbetriebs entspringt. Aber der neue Kleinbetrieb ist ein ganz anderer als der alte, hat mit diesem nur Äußerlichkeiten gemein und spielt ökonomisch wie politisch eine ganz andere Rolle.
Die Konzentration des Kapitals führt bekanntlich nach Marxscher Anschauung nicht bloß zu einer Auflösung des überkommenen selbständigen, im Wesentlichen ohne dauernde Lohnarbeit im Gange gehaltenen Kleinbetriebs, sondern auch zu einer Vermehrung der Reservearmee von Arbeitskräften. Sie wirft weit mehr Arbeitskräfte auf den Markt, als dieser absorbieren kann. Jedoch nichts ist irriger, als die Anschauung, die ganze industrielle Reservearmee bestehe aus Arbeitslosen. Im Gegenteil, diese bilden nur einen Bruchteil davon, nur ihre höchsten und tiefsten Schichten – hier Lumpenproletarier, Tagdiebe, die die Arbeitslosigkeit nicht scheuen, dort organisierte Arbeiteraristokraten, deren Organisation stark genug ist, ihre Arbeitslosen eine Zeit „lang über Wasser zu halten. Aber die große Mittelschicht derjenigen, die noch Lohnarbeit suchen und keine ihren beruflichen Fähigkeiten entsprechende finden, sind gezwungen, sich an andere Möglichkeiten der Verwertung ihrer Arbeit anzuklammern. Die einzige Alternative zur Lohnarbeit bietet aber heute die Arbeit in einem eigenen Kleinbetrieb – der genossenschaftliche Betrieb kommt als Massenerscheinung noch nicht in Betracht. Je rascher also die Konzentration des Kapitals vor sich geht, je rascher sie den ursprünglichen Kleinbetrieb ruiniert und die industrielle Reservearmee ausdehnt, desto größer der Drang unter den freigesetzten Arbeitskräften nach Begründung oder Erhaltung von Kleinbetrieben. Der Verdrängung des Kleinbetriebe hier entspricht seine Ausdehnung dort. Die Konzentration des Kapitals beseitigt heute in Deutschland den Kleinbetrieb am raschesten in der Industrie der Leuchtstoffe, wo von 1882 bis 1895 die Kleinbetriebe um 25 Prozent abnahmen, der Industrie der Steine und Erden (Abnahme 24 Prozent), Bergbau und Hüttenwesen (Abnahme 84 Prozent), Textilindustrie (Abnahme 42 Prozent). Aber dieselbe Entwicklung vermehrte die Kleinbetriebe im Handelsgewerbe um 89 Prozent, im Versicherungsgewerbe um 60 Prozent, im Gewerbe der Beherbergung und Erquickung um 35 Prozent. Bei der Herstellung von Tabak und Zigarren vermehrten sich die Kleinbetriebe von 5465 auf 9708, um 78 Prozent, im Hausirhandel von 202 709 auf 312 059, das sind 54 Prozent. Diesen Zahlen gegenüber sind die Zuwachszahlen der landwirthschaftlichen Betriebe unter 2 Hektaren (5,8 Prozent) und von 2 bis 5 Hektaren (3,5 Prozent) höchst geringfügiger Natur. Wenn man auf die bloßen Zahlen der Statistik ginge, könnte man auch für den Handel, die Schankwirtschaft, die Tabakfabrikation und noch ein paar kleinere Industriezweige den Grundsatz verkünden, daß für sie das Gesetz der Kapitalskonzentration nicht gelte. Und doch wissen wir ganz genau, daß es auch hier in Kraft ist.
Die neuen Kleinbetriebe, die aus der Konzentration des Kapitals hervorgehen – Heimarbeiter, Hausierer, Zwergbauern usw. –, sind eben ganz anderer Natur als die durch die Konzentration des Kapitals beseitigten. Diese beruhten auf dem Privateigentum an den Produktionsmitteln, die das freie Eigentum ihrer Besitzer waren; der neue Kleinbetrieb erhält die wichtigsten seiner Produktionsmittel vom Kapital vorgeschossen, dem er dafür dienstpflichtig wird – der Kleinbauer auf dem gepachteten oder verschuldeten Boden nicht minder als der Heimarbeiter, dem das Rohmaterial vom Verleger übergeben wird, oder der Schankwirt, der nur der Beauftragte der Brauerei ist, ebenso wie der Hausierer oder Kleinkrämer, der die Waren, die er vertreibt, auf Kredit bezieht.
Der alte Kleinbetrieb bildete einen Mittelstand – sein Besitzer, halb Kapitalist, halb Lohnarbeiter, stand zwischen beiden. Der Besitzer des neuen Kleinbetriebs steht unter dem Lohnarbeiter; er ist viel wehrloser als dieser, seine Lebenshaltung steht oft tiefer, seine Arbeitszeit wird länger ausgedehnt, Weib und Kind viel mehr ausgebeutet. Der neue Kleinbetrieb bildet nicht eine Position, in die der Lohnarbeiter aufsteigt, sondern eine, in die er herabsinkt – neben den zu ihr herabkommenden, selbständigen Besitzern von Kleinbetrieben. Der alte Kleinbetrieb, der durch die Konzentration des Kapitals beseitigt wird, bildete einen Konkurrenten des letzteren; er stand dem einzelnen Kapitalisten feindlich gegenüber als Mitglied der gleichen Klasse selbständiger Produzenten. Der neue Kleinbetrieb bildet ein Ausbeutungsobjekt des Kapitals und als Reserve von Arbeitskräften des Großbetriebs eine Voraussetzung für dessen Gedeihen; er steht dem Kapitalisten feindlich gegenüber nicht als Mitglied der gleichen Klasse, sondern als Mitglied einer anderen, von ihm unterdrückten und ausgebeuteten Klasse, des Proletariats.
Der kapitalistische Großbetrieb kann sich nicht entwickeln, wenn ihm nicht eine Reserve von Arbeitskräften zu Gebote steht, die einerseits auf den Lohn der beschäftigten Lohnarbeiter drückt, andererseits dem Kapital gestattet, jede Konjunktur auszunützen und die Produktion zeitweise sprunghaft durch rasche Einstellung neuer Arbeitskräfte zu erweitern.
Diese Reserve bietet ihm weniger die Schar der Arbeitslosen als die neue Sorte von, man kann sagen, proletarisierten Kleinbetrieben. Nur in verhältnismäßig wenigen Arbeitszweigen ist bisher eine ausreichende längere Arbeitslosenunterstützung möglich gewesen. Die Masse der eine größere Zeit lang Arbeitslosen verkommt, entwöhnt sich der Arbeit, wird für die Ausbeutung durch das Kapital unbrauchbar. Ganz anders die Arbeiter und Besitzer der proletarisierten Kleinbetriebe. Sie sind stets geneigt, der Großindustrie zuzuströmen, sobald dort lohnende Arbeit vorhanden ist, und sie kommen zu ihr mit aller der Arbeitswilligkeit, Geschicklichkeit und Unterwürfigkeit, die der proletarisierte Kleinbetrieb erzeugt.
Sobald eine länger dauernde Ära der Prosperität sich fühlbar macht, verlassen zahlreiche Arbeiter von ländlichen und städtischen Kleinbetrieben ihre bisherige Arbeitsgelegenheit, um sich dem Großbetrieb zuzuwenden. Der Besitzer des Kleinbetriebs selbst ist, namentlich in der Landwirtschaft, meist zu sehr an ihn gefesselt, um ebenfalls ohne Weiteres seine Arbeitskraft dem Großbetrieb zuwenden zu können. Aber er sendet ihm die energischsten und intelligentesten seiner Familienmitglieder zu, so daß der Kleinbetrieb oft nur noch von Greisen und Kindern betrieben wird, so am deutlichsten seine neue Funktion in der kapitalistischen Ära bezeugend, die, als Produktionsstätte von neuen Arbeitern und Depot für überflüssig gewordene Arbeiter zu dienen. Nicht bloß der industrielle, auch der landwirtschaftliche Großbetrieb bedarf immer mehr dieser vom Kleinbetrieb gelieferten Reservearmee; ja der landwirtschaftliche Großbetrieb noch mehr als der industrielle. Denn einer der Umstände, die ihn im Gegensatz zum letzteren bedrängen, rührt daher, daß die neue Technik, namentlich die Arbeitsteilung und das Maschinenwesen, die Landwirtschaft dort, wo sie kapitalistisch betrieben wird, immer mehr zu einem Saisongewerbe machen, das zeitweise großer Arbeitermassen, in der Zwischenzeit aber nur weniger Arbeitskräfte bedarf. Daher die Arbeiternot der Großgrundbesitzer, die noch viel ärger wäre ohne die Reserven des Kleinbauerntums, namentlich im Osten Deutschlands und jenseits seiner Grenzen, die jahraus jahrein als Wanderarbeiter den Großbetrieben die sehnlichst erwarteten Arbeitskräfte liefern. Ohne diesen von den kleinen Bauern gelieferten Überschuß an Arbeitskräften wäre der landwirtschaftliche Großbetrieb in Deutschland in noch viel größerer Bedrängnis als er ist. Insofern ist also bei der heutigen Organisation der Produktion der Kleinbetrieb für den Fortgang der Landwirtschaft unentbehrlich; nicht als technisch überlegener Konkurrent des Großbetriebs, sondern als der sicherste und ausgiebigste Lieferant von Proletariern für den Großgrundbesitz. Dieser sucht denn auch selbst Kleinbetriebe künstlich zu schaffen, um mehr Proletarier geliefert zu bekommen. So sehen wir, daß die Konzentration des Kapitals selbst wieder ein Bedürfnis nach einer Vermehrung von Kleinbetrieben erzeugt und sie fördert.
Ist aber damit das Erfurter Programm ad absurdum geführt, das von der Naturnotwendigkeit des Unterganges des Kleinbetriebs spricht? Mitnichten. Es handelt nur von dem Untergang jenes Kleinbetriebs, „dessen Grundlage das Privateigentum des Arbeiters an seinen Produktionsmitteln bildet“.
Das gilt, wie wir gesehen haben, nicht für den neuen Kleinbetrieb, dessen wichtigste Produktionsmittel das Kapital besitzt. Der neue Kleinbetrieb ist ein ganz proletarisches Gebilde, dessen Angehörige immer mehr alles Interesse am Privateigentum an den Produktionsmitteln verlieren, immer mehr zum gleichen Klassengegensatz wie das lohnarbeitende Proletariat kommen. Bildete der alte Kleinbetrieb das festeste Bollwerk des Privateigentums an den Produktionsmitteln und damit des Kapitalismus, so bildet der neue ein Element des proletarischen Gegensatzes gegen dies Privateigentum und damit gegen das Kapital. Da die in ihm Tätigen isolierter, gedrückter, überarbeiteter sind als die Arbeiter der Großbetriebe, ihre ökonomische Stellung auch nicht so einfach und klar, wie die der eigentlichen Lohnarbeiter, sind sie weit schwerer zu organisieren und zum Bewußtsein ihrer Lage zu bringen, als diese; sie können unter Umständen als Streikbrecher und konservative Wähler den Emanzipationskampf des Proletariats verlangsamen, aber nirgends mehr bilden sie ein Element, auf dem das Kapital seine Herrschaft dauernd begründen könnte. Früher oder später treiben sie ihre Klasseninteressen stets an die Seite der kämpfenden Lohnarbeiterschaft.
Der alte, aus der Blütezeit des Handwerks überlieferte Kleinbetrieb bildete eine der festesten und unentbehrlichsten ökonomischen Grundlagen der Gesellschaft seiner Zeit. Der neue, proletarisierte Kleinbetrieb bildet eines ihrer Abfallsprodukte, das unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen ebenso unvermeidlich ist wie etwa Verbrechen und Prostitution, das aber ebensowenig wie diese eine gesunde Grundlage der Gesellschaft sein kann. Der neue Kleinbetrieb wird immer mehr ein parasitisches Gebilde, ein Notbehelf, der die Gesellschaft nur belastet und dessen sich die von ihm Lebenden leicht und gern entledigen, sobald die Not aufhört. Heute schon sehen wir, wie während jeder Prosperitätsepoche die Kleinbetriebe in Stadt und Land scharenweise verlassen werden. Würde erst einmal das Proletariat die politische Macht und damit die Möglichkeit erobern, die ganze Produktion seinen Interessen gemäß einzurichten, so müßte es vor allem dahin trachten, die industrielle Reservearmee aufzuheben. Das würde aber zu einer raschen Verödung der Kleinbetriebe in den meisten Zweigen der Industrie, des Handels, der Landwirtschaft führen.
Nichts irriger als die Auffassung, sozialistische Produktion werde erst dann möglich, wenn alle Kleinbetriebe aufgesaugt seien. Sie würde dann nie möglich, weil die Konzentration des Kapitals den Kleinbetrieb nicht völlig verschwinden läßt, sondern vielfach nur einen neuen an Stelle des alten setzt. Die Aufsaugung dieser neuen, parasitisch-proletarischen Kleinbetriebe wird erst durch die Einführung sozialistischer Produktion ermöglicht. Letztere ist die Vorbedingung, nicht die Folge des völligen Verschwindens des Kleinbetriebs aus allen Wirtschaftsgebieten, auf denen er technisch überflüssig geworden ist. Nicht das völlige Verschwinden des Kleinbetriebs aus der Betriebsstatistik, sondern seine Ausschaltung aus den das gesellschaftliche Leben beherrschenden Produktionsprozessen, deren Unterwerfung unter das Kapital, das die Produktionsmittel und alle Vorteile ihrer steigenden Vervollkommnung monopolisiert, das sind die Vorbedingungen des Sozialismus. Daß sie aufs rapideste wachsen, kann heute selbst ein sozial und politisch Blinder mit den Händen greifen.
In diesem Sinne ist die in das Erfurter Programm übernommene Lehre des Marxismus von der Konzentration des Kapitals aufzufassen. So aufgefaßt, steht dieser Grundsatz nicht nur nicht im Widerspruch mit den wirklichen Tatsachen, er bietet vielmehr erst die Möglichkeit, sie völlig zu begreifen. Auch in diesem Punkte ebensowenig wie in den anderen, die der „kritische Sozialismus“ beanstandete, bedarf der grundsätzliche Teil des Erfurter Programms einer Revision.
Es ist nicht Selbstlob, wenn ich das ausspreche, denn das Erfurter Programm ist keineswegs mein ausschließliches Werk. Wohl wurde es auf der Grundlage des von mir vorgeschlagenen Programmentwurfes aufgebaut. Aber die Erfurter Programmkommission hat diesen Entwurf wesentlich erweitert. In dem Entwurf selbst aber waren jene Sätze, die später am meisten diskutiert wurden, dem „Kapital“ von Marx fast wörtlich entnommen, der allgemeine Teil des Programms selbst ist nur eine Paraphrase des bekannten Absatzes über „Die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akumulation“ im „Kapital“. Gerade darin sehe ich die Ursache der Kraft des Erfurter Programms und seiner Fähigkeit, den wechselnden Moden zu widerstehen. Solange es nicht gelungen ist, an Stelle des „Kapital“ eine andere theoretische Grundlegung des Sozialismus zu setzen, solange wird auch das Erfurter Programm einer Revision seiner Grundsätze nicht bedürfen.
Berlin-Friedenau, im Mai 1904.
K. Kautsky
I. Der Untergang des Kleinbetriebs
1. Kleinbetrieb und Privateigentum
Das Programm, das sich die deutsche Sozialdemokratie auf dem Parteitag zu Erfurt (14.–20. Oktober 1891) gegeben hat, zerfällt in zwei Teile, einen allgemeinen, theoretischen, der die Grundsätze und Endziele der Sozialdemokratie behandelt, und einen praktischen Teil, der die Forderungen enthält, welche die Sozialdemokratie als praktische Partei an die heutige Gesellschaft und den heutigen Staat stellt, um damit die Erreichung ihrer Endziele anzubahnen.
Uns beschäftigt hier nur der erste, allgemeine Teil. Derselbe zerfällt wieder in drei Unterabteilungen: 1. Eine Kennzeichnung der heutigen Gesellschaft und ihres Entwicklungsganges. Daraus werden gefolgert: 2. die Endziele der Sozialdemokratie und 3. die Mittel, welche zu ihrer Verwirklichung führen können und werden.
Betrachten wir zunächst die erste Unterabteilung. Sie besteht aus vier Absätzen, welche lauten:
„Die ökonomische Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft führt mit Naturnotwendigkeit zum Untergang des Kleinbetriebes, dessen Grundlage das Privateigentum des Arbeiters an seinen Produktionsmitteln bildet. Sie trennt den Arbeiter von seinen Produktionsmitteln und verwandelt ihn in einen besitzlosen Proletarier, indes die Produktionsmittel das Monopol einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Kapitalisten und Großgrundbesitzern werden.
Hand in Hand mit dieser Monopolisierung der Produktionsmittel geht die Verdrängung der zersplitterten Kleinbetriebe durch kolossale Großbetriebe, geht die Entwicklung des Werkzeugs zur Maschine, geht ein riesenhaftes Wachstum der Produktivität der menschlichen Arbeit. Aber alle Vorteile dieser Umwandlung werden von den Kapitalisten und Großgrundbesitzern monopolisiert. Für das Proletariat und die versinkenden Mittelschichten – Kleinbürger, Bauern – bedeutet sie wachsende Zunahme der Unsicherheit ihrer Existenz, des Elends, des Drucks, der Knechtung, der Erniedrigung, der Ausbeutung.
Immer größer wird die Zahl der Proletarier, immer massenhafter die Armee der überschüssigen Arbeiter, immer schroffer der Gegensatz zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, immer erbitterter der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat, der die moderne Gesellschaft in zwei feindliche Heerlager trennt und das gemeinsame Merkmal aller Industrieländer ist.
Der Abgrund zwischen Besitzenden und Besitzlosen wird noch erweitert durch die im Wesen der kapitalistischen Produktionsweise begründeten Krisen, die immer umfangreicher und verheerender werden, die allgemeine Unsicherheit zum Normalzustand der Gesellschaft erheben und den Beweis liefern, daß die Produktivkräfte der heutigen Gesellschaft über den Kopf gewachsen sind, daß das Privateigentum an Produktionsmitteln unvereinbar geworden ist mit deren zweckentsprechender Anwendung und voller Entwicklung.“
Gleich im ersten Satz unseres Programms stoßen wir auf ein bemerkenswertes Wort: „ökonomische Entwicklung“. Dasselbe führt uns sofort auf den Kernpunkt der sozialdemokratischen Gedankenwelt.
Mancher meint, etwas sehr Weises zu sagen, wenn er uns gegenüber erklärt: „Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wie es heute ist, so ist es immer gewesen und wird es immer sein.“ Nichts unrichtiger und törichter als diese Behauptung. Die neuere Wissenschaft zeigt uns, daß nirgends ein Stillstand stattfindet, daß in der Gesellschaft wie in der Natur eine stete Entwicklung wahrnehmbar ist.
Wir wissen heute, daß ursprünglich der Mensch in tierähnlicher Weise nur von der Einsammlung dessen lebte, was die Natur ihm freiwillig bot. Aber er erfand eine Waffe nach der anderen, ein Werkzeug nach dem anderen, eines vollkommener als das andere. Er wurde Fischer, Jäger, Viehzüchter, endlich seßhafter Ackerbauer und Handwerker. Immer rascher war der Gang der Entwicklung, bis diese endlich heute im Zeitalter des Dampfes und der Elektrizität eine so schnelle geworden ist, daß wir sie mit unseren eigenen Augen verfolgen können, ohne Vergleichung mit früheren Zeiten. Und da gibt es noch Leute, die mit überlegener Miene uns belehren wollen darüber, daß es nichts Neues unter der Sonne gibt!
Die Art, wie die Menschen ihren Lebensunterhalt gewinnen, wie sie die dazu nötigen Güter erzeugen (produzieren), hängt ab von der Beschaffenheit ihrer Werkzeuge, ihrer Rohstoffe, mit einem Wort, von den Mitteln, die ihnen zur Gütererzeugung (Produktion) zur Verfügung stehen, von ihren Produktionsmitteln. Die Menschen haben aber nie vereinzelt produziert, sondern stets in größeren oder kleineren Gesellschaften, deren jeweilige Form abhängt von der jeweilig herrschenden Art der Produktion.
Der Entwicklung der Produktion entspricht demnach eine gesellschaftliche Entwicklung.
Die Formen der Gesellschaft und die Verhältnisse ihrer Mitglieder untereinander hängen aber aufs engste zusammen mit den Eigentumsformen, die sie anerkennt und aufrechterhält. Hand in Hand mit der Entwicklung der Produktion geht daher auch eine Entwicklung des Eigentums.
Ein Beispiel wird das klarmachen. Wir wollen dasselbe der bäuerlichen Wirtschaft entnehmen.
Ein ordentlicher bäuerlicher Betrieb umfaßt zwei Wirtschaftsgebiete: die Viehhaltung und den Ackerbau. In der Viehhaltung herrschte bei uns bis ins vorige Jahrhundert hinein allgemein und herrscht vielfach heute noch die Weidewirtschaft. Diese bedingt aber das Gemeineigentum an Grund und Boden. Es wäre ein Unsinn, wollte jeder Bauer sein eigenes Stückchen Weide für sich absondern, es besonders einzäunen, einen eigenen Hirten für seine paar Stück Vieh halten usf. Daher hängt der Bauer, wo die Weidewirtschaft besteht, mit der größten Zähigkeit an der Gemeindeweide und am Gemeindehirten fest.
Anders steht es im Ackerbau, wenn derselbe mit den einfachen Werkzeugen der bäuerlichen Wirtschaft, ohne Maschinen, betrieben wird. Eine gemeinsame Bearbeitung des gesamten Ackerlandes einer Bauerngemeinde durch die Gesamtheit der Gemeindegenossen ist unter diesen Umständen weder notwendig noch förderlich für die Produktion. Die Werkzeuge des bäuerlichen Ackerbaues bedingen es, daß der einzelne allein oder im Verein mit einigen wenigen (einer Gruppe, wie sie die bäuerliche Familie darstellt) ein kleineres Stück Land besonders bebaut. Die Bodenbestellung wird aber unter diesen Umständen um so sorgfältiger sein, sie wird einen um so reicheren Ertrag abwerfen, je freier der Bebauer über sein Grundstück verfügen kann und je voller ihm der Ertrag der Bearbeitung und Verbesserung seines Ackers zuteil wird. Der Ackerbau drängt in seinen Anfängen zum Kleinbetrieb, dieser aber bedarf des Privateigentums an den Produktionsmitteln, soll er sich voll entfalten können.
Wir sehen daher z. B. bei den alten Deutschen das Gemeineigentum an Grund und Boden, das bei ihnen herrschte, solange die Weidewirtschaft (und die Jagd) für sie die vornehmsten Mittel zur Gewinnung des Lebensunterhalts waren, in dem Maße immer mehr und mehr verschwinden und dem Privateigentum an Grund und Boden Platz machen, in dem der kleinbäuerliche Ackerbau in den Vordergrund trat. Die Ersetzung der Weidewirtschaft durch die Stallwirtschaft machte dem ländlichen Gemeineigentum vollends den Garaus.
So ist unter dem Einfluß der wirtschaftlichen (ökonomischen) Entwicklung infolge der Fortschritte in der Landwirtschaft der Bauer aus einem Kommunisten zu einem Fanatiker des Privateigentums geworden.
Was vom Kleinbauern, gilt ebenfalls vom Handwerker. Das Handwerk bedarf keines genossenschaftlichen Zusammenarbei-tens einer größeren Anzahl von Arbeitern. Jeder Arbeiter des Handwerks produziert für sich entweder ganz allein oder mit ein bis zwei Helfern, Gesellen, die zu seiner Familie, seinem Haushalt, gehören. Wie in der bäuerlichen Landwirtschaft hält auch im Handwerk der einzelne Arbeiter oder die einzelne Arbeiterfamilie einen besonderen Wirtschaftsbetrieb in Gang. Und daher bedarf das Handwerk ebenso wie der Kleinbetrieb in der Landwirtschaft des Privateigentums an den Produktionsmitteln, die es verwendet, und an den Produkten, die es erzeugt, um seine Leistungsfähigkeit, seine Produktivkraft voll zu entfalten. Im Kleinbetrieb hängt das Produkt des Arbeiters ab von seiner Persönlichkeit, von seiner Geschicklichkeit, seinem Fleiß, seiner Ausdauer. Er nimmt es daher für sich in Anspruch als sein persönliches Eigentum. Er kann aber seine Persönlichkeit in der Produktion nicht voll entfalten, wenn er nicht persönlich frei ist und frei über seine Produktionsmittel verfügt, das heißt, wenn diese nicht sein Privateigentum sind.
Das hat die Sozialdemokratie erkannt und in ihrem Programm ausdrücklich anerkannt mit den Worten, daß „das Privateigentum an den Produktionsmitteln die Grundlage des Kleinbetriebs bildet“. Aber sie sagt gleichzeitig, daß „die ökonomische Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft mit Naturnotwendigkeit zum Untergang des Kleinbetriebs führt“.
Verfolgen wir nun diese Entwicklung.
2. Ware und Kapital
Die Ausgangspunkte der bürgerlichen Gesellschaft sind die bäuerliche Landwirtschaft und das Handwerk.
Die Bauernfamilie befriedigte ursprünglich alle ihre Bedürfnisse selbst. Sie erzeugte alle Nahrungs- und Genußmittel, deren sie bedurfte, alle Werkzeuge, alle Kleider für ihre Mitglieder, sie baute selbst ihr Haus usw. Sie produzierte so viel, als sie brauchte, aber auch nicht mehr. Mit der Zeit aber gelangte sie durch den Fortschritt der Landwirtschaft dahin, daß sie einen Überschuß an Produkten erzeugte, den sie nicht unmittelbar selbst brauchte. Sie wurde dadurch in den Stand gesetzt, für diesen Überschuß Produkte einzutauschen, die sie nicht oder nicht genügend zu erzeugen vermochte, die ihr aber willkommen waren, etwa einen Schmudk, eine Waffe oder ein Werkzeug. Durch den Austausch wurden diese Produkte zu Waren.
Eine Ware ist ein Produkt, das nicht zur Verwendung oder zum Verbrauch (Konsum) innerhalb des Wirtschaftsbetriebs, in dem es erzeugt worden, sondern zum Austausch gegen das Produkt eines anderen Wirtschaftsbetriebs bestimmt ist. Der Weizen, den der Bauer zum Selbstgebrauch baut, ist keine Ware, wohl aber derjenige, den er zum Verkauf baut. Verkaufen heißt nichts, als eine bestimmte Ware gegen eine solche austauschen, die jedermann willkommen ist und die auf diese Weise zu Geld wird, z. B. das Gold.
Der Bauer wird, wie wir gesehen, im Laufe der ökonomischen Entwicklung zum Warenproduzenten; der Handwerker im selbständigen Kleinbetrieb ist von vornherein Warenproduzent. Und es ist nicht bloß ein Überschuß an Produkten, den er verkauft, sondern bei ihm steht die Produktion zum Verkauf im Vordergrund.
Der Warenaustausch setzt aber zweierlei voraus: erstens, daß nicht alle einzelnen Wirtschaftsbetriebe dasselbe produzieren, sondern daß eine Arbeitsteilung in der Gesellschaft eingetreten ist, und zweitens, daß die Tauschenden über die Produkte, die sie austauschen, frei verfügen, daß diese ihr Privateigentum sind.
Je mehr im Laufe der ökonomischen Entwicklung die Teilung der Arbeit in einzelne Berufe fortschreitet und das Privateigentum an Umfang und Bedeutung zunimmt, desto mehr tritt im allgemeinen die Produktion für den Selbstgebrauch zurück und wird verdrängt durch die Warenproduktion.
Die Arbeitsteilung führt schließlich dahin, daß auch das Kaufen und Verkaufen ein besonderes Geschäft wird, dem sich eine Menschenklasse ausschließlich hingibt, die Kaufleute. Dieselben ziehen ihr Einkommen daraus, daß sie billig kaufen und teuer verkaufen. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß sie die Preise der Waren willkürlich bestimmen können. Der Preis einer Ware hängt in letzter Linie ab von ihrem Tauschwert. Der Wert einer Ware wird aber bestimmt durch die im allgemeinen zu ihrer Herstellung erforderliche Arbeitsmenge. Der Preis einer Ware fällt jedoch fast nie mit ihrem Wert genau zusammen; er wird nicht bloß durch die Produktionsverhältnisse bestimmt, wie der Wert, sondern auch durch die Marktverhältnisse, vor allem durch Nachfrage und Angebot, davon, in welcher Menge die Ware auf den Markt gebracht, in welcher Menge sie verlangt wird. Aber auch der Preis unterliegt gewissen Gesetzen. Er ist zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten ein bestimmter. Will also der Kaufmann einen Überschuß des Verkaufspreises der Ware über ihren Einkaufspreis erzielen, das heißt, einen Gewinn oder Profit, so kann er denselben in der Regel nur dadurch erlangen, daß er seine Ware an einem Ort oder zu einer Zeit kauft, wo sie billig ist, daß er sie an einem Ort oder zu einer Zeit verkauft, wo sie teuer ist.
Wenn der Bauer oder der Handwerker Waren kauft, tut er dies, weil er sie für sich oder seine Familie braucht: als Produktions- oder als Lebensmittel. Der Kaufmann kauft Waren, nicht um sie selbst zu verbrauchen, sondern um sie so zu verwenden, daß sie ihm einen Profit verschaffen. Waren und Geldsummen, welche zu diesem Zwecke verwendet werden, sind – Kapital.
Man kann von keiner Ware oder Geldsumme an und für sich sagen, sie sei Kapital oder nicht. Es kommt auf ihre Verwendung an. Der Tabak, den ein Kaufmann kauft, um ihn mit einem Gewinn wieder zu verkaufen, ist für ihn Kapital. Der Tabak, den er kauft, um ihn selbst zu rauchen, ist für ihn kein Kapital.
Die ursprünglichste Form des Kapitals ist die des Kaufmannskapitals. Fast ebensoalt ist das Wucherkapital, dessen Gewinn in dem Zins besteht, den der Kapitalist für entliehene Waren oder Geldsummen einstreicht.
Das Kapital bildet sich auf einer gewissen Stufe der Warenproduktion, natürlich auf der Grundlage des Privateigentums, welches ja die Grundlage der ganzen Warenproduktion bildet. Aber unter dem Einfluß des Kapitals erhält das Privateigentum ein ganz neues Gesicht, oder vielmehr es erhält jetzt zwei Gesichter. Neben dem kleinbürgerlichen, den Verhältnissen des Kleinbetriebs entsprechenden, zeigt es jetzt auch ein kapitalistisches. Die Verteidiger des jetzigen Privateigentums weisen nur auf seine kleinbürgerliche Seite hin. Und doch muß man blind sein, um heute die kapitalistische Seite des Privateigentums zu übersehen.
Auf der Stufe der ökonomischen Entwicklung, die wir jetzt behandeln, wo das Kapital nur Kaufmanns- und Wucherkapital ist, werden erst wenige Züge dieses kapitalistischen Gesichts sichtbar, aber auch sie sind bemerkenswert.
Das Einkommen des Bauern oder Handwerkers hängt unter der Herrschaft des Kleinbetriebs in erster Linie ab von seiner und seiner Familiengenossen Persönlichkeit, seinem Fleiß, seiner Geschicklichkeit usw. Die Menge des Profits des Kaufmanns dagegen ist um so größer, je mehr Geld er hat, Waren zu kaufen, je mehr Waren er zum Verkauf besitzt. Wenn ich 10 000 Pfund Tabak verkaufe, wird mein Profit unter sonst gleichen Umständen hundertmal so groß sein, als wenn ich bloß 100 Pfund verkaufen kann. Das gleiche gilt vom Wucherer. Das Einkommen des Kapitalisten – als Kapitalisten – hängt also in erster Linie ab von der Größe seines Kapitals.
Die Arbeitskraft und die Fähigkeiten des einzelnen sind begrenzt; so auch die Menge der Erzeugnisse, die ein Arbeiter unter bestimmten Verhältnissen hervorbringen kann. Sie kann einen gewissen Durchschnitt nie weit übersteigen. Geld dagegen kann man ins unendliche aufhäufen, dafür gibt es kein Maß und kein Ziel. Und je mehr Geld einer hat, desto mehr Geld heckt es, wenn als Kapital angewendet. Damit ist die Möglichkeit gegeben, unermeßliche Reichtümer zu erwerben.
Aber das Privateigentum schafft noch eine andere Möglichkeit. Das Privateigentum an Produktionsmitteln bedeutet für jedermann die rechtliche Möglichkeit, dieselben zu erwerben, aber auch die Möglichkeit, sie, das heißt seine Lebensquellen, zu verlieren, also in völlige Armut zu versinken. Das Wucherkapital setzt die Bedürftigkeit bereits voraus. Wer hat, was er braucht, wird nichts zu leihen nehmen. Indem es die Notlage des Bedürftigen ausbeutet, ist das Wucherkapital ein Mittel, sie zu vermehren.
Arbeitsloser Erwerb – unermeßliche Reichtümer der einen -völlige Armut der anderen – diese Züge zeigt uns das kapitalistische Gesicht des Privateigentums. Aber noch bleiben diese Züge verschleiert, solange das Kaufmanns- und Wucherkapital im Anfang ihrer Entwicklung sind. Namentlich der schlimmste Zug, die Armut, tritt nur schwach zutage, die Besitzlosigkeit bleibt Ausnahmsfall, ist nicht der Zustand großer Volksmassen.
Denn ebenso wie die anderen Ausbeuter, die neben dem Kaufmann und Wucherer auftauchen, z. B. im Mittelalter die feudalen Grundherrn – auf die wir hier jedoch, um nicht abzuschweifen, nicht weiter eingehen können –, ist auch der Kaufmann und Wucherer auf dieser Stufe auf das Bestehen und Gedeihen der Kleinbetriebe in Stadt und Land angewiesen. Noch gilt das Sprichwort; Hat der Bauer Geld, so hat es die ganze Welt. Der Handel vernichtet den Kleinbetrieb nicht, er fördert ihn unter Umständen. Der Wucherer saugt seinen Schuldner aus, hat aber an seinem Untergang kein Interesse. Der Verlust der Produktionsmittel, die Armut, tritt unter diesen Umständen nicht als regelmäßige gesellschaftliche Erscheinung auf, sondern als besonderes Unglück, durch außergewöhnliche Unfälle oder außergewöhnliche Unfähigkeit hervorgerufen. Die Armut gilt da entweder als eine von Gott gesandte Prüfung oder als eine Strafe für Faulheit, Leichtsinn usw. Diese Auffassung gilt heute noch sehr stark in kleinbürgerlichen Kreisen, und doch ist seitdem die Besitzlosigkeit eine Erscheinung ganz anderer Art geworden, als sie ehedem war.
3. Die kapitalistische Produktionsweise
Im Laufe des Mittelalters entwickelte sich das Handwerk in Europa immer mehr; die Arbeitsteilung in der Gesellschaft nahm zu – so spaltete sich z. B. die Weberei in die Wollenweberei, die Leinenweberei und die Barchentweberei, und verschiedene mit der Weberei verbundene Hantierungen, z. B. die Tuchschererei, wurden eigene Gewerbe. Die Geschicklichkeit wuchs, und die Arbeitsweisen und Arbeitswerkzeuge wurden sehr verbessert. Gleichzeitig entwickelte sich der Handel, namentlich infolge der Verbesserungen der Verkehrsmittel, besonders des Schiffsbaues.
Es sind vierhundert Jahre her, da war die Blütezeit des Handwerks, da war aber auch eine ereignisreiche Zeit für den Handel. Der Seeweg nach Indien, diesem märchenhaften Lande voll unermeßlicher Schätze, wurde gefunden, und Amerika mit seinen unerschöpflichen Gold- und Silberlagern wurde entdeckt. Eine Flut von Reichtümern ergoß sich über Europa, von Reichtümern, welche europäische Abenteurer in den neuentdeckten Ländern durch Handel, Betrug und Raub zusammengerafft hatten. Der Löwenanteil an diesen Reichtümern fiel den Handelsherrn zu, die imstande waren, Schiffe auszurüsten und mit einer zahlreichen, kraftvollen Bemannung zu versehen, die ebenso verwegen wie skrupellos war.
Um dieselbe Zeit bildete sich aber auch der moderne Staat, der zentralisierte Beamten- und Militärstaat, zunächst in der Form der absoluten Monarchie. Dieser Staat entsprach ebensosehr den Bedürfnissen der aufstrebenden Kapitalistenklasse, als er ihrer Unterstützung bedurfte. Der moderne Staat, der Staat der entwickelten Warenproduktion, zieht seine Kraft nicht aus persönlichen Diensten, sondern aus seinen Geldeinnahmen. Die Monarchen hatten daher alle Ursache, diejenigen, die Geld ins Land brachten, die Kaufleute, die Kapitalisten, zu schützen und zu begünstigen. Zum Dank für diesen Schutz borgten die Kapitalisten den Monarchen und Staaten Geld, machten sie zu ihren Schuldnern, brachten sie in Abhängigkeit von sich und zwangen nun die Staatsgewalt erst recht, den kapitalistischen Interessen zu dienen durch Sicherung und Erweiterung der Verkehrswege, durch Erwerbung und Festhaltung überseeischer Kolonien, durch Kriege gegen konkurrierende Handelsstaaten usw.
Unsere ökonomischen Kinderfibeln erzählen uns, der Ursprung des Kapitals liege in der Sparsamkeit. Wir haben aber eben ganz andere Quellen des Kapitals kennengelernt. Die größten Reichtümer der kapitalistischen Nationen entstammen ihrer Kolonialpolitik, das heißt ihrer Plünderung fremder Länder, entstammen dem Seeraub, dem Schmuggel, dem Sklavenhandel, den Handelskriegen. Die Geschichte dieser Nationen liefert bis in unser Jahrhundert hinein genügende Beispiele von derartigen Methoden, Kapital zu „sparen“. Und die Staatshilfe erwies sich als ein kräftiges Mittel, diese „Sparsamkeit“ zu fördern.