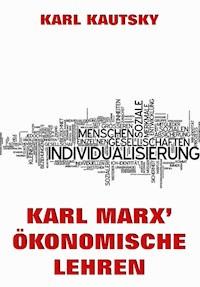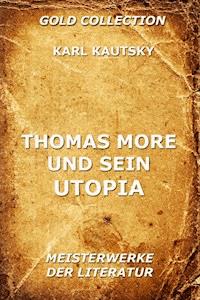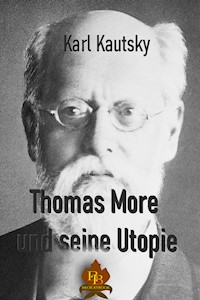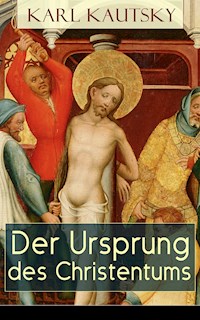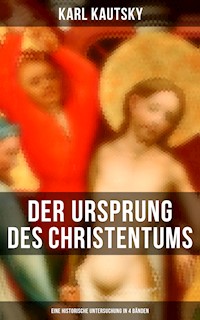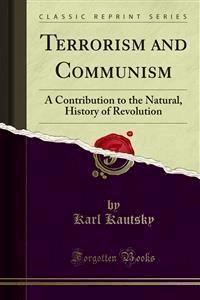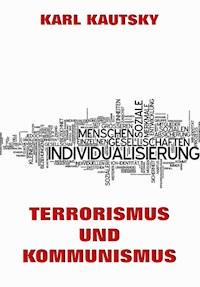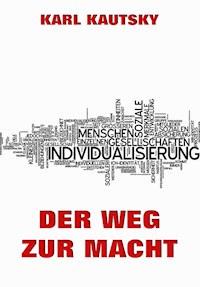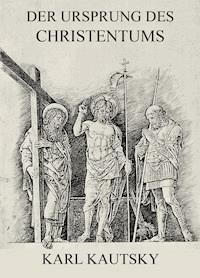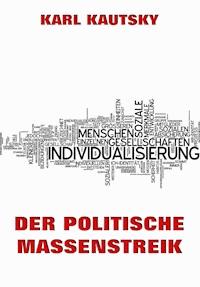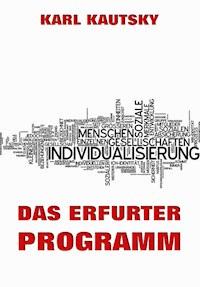Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Werk befasst sich Kautsky mit der historischen Entwicklung der französischen Demokratieform. Inhalt: 1. Die Begrenzung der Streitfrage 2. Die amerikanische Republik 3. Die erste Republik in Frankreich 4. Die zweite Republik und die Sozialisten 5. Das zweite Kaiserreich und die Pariser Kommune 6. Die Verfassung der dritten Republik 7. Die bürgerlichen Republikaner an der Arbeit 8. Der Sozialismus unter der dritten Republik
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Republik und Sozialdemokratie in Frankreich
Karl Kautsky
Inhalt:
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Republik und Sozialdemokratie in Frankreich
1. Die Begrenzung der Streitfrage
2. Die amerikanische Republik
3. Die erste Republik in Frankreich
4. Die zweite Republik und die Sozialisten
5. Das zweite Kaiserreich und die Pariser Kommune
6. Die Verfassung der dritten Republik
7. Die bürgerlichen Republikaner an der Arbeit
a. Opportunismus und Kapitalismus
b. Die Steuerpolitik der dritten Republik
c. Das Koalitionsrecht
d. Der Normalarbeitstag
e. Parlamentarische Korruption und wirtschaftliche Stagnation
8. Der Sozialismus unter der dritten Republik
a. Der Arbeiterfang der bürgerlichen Republikaner
b. Die drei Richtungen der sozialistischen Bewegung
Republik und Sozialdemokratie in Frankreich, Karl Kautsky
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849628987
www.jazzybee-verlag.de
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Sozialistischer Schriftsteller, geb. 16. Okt. 1854 in Prag, verstorben am 17. Oktober 1938 in Amsterdam. Studierte 1874 bis 1878 in Wien Geschichte und Philosophie, war 1880–82 in Zürich als Schriftsteller tätig, begründete 1883 die sozialistische Revue »Die Neue Zeit« (Stuttg.), die er 1885–88 von London aus, seit 1890 in Stuttgart redigierte; jetzt lebt er in Berlin. K. schloss sich schon als Student der Sozialdemokratie an. Er ist entschiedener Anhänger von K. Marx und Fr. Engels, deren Ideen er zu verbreiten und weiterzubilden bestrebt ist. Er schrieb neben zahlreichen kleineren Abhandlungen: »Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft« (Wien 1880); »Karl Marx' ökonomische Lehren, gemeinverständlich dargestellt und erläutert« (Stuttg. 1887, 8. Aufl., 1904); »Thomas More und seine Utopie« (das. 1887); »Die Klassengegensätze von 1789« (das. 1889); »Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil erläutert« (5. Aufl., das. 1904); »Der Parlamentarismus, die Volksgesetzgebung und die Sozialdemokratie« (das. 1893); »Die Agrarfrage« (das. 1899,2. Aufl. 1902); »Bernstein und das sozialdemokratische Programm« (das. 1899); »Handelspolitik und Sozialdemokratie« (das. 1901); »Die soziale Revolution« (Berl. 1903). In der »Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen« (Stuttg. 1894 ff.) schrieb er »Die Vorläufer des neuern Sozialismus«, 1. Teil, und den Abschnitt über »Thomas More«.
Republik und Sozialdemokratie in Frankreich
1. Die Begrenzung der Streitfrage
Der internationale Kongreß hat ein unerwartetes Nachspiel gehabt. Auf Grund einer Reihe von Äußerungen, die in Amsterdam gefallen waren, wurden Guesde und Bebel der Gleichgültigkeit gegen die Republik, ja einer gewissen Vorliebe für die Monarchie geziehen. Daß die bürgerliche Presse damit hausieren ging, war nicht verwunderlich; sie versteht's nicht besser. Das Jaurès und seine Freunde diese Deutung kolportierten, war Weniger erbaulich, aber aus ihrer Situation begreiflich. Aber schließlich begann man sogar im Vorwärts dasselbe Lied zu singen, nachdem ich in der Neuen Zeit auseinandergesetzt, aus welchen Gründen der sozialdemokratische Republikanismus sich vom bürgerlichen unterscheide.
Eine Polemik, die sich daraufhin zwischen dem Genossen Eisner und mir entspann, nahm bald eine solche Richtung, das ich sah, auf diesem Wege werde eine Verständigung nicht erzielt. Ich brach daher die Polemik ab, nicht weil ich dachte, mich dadurch um das Geständnis einer Niederlage herumdrücken zu können, wie Eisner so freundlich war anzudeuten, sondern um die Auseinandersetzung auf einer anderen, meines Erachtens fruchtbareren Grundlage fortzuführen unter möglichster Beiseitelassung aller Polemik. Dringende Arbeiten an der Herausgabe der Marxschen Theorien über den Mehrwert haben mich gehindert, die vorliegende Artikelserie früher fertig zu stellen. Aber ihre Hinausschiebung war wohl der Übel größtes nicht. Das Thema veraltet nicht so rasch.
Vor allem handelt es sich darum, sich darüber klar zu werden, welche Punkte eigentlich strittig sind.
Da kann ich zunächst nur wiederholen, was ich in der Neuen Zeit (XXII, 2, S. 675) gesagt:
„Wir sind schon deswegen Republikaner, weil die demokratische Republik die einzige, dem Sozialismus entsprechende politische Form ist, Die Monarchie kann nur bestehen auf der Grundlage von Klassenunterschieden und Klassengegensätzen. Die Aushebung der Klassen bedingt auch die Aufhebung der Monarchie.“
Wohl hat man auch von einem sozialen Königtum gesprochen, aber die Monarchie kann nie die Klassen aufheben, sie kann höchstens dahin streben, das die Klassen sich die Wage halten, das keine die andere allzusehr überragt. So forderte auch der bedeutendste Verfechter der Idee des sozialen Königtums, Rodbertus, nicht die Aufhebung des Kapital- und Grundeigentum und damit die Aufhebung des Lohnsystems, das er noch auf Jahrhunderte hinaus für unentbehrlich hielt, sondern nur eine solche Gestaltung des Arbeitslohns, das er an der steigenden Produktwität der Arbeit in gleicher Weise teilnähme, wie Profit und Grundrente.
Da die Macht der Monarchie am größten dann, wenn die verschiedenen Klassen sich die Wage halten, weil die Monarchie dann am wenigsten abhängig von einer jeden unter ihnen ist, die einen durch die anderen im Zaume hält, kann es wohl unter Umständen ihren Interessen entsprechen, einer starken Klasse entgegenzutreten, um eine schwächere zu schützen. so hat das Königtum oft die aufkommende Bourgeoisie gegenüber dem Feudaladel gestützt. Aber aus demselben Grunde muß die Monarchie danach trachten, eine versinkende Klasse zu halten, sei es auch auf Kosten der ökonomischen Entwicklung, und einer erstarkenden Klasse entgegenzutreten. Dasselbe Königtum, dessen Interesse es erheischte, das schwache Bürgertum vor dem starken Feudaladel zu schützen, hielt es später für seine Aufgabe, den ökonomisch verkommenden Feudaladel auf Kosten der Nation über Wasser zu halten und die Entwicklung der Bourgeoisie möglichst einzudämmen.
So hat die Monarchie auch mitunter dem Proletariat politische Rechte verliehen oder sonstige Konzessionen, um es gegen die Bourgeoisie auszuspielen, aber das erstarkende Proletariat findet stets die Monarchie unter seinen Gegnern.
Und von vornherein steht die Monarchie dem kämpfenden Proletariat stets mißtrauisch gegenüber, mehr als jeder anderen Klaffe. Denn welcher Klasse immer sie durch ihre politischen Interessen in einem gegebenen Moment genähert werden mag, vom Proletariat trennt sie immer die Kluft, die den Besitzenden vom Besitzlosen scheidet, Monarchie wie Papsttum können die verschiedensten Wandlungen durchmachen, aber sie bleiben stets Angehörige der besitzenden Klassen und als solche Gegner der Emanzipation des Proletariats.
Damit ist aber auch die Gegnerschaft des kämpfenden Proletariats gegeben. sowohl sein Endziel wie seine Bewegung machen den klassenbewußten Proletarier zum Republikaner. Kann die eine oder die andere der besitzenden Klassen hier oder dort unter besonderen Umständen einmal zu einer republikanischen Gesinnung getrieben werden, prinzipiell republikanisch wird durch seine Klassenlage unter den Klassen des modernen Staates nur das Proletariat.
Darüber sind wir wohl alle einig. Damit ist aber nun nicht die strittige Frage aus der Welt geschafft, sondern nur ihr Gebiet begrenzt.
Soweit die republikanische Staatsform und das Proletariat allein in Betracht kommen, ist die Sache freilich sehr einfach. Die Schwierigkeit kommt durch einen dritten Faktor hinein, den wir leider nicht ignorieren können: die Bourgeoisie.
Diese besitzt heute im ökonomischen und gesellschaftlichen Leben die Herrschaft, damit fällt ihr aber auch, obwohl nicht immer direkt und ungeteilt, die Herrschaft im Staate zu. sie ist jedoch weit anpassungsfähiger als das Proletariat. Kann dieses, seiner ganzen Klassenlage nach, nur in der Republik zur Herrschaft kommen, ist diese die einzig mögliche Form für die „Diktatur des Proletariats“, so vermag die Bourgeoisie unter jeder politischen Form sich der Herrschaft im Staate zu bemächtigen, ebenso wie die katholische Kirche, mit der sie auch den guten Magen gemein hat. Am unmittelbarsten aber vermag sie ihre Herrschaft auszuüben in einer parlamentarischen Republik oder in einer parlamentarischen Monarchie, deren Oberhaupt eine bloße Dekoration ist. Die parlamentarische Regierungsform ist die ihren Klasseninteressen entsprechendste.
So kann dieselbe Republik, die den Boden für die Emanzipation des Proletariats bildet, gleichzeitig der Boden werden für die Klassenherrschaft der Bourgeoisie, ein Widerspruch, der aber nicht sonderbarer ist als etwa die widerspruchsvolle Rolle, welche die Maschine in der kapitalistischen Gesellschaft spielt, die gleichzeitig die unentbehrliche Vorbedingung der Befreiung des Proletariats und das Mittel seiner Degradierung und Knechtung ist. Diese Widersprüche sind allen gesellschaftlichen Institutionen in einer auf den Klassengegensatz aufgebauten Gesellschaft eigen. Ihre Aufzeigung kann nur demjenigen als ein Widerspruch im Denken erscheinen, der sich über diese Gegensätze in der wirklichen Gesellschaft nicht klar geworden ist. Wer sie erkannt hat, wird aus einer Kritik der bürgerlichen Republik ebensowenig eine Verherrlichung der Monarchie herauslesen, wie er die Ausführungen, die Marx in seinem Kapital über die degradierenden Tendenzen der Maschine in der kapitalistischen Gesellschaft macht, als eine Verherrlichung des maschinenlosen Kleinbetriebs auffassen wird.
Ob man den Widerspruch anerkennt, der in der Rolle der Republik in der bürgerlichen Gesellschaft liegt oder ihn für das Produkt eines Denkfehlers erklärt, hängt also davon ab, ob und wieweit man die Wirkungen der Klassengegensätze auf das politische Leben anerkennt. Kurt Eisner führte im Vorwärts zum Lobe der Republik aus,
„das in der bürgerlichen Demokratie aus ihren eigenen Existenzbedingungen heraus das Proletariat von den verschiedenen Gruppen der herrschenden Klassen weit intensiver umworben werden muß als in der Monarchie, daß daher in ihr der Klassenkampf verschleierter erscheint ... Daher das Interesse am Arbeiterfang.“
Das letztere bestreite ich durchaus nichts ich habe es vielmehr in meinem Artikel über den Amsterdamer Kongreß ausdrücklich anerkannt. Ich unterscheide mich jedoch dadurch von Eisner, daß ich die Möglichkeit bestreite, durch ein derartiges Umwerben dauernd den Klassenkampf zu verschleiern, und das es mir unmöglich ist, in dieser Verschleierung einen Vorteil für das Proletariat zu entdecken.
Wer das erstere annimmt, der muß der Ansicht sein, das zwischen „den verschiedenen Gruppen der herrschenden Klassen“ „weit intensivere“ Interessengegensätze bestehen, als zwischen den besitzenden Klassen einerseits und dem Proletariat andererseits; wer das zweite annimmt, muß der Ansicht sein, der Klassenkampf sei ein Übel – vielleicht ein unvermeidliches Übel, aber jedenfalls ein Übel, dessen möglichste Abschwächung und Verschleierung einen Vorteil für das Proletariat bilde, so das um deswillen die Republik der Monarchie vorzuziehen sei.
Das ist in der Tat die Ansicht von Jaurès und seinen Freunden, und darin stehen sie im Gegensatz zu den Marxisten, die da erklären, der Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat sei ein fundamentaler, unüberbrückbarer, weit tiefer gehend als irgendein Interessengegensatz innerhalb der besitzenden Klassen. Wohl haben diese in der Republik allen Grund, „Arbeiterfang“ zu treiben, aber nur in den seltensten, stets rasch vorübergehenden Fällen gewähren sie zu diesem Zwecke wirkliche Konzessionen, die das Proletariat kräftiger und kampffähiger machen. In der Regel sind es Scheinkonzessionen, gemacht, um das Proletariat zu spalten, einzuschläfern, auf Irrwege zu leiten oder zu korrumpieren, kurz, um es zu schwächen. Auf die Dauer läßt sich jedoch der Klassengegensatz dadurch nirgends überwinden. Früher oder später bricht er immer wieder durch, und je mehr Konzessionen die Bourgeoisie früher dem Proletariat gemacht, desto mehr muß sie sich dann bedroht fühlen, wenn dieses anfängt, die demokratischen Errungenschaften im eigenen Klasseninteresse statt im Dienste der Bourgeoisie anzuwenden; und desto energischer muß dann jeder Repressionsversuch der Bourgeoisie ausfallen, da diese in der Republik vom Proletariat weit direkter bedroht ist als in der Monarchie, sobald es sich einmal auf die eigenen Füße stellt und des Spieles satt wird, sich von einer Fraktion der Bourgeoisie gegen die andere ausspielen zu lassen.
Gerade darin, daß unter diesen Umständen die Klassengegensätze unvermittelter und schroffer aufeinanderplatzen, als bei gleicher Höhe der ökonomischen Entwicklung in der Monarchie, sehen wir Marxisten einen Vorteil der Republik. Würde sie wirklich, wie Eisner von ihr preisend sagt, die „Klassengegensätze verschleiern“, so müßte das als ein ernstlicher Nachteil in unseren Augen erscheinen, die wir im Klassenkampf die Triebkraft der gesellschaftlichen Entwicklung sehen – solange die Gesellschaft auf Klassengegensätzen beruht – und nicht in dem kategorischen Imperativ der Kantschen Ethik und auch nicht in der berauschenden Kraft der Schlagworte der bürgerlichen Demokratie.
Der Streitpunkt ist also jetzt klar bezeichnet. Es handelt sich nicht um die Frage, ob das Proletariat die Republik vorzuziehen hat oder nicht. Darüber sind wir alle einig. Sondern es handelt sich um die Frage: Mildert die Republik den Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat oder verschärft sie ihn? Wird in der Republik die Bourgeoisie getrieben, arbeiterfreundlicher zu sein, die Befreiung des Proletariats mehr zu fördern oder weniger zu hemmen, als in der Monarchien
Und anderseits: ist es die Aufgabe der Sozialdemokratie, das unleugbar vorhandene soeben der bürgerlichen Republikaner nach Verschleierung der Klassengegensätze zu unterstützen; hat sie die Aufgabe, in dem Proletariat den Glauben zu fördern, der republikanische Bourgeois sei arbeiterfreundlicher als der monarchistische? Darum handelt es sich.
Ist damit die Streitfrage begrenzt, so auch das Gebiet, für welches sie gilt. Sie kann nur auftauchen in einer Republik, sie ist praktisch gegenstandslos in einer Monarchie. Sie kann uns in Deutschland nur beschäftigen wegen unserer internationalen Beziehungen, wegen der Notwendigkeit, uns über die Differenzen der französischen Genossen klar zu werden. Für Deutschland bedeutet die Republik, mit Ausnahme der paar Hansestädte, die aber nicht demokratische Republiken sind, keineswegs eine Form der Klassenherrschaft der Bourgeoisie. Für uns hier nimmt nur ihre andere Seite in Betracht, die, ein Mittel der Emanzipation des Proletariats zu sein.
2. Die amerikanische Republik
Man kann auf zwei Arten unsere Streitfrage erörtern. Einmal in der Weise, das man abstrakt das Wesen der Republik, das der Bourgeoisie und des Proletariats und ihres Klassengegensatzes untersucht – ein sehr umständlicher Weg, um so ermüdender, als er meist durch sehr bekanntes Gebiet zu führen hätte. Für unsere praktischen Zwecke ist jedenfalls kürzer und weniger ermüdend die Untersuchung nicht einer abstrakten Republik, sondern einer konkreten, derjenigen, um die der ganze Streit sich dreht, der französischen. Nur um erkennen zu lassen, das es sich nicht um eine französische Sonderfrage, sondern um ein jeder bürgerlichen Republik eigentümliches Problem handelt, sei kurz noch der amerikanischen Republik gedacht, die einen ganz anderen Typus darstellt, als die französische. In dieser haben wir eine weitgetriebene Zentralisation der Verwaltung wie des ganzen geistigen und politischen Lebens in einer riesigen Hauptstadt, möglichste Einschränkung der Selbstverwaltung von Gemeinde und Departement, hohe Entwicklung aller Mittel der Klassenherrschaft – Armee, Polizei, Staatskirche. Alles das fehlt in den Vereinigten Staaten. Die Klassengegensätze selbst waren dort lange Zeit schwach entwickelt. Die Grundlage der kapitalistischen Ausbeutung bildet die Trennung der Masse der Bevölkerung von ihren Arbeitsmitteln, vor allem dem wichtigsten, dem Grund und Boden. Von diesem gab es aber in den Vereinigten Staaten lange mehr als genug für alle, die danach verlangten. so konnte nicht bloß jeder ein selbständiger Bauer werden, auch der innere Markt wuchs rasch und ebenso die Nachfrage nach Intellektuellen – Advokaten, Verwaltungsbeamten usw. Jedem Menschen, der energisch und intelligent genug war, eröffneten sich die glänzendsten Karrieren, auch wenn er ohne Mittel begann. Die Stellung eines Lohnarbeiters schien gerade für die kampffähigsten der Proletarier nur ein Durchgangsstadium zu sein. Das hinderte die Lohnarbeiter ebenso sehr, ein proletarisches Klassenbewußtsein zu erlangen, als es die Kapitalisten davon abhielt, das Proletariat – oder wenigstens seine kampffähigen Schichten – zu bedrängen und zum Kampfe herauszufordern. Die Republik schien Klassenkampf und Sozialismus nicht aufkommen zu lassen.
Aber das hat sich in den letzten Jahrzehnten gewaltig geändert, wie allgemein bekannt. „1870 waren noch Streiks und Aussperrungen in Amerika kaum bekannt; zwischen 1887 und 1894 war das Land Zeuge von vierzehntausend Kämpfen zwischen Kapital und Arbeit, an denen ungefähr vier Millionen Arbeiter teilnahmen.“ (Hillquitt, History of Socialism in the United States, S. 153). Je mehr aber das amerikanische Proletariat anwächst und der Klassengegensatz zunimmt, desto eifriger ist die Bourgeoisie bemüht, alle Mittel, welche die Republik ihr bietet, zur Niederhaltung des Proletariats anzuwenden. sie betreibt den so gerühmten „Arbeiterfang“ in großartigstem Maßstab, aber nicht durch Gewährung sozialer Reformen – was davon in der letzten Zeit geschaffen worden, ist nicht der Rede wert –, sondern durch systematische Korrumpierung der Massen, durch Überschwemmung des Landes mit einer käuflichen Presse, durch Stimmenkauf bei Wahlen, durch die Gewinnung einflußreicher Arbeiterführer.
In jedem Lande versucht man heute diese Methoden, die Arbeiter zu verwirren und zu korrumpieren. selbst das absolutistische Rußland sah die Versuche des Gendarmenoffiziers Subatoff, eine polizeilich gegängelte Arbeiterbewegung zu schaffen. Aber nirgends werden diese Versuche in solchem Umfang und mit solcher Hartnäckigkeit betrieben wie in der Republik, gerade wegen der republikanischen Freiheit, wegen der Macht des Stimmzettels, der Presse, der Arbeiterkoalitionen. Aber auch nirgendwo haben diese Versuche mehr Erfolg, als gerade in der Republik. Noch leben im amerikanischen Arbeiter die Traditionen der Vorzeit, wo jeder unter ihnen den Marschallstab im Tornister trug, noch glaubt er dank seiner Demokratie besser daran zu sein als die Arbeiter der Monarchien, und des Sozialismus nicht zu bedürfen, der nur ein Produkt des europäischen Despotismus sei. Noch glaubt er, in der Demokratie gebe es keine Klassen und keine Klassenherrschaft, weil das gesamte Volk die politische Macht besitze. Die wichtigste Aufgabe unserer amerikanischen Genossen besteht heute darin, diesen republikanischen Aberglauben zu zerstören, den Arbeiter zur Einsicht zu bringen, das er nicht minder ausgebeutet und geknechtet sei, wie sein Genosse in der Monarchie, das ebenso wie diese die Demokratie ein Werkzeug der Klassenherrschaft geworden ist und das sie erst dann wieder ein Werkzeug werden kann, diese Klassenherrschaft zu brechen, wenn er seinen republikanischen Aberglauben überwunden hat.
Darin besteht heute die Agitation unserer Genossen in Amerika; und sie würden jeden mit Hohngelächter empfangen, der ihnen weismachen wollte, aus dem „Arbeiterfang“ der republikanischen Bourgeoisie entsprängen irgendwelche Vorteile für das Proletariat.
In dieser ihrer Agitation gegen den republikanischen Arbeiterfang werden die Sozialisten Amerikas sehr unterstützt dadurch, das die amerikanische Bourgeoisie bei diesem Mittel, das Proletariat niederzuhalten, nicht stehen bleibt. So gern sie es möchte, es gelingt ihr nicht, den Klassengegensatz dauernd zu „verschleiern“, dieser Schleier zerreißt immer wieder, und je eifriger die Bourgeoisie daran ist, die Arbeiterklasse durch Zuckerbrot zahm zu machen, um so wütender schwingt sie die Peitsche, wenn ihr die Zähmung nicht gelingt. Man braucht nur immer wieder an Kolorado zu erinnern, um zu zeigen, wie brutal die Bourgeoisie alle Machtmittel ausnutzt, die ihr die Republik zur Verfügung stellt, wenn es gilt, widerspenstige Arbeiter niederzuwerfen.
In Amerika findet also der republikanische Aberglaube sehr wenig Anklang in Parteikreisen.
In Frankreich allerdings liegt die Sache nicht so einfach.
3. Die erste Republik in Frankreich
In einer seiner Amsterdamer Reden und jüngst wieder in einer Artikelserie der Humanité führte Jaurès aus, das in der französischen Revolution die Eigenart der proletarischen Taktik Frankreichs begründet liege, die gerade das Gegenteil der deutschen von Marx und Lassalle inaugurierten zu sein habe, da Deutschland leider nie eine ordentliche Revolution gekannt habe. Daran ist soviel richtig, das die Taktik von Jaurès allerdings das Gegenteil nicht bloß der Guesdeschen, sondern auch der Marxschen und Lassalleschen, der deutschen überhaupt ist, während die Guesdesche und die deutsche von demselben Gedankengang getragen wird.
Doch dies nur nebenbei. Was hier in Betracht kommt, ist die Jaurèssche These, das durch die Revolution dem französischen Proletariat eine andere Taktik vorgeschrieben worden sei, als dem deutschen. Dank der Revolution und der Republik habe das Proletariat seit deren Beginn eine große historische Rolle gespielt, „indem es die revolutionäre Bourgeoisie zuerst unterstützte und dann mit sich riß.“ (Humanité vom 14. September)
Auch darin liegt ein richtiger Kern. Kein Zweifel, dank der Revolution – die aber selbst wieder eine Folge einer besonderen ökonomischen Entwicklung und hochgradiger Zuspitzung der Klassengegensätze war – hat das Proletariat in Frankreich früher als in irgendeinem anderen Lande eine große politische Bedeutung erlangt, aber nur zum Teil dadurch, das es „die revolutionäre Bourgeoisie zuerst unterstützte und dann mit sich riß“, sondern zum größten Teile dadurch, das es in Gegensatz zur Bourgeoisie geriet und sie bekämpfte.
Die feudale Monarchie hatte Frankreich am Ende des achtzehnten Jahrhunderts in eine Lage gebracht, vergleichbar der des heutigen Rußland: Niederlagen nach außen, Korruption, ökonomischer Ruin im Innern; die völlige Niederwerfung des Regierungssystems war eine Lebensfrage für die ganze Nation geworden, an der alle Klassen interessiert waren, die nicht direkt an der bestehenden Staatsverwaltung Anteil hatten. Aber diese Niederwerfung wäre damals schon unmöglich gewesen ohne das Eingreifen der unteren Volksschichten, Kleinbürger, Bauern, Proletarier. Sie bewaffneten sich, erstürmten die Bastille, brannten die Schlösser des Adels nieder, hoben die feudalen Lasten auf, begannen die Selbstverwaltung ihrer Gemeinden.
Die konstituierende Nationalversammlung bestätigte nur, was das Volk volle zogen hatte. Durch das Gesetz vom 14. Dezember 1789 wurde die vollständige Selbstverwaltung der Gemeinde anerkannt, kein Regierungsbeamter stand über ihr. Sie erhielt auch ihre eigene bewaffnete Macht in den bewaffneten Bürgern, der Nationalgarde, die ihre Offiziere selbst wählte; das Gesetz vom 22. Dezember setzte die Selbstverwaltung der Departements fest; am 5. Mai 1790 wurde die Wahl der Richter durch das Volk eingeführt, am 12. Juli endlich bestimmt, das jede Gemeinde ihren Pfarrer, jedes Departement seinen Bischof selbst erwähle.
Dieser Umwälzung der Verfassung entsprach eine Umwälzung des Steuerwesens. Die herrschende Klasse versteht es immer, die Lasten des Staates, den sie ausbeutet und der sie schützt, den ausgebeuteten und niedergehaltenen Klassen aufzuladen. Aus dem Steuersystem kann man daher den sozialen Charakter eines Staatswesens erkennen.
Die große Revolution beseitigte natürlich die Steuerfreiheit der privilegierten Klassen, dann aber auch die indirekten Steuern, die Salz- und Getränkesteuern, das Tabaksmonopol, die inneren Zölle und die Gemeindeoktrois. Neben den Reichszöllen und dem Erlös aus dem staatlichen und kommunalen Grundbesitz, der durch die Kirchengüter gewaltig vermehrt wurde, sollten die Staatseinnahmen durch eine einzige direkte Steuer auf das Reineinkommen gelegt werden, das man, nach der damals herrschenden physiokratischen Lehre, ausschließlich in der Grundrente sah. So hatte das Volk die Machtmittel der Klassenherrschaft, Staatsverwaltung, Rechtsprechung, Armee, Kirche, sich zu eigen gemacht und die Lasten der Erhaltung des Staatswesens von sich ab auf die höheren Klassen abgewälzt: in der Tat, eine großartige Leistung, vollbracht durch das unterstützende und vorwärtstreibende Eingreifen des Proletariats und des Kleinbürgertums in den Kampf der Bourgeoisie gegen die Monarchie.
Aber selbst damals schon, als noch eitel Harmonie zwischen Bourgeoisie und Proletariat zu sein schien und ihre Klassengegensätze höchstens in gelegentlichen Hungerrevolten ohne politische Bedeutung zutage traten, warnte ihr Klasseninstinkt die Bourgeoisie vor allzu großen politischen Konzessionen an das Proletariat. Wenn sie schon nicht wagen durfte, die neugewonnene Freiheit direkt zu konfiszieren, so suchte sie diese wenigstens indirekt zu monopolisieren, indem sie die Unterscheidung des Aktiv- und Passivbürgers schuf. Nicht das Volk wurde bewaffnet, sondern nur die Aktivbürger; nur diese hatten die Gemeindevertreter, Richter, Pfarrer usw., sowie endlich die Deputierten in die Nationalversammlung zu wählen. Aktivbürger wurde aber nach dem Gesetz vom 22. Dezember 1789 nur, wer großjährig war, ein Jahr lang im Bezirk wohnte und eine direkte Steuer im Betrag von wenigstens drei landesüblichen Taglöhnen zahlte. Die Zahl der Aktivbürger betrug 4 Millionen bei einer Bevölkerung von etwa 26 Millionen. Überdies waren alle diese Wahlen indirekte, und da sich die Bourgeoisie dadurch noch nicht genügend geschützt glaubte, machte sie die Wählbarkeit für die Nationalversammlung von dem Besitz eines Grudeigentum und dem Zahlen einer direkten Steuer im Betrag von 1 Mark Silber (etwa 50 Franken) abhängig.
Zu dem politischen Schutzwall des Zensur gesellte sich die Berufsarmee. Neben der Nationalgarde blieb das alte Heer bestehen mit seinen oft im Ausland geworbenen Regimentern, die sich zum Teil immer noch gegen das Volk gebrauchen ließen und die der Disziplin unter aristokratischen Offizieren unterworfen blieben. Endlich blieb noch als Schutzwall der besitzenden Klassen die Monarchie erhalten, die allerdings dem Parlament, der Nationalversammlung, untergeordnet wurde, aber immerhin das Kommando über die Armee, die Ernennung der regierenden Minister und das Recht behielt, den Beschlüssen der Nationalversammlung, wenigstens für einen gewissen Zeitraum, die Zustimmung zu versagen, ohne die sie nicht Gesetz werden konnten (das Veto).