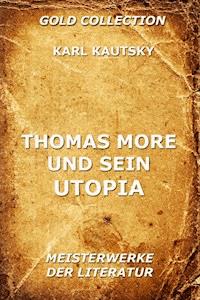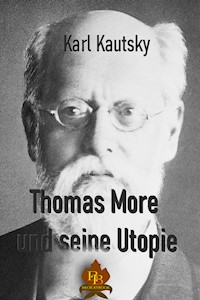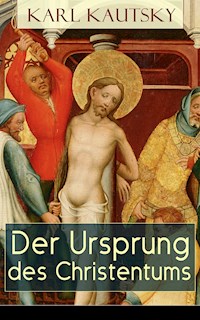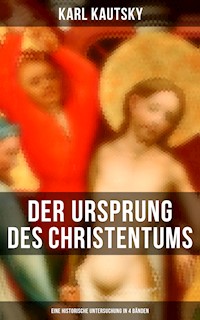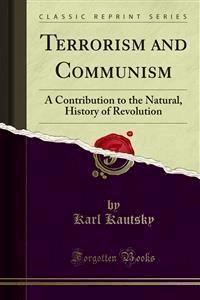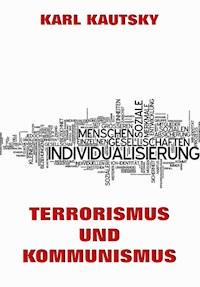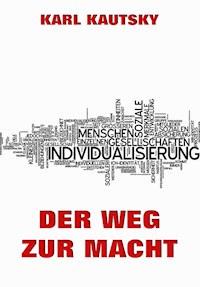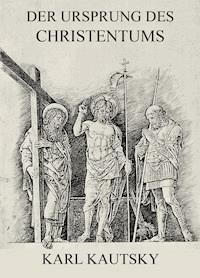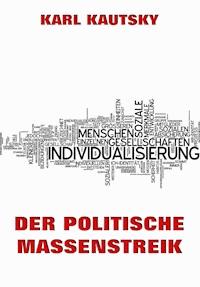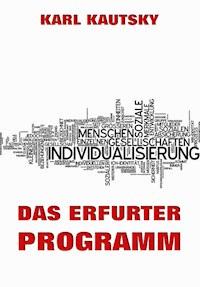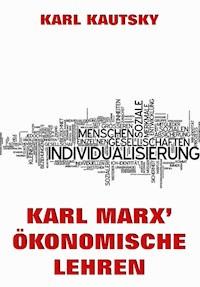
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Werk soll nicht nur eine Darstellung der Marxschen Lehren, sondern auch ein Leitfaden zu dem Studium der Marxschen Werke im Original sein. Der Verfasser hielt sich daher für berechtigt, Stellen, die bisher seines Erachtens zu wenig beachtet worden, oder bei denen leicht Missverständnisse eintraten, eingehender zu behandeln, als ihrer Bedeutung für die theoretische Entwicklung entspricht; er glaubte dagegen bei anderen Stellen kürzer verweilen zu dürfen, wenn sie bereits allgemein bekannt und anerkannt sind und ein Missverständnis nicht befürchtet zu werden braucht. Um den praktischen Wert zu erhöhen, wurde die Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse z. B. bei der Fabrikgesetzgebung, mehrfach über den von Marx behandelten Zeitpunkt hinaus fortgeführt. Inhalt: I. Abschnitt - Ware, Geld, Kapital Erstes Kapitel - Die Ware Zweites Kapitel - Das Geld Drittes Kapitel - Die Verwandlung von Geld in Kapital II. Abschnitt - Der Mehrwert Erstes Kapitel - Der Vorgang der Produktion Zweites Kapitel - Das Verhalten des Kapitals bei der Wertbildung Drittes Kapitel - Der Grad der Ausbeutung der Arbeitskraft Viertes Kapitel - Mehrwert und Profit Fünftes Kapitel - Der Arbeitstag Sechstes Kapitel - Der Mehrwert des "kleinen Meisters" und der Mehrwert des Kapitalisten Siebtes Kapitel -Der relative Mehrwert Achtes Kapitel - Kooperation Neuntes Kapitel - Arbeitsteilung und Manufaktur Zehntes Kapitel - Maschinerie und große Industrie III. Abschnitt - Arbeitslohn und Kapitaleinkommen Erstes Kapitel - Der Arbeitslohn Zweites Kapitel - Das Kapitaleinkommen Drittes Kapitel - Einfache Reproduktion Viertes Kapitel - Verwandlung von Mehrwert in Kapital Fünftes Kapitel - Die Übervölkerung Sechstes Kapitel - Die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsweise
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Marx' Ökonomische Lehren
Karl Kautsky
Inhalt:
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Karl Marx' Ökonomische Lehren
Vorwort zur ersten Auflage
Vorwort zur vierten Auflage
Vorwort zur achten Auflage
I. Abschnitt - Ware, Geld, Kapital
Erstes Kapitel - Die Ware
1. Der Charakter der Warenproduktion
2. Der Wert
3. Der Tauschwert
4. Der Warenaustausch
Zweites Kapitel - Das Geld
1. Der Preis
2. Verkauf und Kauf
3. Der Umlauf des Geldes
4. Die Münze. Das Papiergeld
5. Weitere Funktionen des Geldes
Drittes Kapitel - Die Verwandlung von Geld in Kapital
1. Was ist Kapital?
2. Die Quelle des Mehrwertes
3. Die Arbeitskraft als Ware
II. Abschnitt - Der Mehrwert
Erstes Kapitel - Der Vorgang der Produktion
Zweites Kapitel - Das Verhalten des Kapitals bei der Wertbildung
Drittes Kapitel - Der Grad der Ausbeutung der Arbeitskraft
Viertes Kapitel - Mehrwert und Profit
Fünftes Kapitel - Der Arbeitstag
Sechstes Kapitel - Der Mehrwert des „kleinen Meisters” und der Mehrwert des Kapitalisten
Siebtes Kapitel -Der relative Mehrwert
Achtes Kapitel - Kooperation
Neuntes Kapitel - Arbeitsteilung und Manufaktur
1. Doppelter Ursprung der Manufaktur. Ihre Elemente: der Teilarbeiter und sein Werkzeug
2. Die beiden Grundformen in der Manufaktur
Zehntes Kapitel - Maschinerie und große Industrie
1. Die Entwicklung der Maschinerie
2. Wertabgabe der Maschinerie an das Produkt
3. Die nächsten Wirkungen des maschinenmäßigen Betriebes auf die Arbeiter
4. Die Maschine als „Erzieherin“ des Arbeiters
5. Die Maschine und der Arbeitsmarkt
6. Die Maschine als revolutionärer Agent
III. Abschnitt - Arbeitslohn und Kapitaleinkommen
Erstes Kapitel - Der Arbeitslohn
1. Größenwechsel von Preis der Arbeitskraft und Mehrwert
2. Verwandlung des Preises der Arbeitskraft in den Arbeitslohn
3. Der Zeitlohn
4. Der Stücklohn
5. Nationale Verschiedenheit der Arbeitslöhne
Zweites Kapitel - Das Kapitaleinkommen
Drittes Kapitel - Einfache Reproduktion
Viertes Kapitel - Verwandlung von Mehrwert in Kapital
1. Wie Mehrwert Kapital wird
2. Die Enthaltsamkeit des Kapitalisten
3. Die Enthaltsamkeit des Arbeiters und andere Umstände, die auf den Anfang der Akkumulation einwirken
Fünftes Kapitel - Die Übervölkerung
1. Das „eherne Lohngesetz“
2. Die industrielle Reservearmee
Sechstes Kapitel - Die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsweise
Karl Marx' Ökonomische Lehren, Karl Kautsky
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849628994
www.jazzybee-verlag.de
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Sozialistischer Schriftsteller, geb. 16. Okt. 1854 in Prag, verstorben am 17. Oktober 1938 in Amsterdam. Studierte 1874 bis 1878 in Wien Geschichte und Philosophie, war 1880–82 in Zürich als Schriftsteller tätig, begründete 1883 die sozialistische Revue »Die Neue Zeit« (Stuttg.), die er 1885–88 von London aus, seit 1890 in Stuttgart redigierte; jetzt lebt er in Berlin. K. schloss sich schon als Student der Sozialdemokratie an. Er ist entschiedener Anhänger von K. Marx und Fr. Engels, deren Ideen er zu verbreiten und weiterzubilden bestrebt ist. Er schrieb neben zahlreichen kleineren Abhandlungen: »Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft« (Wien 1880); »Karl Marx' ökonomische Lehren, gemeinverständlich dargestellt und erläutert« (Stuttg. 1887, 8. Aufl., 1904); »Thomas More und seine Utopie« (das. 1887); »Die Klassengegensätze von 1789« (das. 1889); »Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil erläutert« (5. Aufl., das. 1904); »Der Parlamentarismus, die Volksgesetzgebung und die Sozialdemokratie« (das. 1893); »Die Agrarfrage« (das. 1899,2. Aufl. 1902); »Bernstein und das sozialdemokratische Programm« (das. 1899); »Handelspolitik und Sozialdemokratie« (das. 1901); »Die soziale Revolution« (Berl. 1903). In der »Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen« (Stuttg. 1894 ff.) schrieb er »Die Vorläufer des neuern Sozialismus«, 1. Teil, und den Abschnitt über »Thomas More«.
Karl Marx' Ökonomische Lehren
Vorwort zur ersten Auflage
Wer wird nicht einen Klopstock loben? Doch wird ihn jeder lesen? – Nein. Wir wollen weniger erhoben, und fleißiger gelesen sein.
Auf keinen der modernen Schriftsteller dürften diese Zeilen Lessings mit mehr Fug und Recht anzuwenden sein, als auf Marx. Schreiber Dieses ist durch seinen Beruf gezwungen, die neuere deutsche ökonomische Literatur zu verfolgen, und er hat gefunden, dass kein Name in ihr so häufig erwähnt wird, als der von Marx, dessen Lehren der Angelpunkt sind, um den sich die meisten ökonomischen Diskussionen der Neuzeit bewegen. Diese Tatsache erfüllt den Verfasser vorliegender Schrift jedoch keineswegs mit der Genugtuung, die man bei einem Angehörigen der Marschen „Schule“ erwarten sollte, wenn man von einer solchen sprechen darf, denn er hatte leider nur zu oft Gelegenheit, zu konstatieren, dass Diejenigen, die über Marx schrieben, seine Werke entweder gar nicht oder nur sehr flüchtig gelesen hatten. Rechnet man dazu, dass die meisten der Literaten und Gelehrten, die sich mit Marx beschäftigten, dies nicht zum Zweck objektiver, wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern zur Erörterung bestimmter Augenblicks-Interessen taten, dann wird man nicht überrascht sein, zu sehen, dass im Allgemeinen die ungereimtesten Ansichten in Betreff der Marxschen Lehren im Umlauf sind.
Es konnte nicht die Aufgabe von Marx sein, sich im Einzelnen mit der Widerlegung dieser irrtümlichen Auffassungen zu befassen. Seine einzelnen Lehren sind Teile eines festgefügten Systems und können nur verstanden werden in ihrem Zusammenhange; wer diesen nicht erkannt hat, wird bei der Auffassung der einzelnen Sätze stets an der Oberfläche haften bleiben. Irrtümliche Anschauungen konnten daher nicht mit einigen Worten beseitigt werden, sondern nur durch den Hinweis auf die Notwendigkeit eines eingehenden Studiums der Marxschen Schriften, oder durch eine umfassende Darlegung des Marx und Engels eigentümlichen wissenschaftlichen Standpunkts. Eine solche besitzen wir in der Tat in der klassischen Polemik von Engels gegen Dühring, einem Buch, welches das Verständnis der Marxschen Lehren mehr gefördert hat, als alle kurzen apodiktischen Aussprache von Marx darüber, wie er in Bezug auf diesen oder jenen Punkt verstanden sein wolle, vermocht hätten.
In der deutschen Literatur fehlt jedoch noch eine Schrift, welche die ökonomischen Lehren von Marx kurz zusammenfasst, allgemein verständlich darstellt und erläutert. Ansätze zu einer solchen Arbeit sind von verschiedenen Seiten gemacht worden, aber sie sind Fragmente geblieben.
Vorliegende Schrift macht den Versuch, die bestehende Lücke auszufüllen, oder wenigstens einen Beitrag zu ihrer Ausfüllung zu liefern.
Sie lehnt sich naturgemäß an das Hauptwerk von Marx, das Kapital an und folgt ihm in der Anordnung des Stoffes. Die anderen ökonomischen Schriften von Marx konnten nur hie und da herangezogen werden, zur Aufklärung schwieriger Stellen oder zu weiterer Ausführung des im Kapital Gegebenen.
Der Zweck der Darstellung geht in erster Linie dahin, solche, welche entweder nicht Zeit oder Mittel zum Studium des Kapital haben, mit dessen Gedankengang bekannt zu machen; der Verfasser hofft aber, dass seine Darstellung auch Manchen, die das Kapital besitzen, dessen Studium erleichtern, und dass sie endlich Viele veranlassen wird, das Originalwerk zu lesen, von dem sie sich entweder eine falsche Vorstellung gemacht, oder von dessen Studium sie die Schwierigkeiten des ersten Abschnittes abschreckten.
Nichts falscher, als die Ansicht von der trockenen und schwerverständlichen Schreibweise des Kapital. Der Verfasser kennt kein ökonomisches Werk, welches sich an Klarheit und Lebendigkeit der Darstellung, an mitunter wahrhaft klassischer Schönheit des Stils mit dem Kapital messen könnte.
Und doch ist es so schwer verständlich!
An gewissen Stellen allerdings. Aber das ist nicht Schuld der Darstellung.
Man glaubt gewöhnlich, dass die Nationalökonomie ein Wissensgebiet sei, das Jeder mir nichts, dir nichts, ohne die geringsten Vorkenntnisse verstehen könne. Sie ist aber eine Wissenschaft, und zwar eine der schwierigsten, denn es gibt kaum ein anderes Gebilde, das so kompliziert ist, wie die Gesellschaft. Allerdings, zum Verständnis jener Sammlung von Gemeinplätzen, die Marx Vulgärökonomie nennt, ist nicht mehr Wissen notwendig, als jeder Mensch bei den geschäftlichen Vorgängen des täglichen Lebens von selbst erwirbt. Das Verständnis des Kapital von Marx, welches in der Form einer Kritik der politischen Ökonomie ein neues historisches und ökonomisches System begründet, setzt dagegen nicht nur ein gewisses historisches Wissen, sondern auch die Erkenntnis der Tatsachen voraus, welche die Entwicklung der Großindustrie bietet.
Wer nicht die Tatsachen mindestens teilweise kennt, aus denen Marx seine ökonomischen Gesetze abgeleitet, dem wird der Sinn dieser Gesetze allerdings dunkel bleiben, der mag über Mystizismus und Hegelianismus klagen. Die klarste Darstellung wird ihm nichts nützen.
Dies ist unseres Erachtens eine gefährliche Klippe für jeden Versuch, das Kapital zu popularisieren. Marx hat so populär geschrieben, als nur möglich. Wo er schwerverständlich war, lag die Schuld nicht an der Sprache, sondern am Gegenstand und am Leser. Übersetzte man diese so schwerverständlich klingende Sprache ohne weiteres in eine leichtverständlich klingende, so konnte dies nur auf Kosten der Genauigkeit geschehen; die Popularisierung musste zur Verflachung werden.
Mit dieser Erkenntnis war für den Verfasser die Aufgabe gegeben. Sie lag nicht in einer bloßen Änderung der Sprache. Marx hat, wie schon erwähnt, so populär und dabei so kurz und präzis geschrieben, dass ein Abweichen von seinen Worten oft sogar nur auf Kosten der Richtigkeit möglich gewesen wäre. Der Verfasser hat daher eine Reihe von Stellen aus den Marxschen Schriften wörtlich wiedergegeben. Sie sind durch Anführungszeichen kenntlich gemacht und stammen, wenn nicht eine andere Stelle angegeben, aus dem Kapital.
Die Aufgabe lag Einesteils darin, den Leser auf die Tatsachen aufmerksam zu machen, die den theoretischen Ausführungen zu Grunde liegen. Dies war namentlich notwendig im ersten Abschnitt. Marx hat auf diese Tatsachen meist selbst hingewiesen, aber oft nur mit Andeutungen, die in der Regel übersehen wurden. An anderen Stellen musste sich der Verfasser erlauben, auf die Tatsachen auf eigene Verantwortung aufmerksam zu machen. Dies gilt namentlich im ersten Paragraphen des ersten Kapitels. Es konnte sich in vorliegender Arbeit nur um Hinweise handeln. Eine ausführliche Darstellung der dem Kapital zu Grunde liegenden Tatsachen würde nicht nur den zugemessenen Raum, sondern auch die Kräfte des Verfassers weit übersteigen; eine solche hieße nichts geringeres, als eine Entwicklungsgeschichte der Menschheit von der Urzeit an verfassen. Das Kapital ist ein wesentlich historisches Werk.
In den Abschnitten, die von der modernen Industrie handeln, tritt dieser Charakter für Jedermann deutlich hervor. Sie enthalten nicht nur theoretische Ausführungen, sondern auch ausgedehnte historische Exkurse über Gegenstände, die bis dahin nur unvollständig oder gar nicht behandelt worden waren. In diesen Abschnitten sind die den theoretischen Ausführungen zu Grunde liegenden Tatsachen in solcher Fülle gegeben, dass deren Verständnis für jeden Denkenden ohne weitere Vorkenntnisse möglich war. Hier war die Aufgabe eine andere. Die Rücksichten auf den Raum erlaubten nur, das Wichtigste wiederzugeben. Es handelte sich nun darum, trotzdem den historischen Charakter der theoretischen Ausführungen zu wahren, die, wenn mit Weglassung der Mittelglieder gegeben, mitunter einen anderen Charakter erhielten und eine Behauptung als unbedingt erscheinen ließen, die nur unter gewissen historischen Voraussetzungen gültig ist.
Vorliegende Arbeit soll nicht nur eine Darstellung der Marxschen Lehren, sondern auch ein Leitfaden zu dem Studium der Marxschen Werke im Original sein. Der Verfasser hielt sich daher für berechtigt, Stellen, die bisher seines Erachtens zu wenig beachtet worden, oder bei denen leicht Missverständnisse eintraten, eingehender zu behandeln, als ihrer Bedeutung für die theoretische Entwicklung entspricht; er glaubte dagegen bei anderen Stellen kürzer verweilen zu dürfen, wenn sie bereits allgemein bekannt und anerkannt sind und ein Missverständnis nicht befürchtet zu werden braucht. Um den praktischen Wert des Büchleins zu erhöhen, wurde die Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse z. B. bei der Fabrikgesetzgebung, mehrfach über den von Marx behandelten Zeitpunkt hinaus bis zur neuesten Zeit fortgeführt.
Die Marx eigentümlichen Benennungen der einzelnen Kategorien sind beibehalten, Fremdworte jedoch so wenig als möglich gebraucht worden. Völlig ließen sie sich freilich nicht vermeiden. Das deutsche Volk hat seine Kultur und Wissenschaft nicht aus sich allein entwickelt, es hat viele Begriffe, ja ganze Wissenszweige und damit auch eine Reihe von Benennungen von anderen Nationen übernommen. So kommt es, dass wir eine Menge von Fremdworten gebrauchen, die entweder nur auf Kosten der Schärfe und Gedrungenheit des Ausdrucks oder gar nicht ersetzbar sind. Die Übersetzung in Klammern dem Fremdwort beizufügen, ist eine Praxis, für die der Verfasser sich nicht erwärmen kann. Gibt es ein ganz entsprechendes deutsches Wort für das fremde, dann gebrauche man jenes von vorneherein. Gibt es ein solches nicht, dann kann auch die Übersetzung nicht viel nützen. Es ist in solchen Fällen Aufgabe der Darstellung, das Fremdwort in einem solchen Zusammenhange zu bringen, dass es einem denkenden Leser nicht schwer fällt, seinen Sinn zu entnehmen. Nur wo seltenere Fremdworte im Text zum ersten male gebraucht werden, hat der Verfasser die wirkliche Übersetzung oder das nächstkommende deutsche Wort in Klammern beigefügt, um das Verständnis des fremden Wortes zu erleichtern, ohne dass er glaubt, mit dem deutschen Wort den Begriff des fremden völlig zu umfassen.
An Vorarbeiten konnte der Verfasser nur wenig benutzen. Hervorzuheben ist jedoch der französische Kapitalauszug von Deville , der dem Verfasser sehr zu statten kam. An dieser Stelle fühlt er sich auch verpflichtet, seinen Dank abzustatten für die liebenswürdige Bereitwilligkeit, mit der Deville zu Gunsten der vorliegenden Arbeit auf die Herausgabe einer deutschen Übersetzung seiner Schrift verzichtete.
Besondere Förderung erfuhr vorliegende Arbeit durch die freundschaftliche Teilnahme und Mitarbeiterschaft Eduard Bernsteins, der sich nicht auf Anregungen und Hinweise, sowie eine kritische Durchsicht des Manuskripts beschränkte, sondern verschiedene Kapitel selbständig bearbeitete. So rührt z. B. das große und wichtige Kapitel über die Großindustrie (im 2. Abschnitt) fast völlig von ihm her.
Diese Förderung und Unterstützung erkennt der Verfasser um so dankbarer an, je mehr er sich der Schwierigkeit seiner Aufgabe bewusst ist. Für die volkstümlichen Darstellungen großer origineller Geisteswerke gilt dasselbe, was Lessing den Prinzen Conti von der Malerei sagen lässt.
„Ha! Dass wir nicht unmittelbar mit den Augen malen können! Auf dem langen Wege aus dem Auge durch den Arm in den Pinsel, wie viel geht da verloren!“
Wenn zwei Maler genau den gleichen Gegenstand malen, so wird er auf jedem der beiden Bilder anders aussehen. Was der eine sieht, wird der andere übersehen; was dein einen bedeutsam erscheint, wird der andere nebensächlich behandeln: und was sie verschiedenartig gesehen, wird wieder verschiedenartig wiedergegeben. Das getreue Erfassen des Originals ist schwer; es getreu wiederzugeben, ist noch schwerer.
Was der Verfasser hier gibt, ist nicht eine Photographie des Kapital, die das Original in verkleinertem Maßstab, Linie um Linie völlig getreu, aber farblos wiedergibt, sondern ein Bild mit subjektivem Kolorit und subjektiver Zeichnung.
Ist auch, um Schwerfälligkeiten zu vermeiden, die Darstellung oft eine apodiktische, so bitten wir den Leser, doch stets im Auge zu behalten, dass es nicht Marx, sondern der Verfasser ist, der zu ihm spricht, der ihm über die ökonomischen Lehren von Marx berichtet. Man mag dies für eine bescheidene Aufgabe halten. Der Schreiber dieser Zeilen wird sich jedoch hochbefriedigt fühlen, wenn sie ihm gelungen, wenn er sein Scherflein beigetragen zur Verbreitung der Wahrheiten, die ein rastloser Forscher, ein gründlicher Gelehrter, ein großer Denker als Frucht der Arbeit seines ganzen Lebens zu Tage gefördert.
London, im Oktober 1886K. Kautsky
Vorwort zur vierten Auflage
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieser Schrift haben sich einige der tatsächlichen Verhältnisse sehr geändert, auf die zur Illustrierung der theoretischen Ausführungen Bezug genommen wurde. Wir ergriffen daher gern die Gelegenheit, die uns vorliegende Neuauflage bot, Veraltetes auszuscheiden und die neueste Entwicklung zu berücksichtigen.
Auch stilistisch wurde die Schrift revidiert und verschiedene Stellen, die uns bei dieser Prüfung etwas schwer verständlich erschienen, wurden klarer gefasst.
Außer diesen Äußerlichkeiten haben wir nichts zu ändern gefunden. Das Buch ist im Wesentlichen dasselbe geblieben.
Sein Hauptzweck ging ursprünglich bloß dahin, dem deutschsprechenden Teil des Proletariats das Studium der Marxschen Lehren zu erleichtern. Wir haben jedoch mit Freuden gesehen, dass es auch ein Mittel geworden ist, nichtdeutschen Nationen, die aus dem einen oder andern Grunde einer Übersetzung des Marxschen Kapital noch nicht teilhaftig geworden sind, dessen Inhalt wenigstens einigermaßen zugänglich zu machen. Vorliegende Schrift ist übersetzt worden ins Schwedische, Tschechische und Polnische. Weitere Übersetzungen werden vorbereitet.
Diese Übersetzungen sind eines der vielen Symptome des Interesses, das gegenwärtig die Proletarier aller Länder den Marxschen Lehren entgegenbringen, der Bedeutung, welche die Ideen des Stifters der „Internationale“ für das internationale kämpfende Proletariat gewonnen haben.
Eine neue internationale Arbeiterassoziation ist im Erstehen, weit mächtiger und gewaltiger, als die frühere gewesen. Keine Organisation vereinigt sie. Das materielle Band, das sie zusammenhält, ist das gemeinsame Interesse der Proletarier in den verschiedenen Ländern der kapitalistischen Produktion; das geistige Band, das sie einigt, ist – das kann man wohl ohne Übertreibung sagen – der Ideengehalt des Kapital. Möge vorliegende Schrift auch ihren kleinen Teil beitragen zur Vereinigung der Proletarier aller Länder durch dieses geistige Band.
Stuttgart, im Oktober 1892K. Kautsky
Vorwort zur achten Auflage
Zwei Jahre nach der letzten Auflage dieses Büchleins, die ich vor der jetzigen, achten, durchgesehen, erschien der langersehnte dritte Band des Kapital, der uns so viele neue und überraschende Einsichten gewährte. In eine Darstellung der ökonomischen Lehren von Karl Marx gehörte von da an selbstverständlich auch ein Abriss des Hauptinhalts des dritten Bandes. Das ist jedoch keine einfache Sache und erfordert mehr Ruhe und Zeit, als mir seither zu Gebote stand. Gerade nach dem Erscheinen des dritten Bandes nahm die Agrarfrage meine volle Aufmerksamkeit in Anspruch; und kaum hatte ich meine Studien darüber zu einem äußerlichen Abschluss gebracht, da wurde ich durch die von der revisionistischen Richtung entfesselten theoretischen Kämpfe völlig absorbiert. Jetzt scheint es, dass auch diese neueste Krise des Marxismus überwunden sei, nun habe ich aber meine ganze Kraft einer Aufgabe zuzuwenden, die mir schon 1895 zugefallen war und die ich über den beiden anderen ebenerwähnten schon zu lange vernachlässigt habe: die Herausgabe der von Marx hinterlassenen, ca. 1500 bis 1600 Druckseiten umfassenden historisch-kritischen Darstellung der Theorien vom Mehrwert, die einen Teil des Manuskripts Zur Kritik der politischen Ökonomie ausmacht und deren Herausgabe Engels als Ersatz für den vierten Band des Kapital plante.
Eine ausgedehnte internationale Korrespondenz und die redaktionelle Tätigkeit engen meine zur Herausgabe dieses Riesenwerkes verfügbare Zeit ohnehin ein; es ist klar, dass ich wenigstens jede aufschiebbare Arbeit zurückstelle.
So komme ich auch jetzt noch nicht dazu, die notwendige Erweiterung der ökonomischen Lehren vorzunehmen. Ich habe mich diesmal damit begnügt, das Ganze durchzusehen, einzelne veraltete Angaben über Arbeiterschutzgesetze, statistische Zahlen und dergleichen durch neuere Daten zu ersetzen und ein Kapitel einzufügen über Mehrwert und Profit, in dem ich wenigstens die Grundlage des dritten Bandes, das Gesetz der Durchschnittsprofitrate, kurz zur Darstellung bringe.
Im Übrigen habe ich bei meiner Durchsicht des Ganzen nichts zu ändern gefunden. Es ist eine weitverbreitete Ansicht, die auch von manchem Marxisten geteilt wird, als sei die von uns Marxisten ehedem vertretene Auffassung des ersten Bandes des Kapital durch den dritten Band völlig umgewälzt und als unhaltbar erwiesen worden. Nichts ist irriger als das. Ich habe nach dem Erscheinen des dritten Bandes das vorliegende Buch einer Revision unterzogen, und dabei in theoretischer Beziehung nicht das mindeste zu ändern gefunden. Ich durfte allerdings von vornherein erwarten, dass ich zu diesem Resultat kommen würde, denn Engels hatte das Manuskript der ersten Auflage bereits durchgesehen und es gebilligt zu einer Zeit, wo er schon den Inhalt des dritten Bandes kannte. Hätte er Auffassungen in dem Buche gefunden, die durch den dritten Band als falsch erwiesen wurden, so hätte er mich sicher darauf aufmerksam gemacht.
Für das Gebiet, das der erste Band des Kapital vornehmlich untersucht, jenes, das den Sozialisten hauptsächlich beschäftigt und das auch in der vorliegenden Schrift fast ausschließlich behandelt wird, für das Verhältnis zwischen der Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse, spielt die Verwandlung des Mehrwerts in den Profit keine Rolle; hier kommt man völlig mit den Gesetzen des Werts und Mehrwerts aus. Dies war auch der Grund, warum Marx im ersten Bande vom Profit völlig absah.
Man darf sich aber nicht etwa einbilden, wie das vielfach geschieht, als hätte Marx, als er den ersten Band des Kapital schrieb, nur die Gesetze des Werts und des Mehrwerts gekannt, und seine Profitratentheorie sei später nur eine hinterdrein ersonnene Ausflucht der Verlegenheit gewesen, um seine Werttheorie mit den ihr anscheinend widersprechenden Erscheinungen der Wirklichkeit zu versöhnen. Vielmehr war, als Marx den ersten Baud schrieb, bereits die ganze Theorie, inbegriffen die Gesetze des Profits und der Grundrente, in seinem Kopfe völlig fertig, und wenn er mit ihrer Darstellung nie zu einem formellen Abschluss kam, so lag das an seiner Gewissenhaftigkeit, die ihn immer wieder zu erneutem Studium der neu auftauchenden Tatsachen trieb, und nicht etwa daran, dass er mit sich selbst nicht ins Reine kommen konnte.
Das wird unzweifelhaft klar für Jedermann werden, sobald die Darstellung der Theorien vom Mehrwert im Drucke fertig vorliegt. In dem Manuskript, das aus den Jahren 1861-63 stammt, sind bereits sämtliche Theorien des dritten Bandes entwickelt. Würde der dritte Band den ersten aufheben, dann hätte Marx diesen, der 1867 erschien, „überwunden“, ehe er ihn noch geschrieben!
Die Theorien vom Mehrwert werden für das Verständnis der Marxschen Theorie vom Mehrwert nicht minder wichtig sein wie für das Verständnis der in dem Werke selbst untersuchten und kritisierten Theorien. Ich hoffe, es wird mir gelingen, allen Störungen zum Trotz, diesen Abschluss des Marxschen Lebenswerkes bald der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Berlin-Friedenau, im Mai 1903K. Kautsky
I. Abschnitt - Ware, Geld, Kapital
Erstes Kapitel - Die Ware
1. Der Charakter der Warenproduktion
Was Marx in seinem Kapital zu erforschen sich vornahm, war die kapitalistische Produktionsweise, welche die heute herrschende ist. Er beschäftigt sich in dem Werk nicht mit den Naturgesetzen, die dem Vorgang des Produzierens zu Grunde liegen; deren Erforschung ist eine der Aufgaben der Mechanik und Chemie, nicht der politischen Ökonomie. Er stellt sich andererseits nicht die Aufgabe, nur die Formen der Produktion zu erforschen, die allen Völkern gemein, da eine solche Untersuchung zum großen Teil nur Gemeinplätze zu Tage fördern kann, wie etwa den, dass der Mensch, um produzieren zu können, stets Werkzeuge, Boden und Lebensmittel braucht. Marx untersuchte vielmehr die Bewegungsgesetze einer bestimmten Form des gesellschaftlichen Produzierens, die einer bestimmten Zeit (den letzten Jahrhunderten) und bestimmten Nationen eigentümlich ist (den europäischen oder aus Europa stammenden; in letzter Zeit beginnt sich diese unsere Produktionsweise auch bei anderen Nationen einzubürgern, z. B. bei den Japanesen und Hindus). Diese, heute herrschende Produktionsweise, die kapitalistische, deren Eigentümlichkeiten wir noch näher kennen lernen werden, ist von anderen Produktionsweisen streng geschieden, z. B. der feudalen, wie sie in Europa im Mittelalter herrschte, oder der urwüchsigen kommunistischen, wie sie an der Schwelle der Entwicklung aller Völker steht.
Betrachten wir die heutige Gesellschaft, so finden wir, dass ihr Reichthum aus Waren besteht. Eine Ware ist ein Arbeitsprodukt, das nicht für den eigenen Gebrauch, sei es des Produzenten oder mit ihm verbundener Menschen, sondern zum Zeit des Austausches mit anderen Produkten erzeugt worden. Es sind also nicht natürliche, sondern gesellschaftliche Eigentümlichkeiten, welche ein Produkt zur Ware machen. Ein Beispiel wird das klar machen. Das Garn, das ein Mädchen in einer urwüchsigen Bauernfamilie aus Flachs spinnt, damit aus ihm Leinwand gewebt werde, welche in der Familie selbst verbraucht wird, ist ein Gebrauchsgegenstand, aber keine Ware. Wenn aber ein Spinner Flachs verspinnt, um vom Nachbar Bauer Weizen gegen das Leinengarn einzutauschen, oder wenn gar ein Fabrikant tagaus tagein viele Zentner von Flachs verspinnen lässt, um das Produkt zu verkaufen, so ist dieses eine Ware. Es ist wohl auch Gebrauchsgegenstand, aber Gebrauchsgegenstand, der eine besondere gesellschaftliche Rolle zu spielen hat, d. h. der ausgetauscht werden soll. Man sieht es dem Leinengarn nicht an, ob es eine Ware ist oder nicht. Seine Naturalform kann ganz dieselbe sein, ob es in einer Bauernhütte zur Aussteuer der Spinnerin von dieser selbst gesponnen worden, oder in einer Fabrik von einem Fabrikmädchen, das vielleicht nie auch nur einen Faden davon selbst benutzen wird. Erst an der gesellschaftlichen Rolle, der gesellschaftlichen Funktion, in der das Leinengarn tätig ist, kann man erkennen, ob es Ware ist oder nicht.
In der kapitalistischen Gesellschaft nehmen nun in immer steigendem Maße die Arbeitsprodukte die Form von Waren an; wenn heute noch nicht alle Arbeitsprodukte bei uns Waren sind, so deswegen, weil noch Reste früherer Produktionsweisen in die jetzige hineinragen. Sieht man von diesen ab, die ganz unbedeutend find, so kann man sagen, dass heute alle Arbeitsprodukte die Form von Waren annehmen. Wir können die heutige Produktionsweise nicht verstehen, wenn wir uns über den Charakter der Ware nicht klar geworden. Wir haben daher mit einer Untersuchung der Ware zu beginnen.
Das Verständnis dieser Untersuchung wird jedoch unseres Erachtens sehr gefördert, wenn wir vor Allem die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Warenproduktion im Gegensatz zu anderen Arten der Produktion darlegen. Wir gelangen dadurch am leichtesten zum Verständnis des Standpunktes, den Marx bei seiner Untersuchung der Ware eingenommen.
Soweit wir in der Geschichte des Menschengeschlechts zurücksehen können, immer finden wir, dass die Menschen in kleineren oder größeren Gesellschaften ihren Lebensunterhalt erworben haben, dass die Produktion stets einen gesellschaftlichen Charakter hatte. Marx hat diesen bereits in seinen Artikeln über Lohnarbeit und Kapital in der Neuen Rheinischen Zeitung (1849) klar dargetan.
„In der Produktion beziehen sich die Menschen nicht allein auf die Natur,“ heißt es da. „Sie produzieren, indem sie auf eine bestimmte Weise zusammenwirken und ihre Tätigkeiten gegen einander austauschen. Um zu produzieren, treten sie in bestimmte Beziehungen und Verhältnisse zu einander, und nur innerhalb dieser gesellschaftlichen Beziehungen und Verhältnisse findet ihre Beziehung zur Natur, findet die Produktion statt.
„Je nach dem Charakter der Produktionsmittel werden natürlich diese gesellschaftlichen Verhältnisse, worin die Produzenten zu einander treten, die Bedingungen, unter welchen sie ihre Tätigkeiten austauschen und an dem Gesamtakt der Produktion teilnehmen, verschieden sein. Mit der Erfindung eines neuen Kriegsinstruments, des Feuergewehrs, änderte sich notwendig die ganze innere Organisation der Armee, verwandelten sich die Verhältnisse, innerhalb deren Individuen eine Armee bilden und als Armee wirken können, änderte sich auch das Verhältnis verschiedener Armeen zu einander.
„Die gesellschaftlichen Verhältnisse, worin die Individuen produzieren, die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse, ändern sich also, verwandeln sich mit der Veränderung und Entwicklung der Produktionsmittel, der Produktionskräfte. Die Produktionsverhältnisse in ihrer Gesamtheit bilden das, was man die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Gesellschaft nennt, und zwar eine Gesellschaft auf bestimmter, geschichtlicher Entwicklungsstufe, eine Gesellschaft mit eigentümlichem, unterscheidendem Charakter.“
Einige Beispiele mögen das Gesagte illustrieren. Nehmen wir irgend ein urwüchsiges Volk, das auf einer niederen Stufe der Produktion steht, bei dem Jagd einen Hauptzweig der Erwerbung von Nahrungsmitteln bildet, wie die Indianer. Dodge berichtet in seinem Buch Uber die heutigen Indianer des fernen Westens folgendes über deren Art und Weise, zu jagen:
„Da Kopf und Herz nur gelegentlich zu Hilfe gerufen werden, die Anforderungen des Magens aber unaufhörlich sind, so steht der Stamm gewöhnlich unter der Herrschaft des ‚dritten Standes.‘ Diese Macht besteht aus sämtlichen Jägern des Stammes, welche eine Art Zunft oder Gilde bilden, von deren Entscheidungen in ihrem eigenen besonderen Bereich es keine Appellation gibt. Unter den Cheyennen heißen diese Männer ‚Hundesoldaten.‘ Die jüngeren und rührigeren Häuptlinge gehören stets diesen ‚Hundesoldaten‘ an, befehligen dieselben aber nicht notgedrungen. Die ‚Soldaten‘ selbst verfügen durch mündlichen Entschluss über allgemeine Angelegenheiten, deren Einzelheiten dann den unter ihnen ausgewählten berühmtesten und scharfsinnigsten Jägern überlassen bleiben. Unter diesen ‚Hundesoldaten‘ befinden sich viele Jungen, welche die einweihende Probe als Krieger noch nicht bestanden haben. Mit einem Wort, diese Jägerzunft umfasst die ganze Arbeitskraft der Bande und ist diejenige Macht, welche die Weiber und Kinder beschützt und mit Nahrung versieht.
„Jedes Jahr finden die großen Herbstjagden statt, um möglichst viel Wild zu erlegen und einen bedeutenden Fleischvorrath für den Winter einzutun und zu dörren. Jetzt sind die ‚Hundesoldaten‘ die Herren des Tages, und wehe dem Unglücklichen, der auch die unbedeutendsten ihrer willkürlichen oder demokratischen Bestimmungen ungehorsam zu missachten wagt! Wenn alles fertig ist, so ziehen die besten Jäger Morgens lange vor Tagesanbruch aus. Werden mehrere Büffelherden entdeckt, so wird diejenige zum Schlachten ausersehen, deren Stellung so ist, dass die einleitenden Vorkehrungen und Manöver zum Umzingeln derselben und das Geschrei und Schießen beim Anreiten am wenigsten im Stande ist, die übrigen Herden zu beunruhigen ... Während dieser ganzen Zeit hält der gesamte männliche Teil der Bande, welcher bei der bevorstehenden Niedermetzlung der Büffel mitzuwirken im Stande ist, zu Pferde auf einem Haufen in irgend einer benachbarten Schlucht, außerhalb des Gesichtskreises der Büffel, schweigend und vor Aufregung zitternd. Ist die Herde in einer für die Jagd günstigen Stellung, so zählen die leitenden Jäger ihre Leute ab und schicken sie unter zeitweiligen Anführern nach den vorbezeichneten Örtlichkeiten. Wenn der leitende Jäger dann sieht, dass jeder Mann an seiner richtigen Stelle und Alles bereit ist, so sucht er mit einer Abteilung Reiter die Herde zu umflügeln und die offene Seite zu schließen, gibt dann das Zeichen und nun sprengt die ganze Schaar mit einem gellenden Geschrei, das beinahe die Toten auferwecken könnte, voran und dringt dicht auf das Wild ein. Binnen wenigen Minuten ist das Gemetzel in vollem Gange; einige wenige mögen den Kordon durchbrochen haben und entkommen sein, diese werden aber nicht verfolgt, wenn andere Herden in der Nähe sind.
„Als noch Bogen und Pfeile allein gebraucht wurden, kannte jeder Krieger seine Pfeile und hatte keine Schwierigkeit, die von ihm getöteten Büffel positiv zu erkennen. Diese waren ganz sein individuelles Eigenthum, ausgenommen, dass er um einen gewissen Teil desselben besteuert wurde zum Besten der Witwen oder der Familien, welche keinen Krieger als Versorger für sich hatten. Fanden sich Pfeile von verschiedenen Männern in demselben toten Büffel, so wurden die Eigentumsansprüche je nach deren Lage entschieden. Wenn jeder Pfeil eine tödliche Wunde verursachte, so wurde der Büffel geteilt, oder nicht selten auch irgend einer Witwe zugeschieden. Der oberste Jäger entschied alle derartigen Fragen, allein gegen seine Entscheidung konnte noch eine Berufung an das allgemeine Urteil der ‚Hundesoldaten‘ eingelegt werden. Seit aber der allgemeine Gebrauch der Feuerwaffen die Identifizierung der toten Büffel unmöglich gemacht hat, sind die Indianer in ihren Ansichten kommunistischer geworden , und die gesamte Masse von Fleisch und Häuten wird nach irgend einem Maßstab der gleichen verhältnismäßigen Verteilung nach ihrer eigenen Erfindung ausgeteilt.“ (S. 206–211)
Wir sehen, bei diesem Jägervolke wird gesellschaftlich produziert; es wirken verschiedene Arten von Arbeit zusammen, um ein Gesamtresultat zu erzielen.
Wir finden hier bereits Anfänge der Arbeitsteilung und des planmäßigen Zusammenarbeitens (der Kooperation ). Je nach den verschiedenen Fähigkeiten verrichten die Jäger verschiedene Arbeiten, aber nach gemeinsamem Plane. Das Ergebnis des Zusammenwirkens der verschiedenen Arbeiten, „des Austausches der Tätigkeiten,“ wie Marx sich in Lohnarbeit und Kapital ausdrückt, die Jagdbeute, wird nicht ausgetauscht, sondern verteilt.
Nur nebenbei sei darauf hingewiesen, wie die Änderung in den Produktionsmitteln – Ersetzung von Bogen und Pfeil durch das Feuergewehr – eine Änderung des Verteilungsmodus zur Folge hat.
Betrachten wir nun eine andere, höhere Art einer gesellschaftlichen Produktionsweise, z. B. die auf dem Ackerbau beruhende indische Dorfgemeinde. Von dem urwüchsigen Kommunismus, der in derselben herrschte, finden sich in Indien nur noch einige kümmerliche Reste. Aber Nearch, der Admiral des makedonischen Alexander des Großen, berichtete noch, nach Strabo, XV, I, 66, von Gegenden Indiens, wo das Land Gemeineigentum war, gemeinsam bebaut und nach der Ernte der Ertrag des Bodens unter die Dorfgenossen verteilt wurde. Nach Elphinstone hat diese Gemeinschaft noch im Anfang unseres Jahrhunderts in einigen Teilen Indiens bestanden. Auf Java besteht der Dorfkommunismus in der Weise fort, dass das Ackerland von Zeit zu Zeit von Neuem unter die Dorfgenossen verteilt wird, welche ihre Anteile nicht als Privateigenthum, sondern nur zur Nutznießung für eine bestimmte Periode erhalten.
In Vorderindien ist das Ackerland meist schon in das Privateigenthum der einzelnen Dorfgenossen übergegangen, Wald, Weide und unbebauter Boden sind jedoch vielfach noch Gemeineigenthum, an dem alle Gemeindemitglieder das Nutzungsrecht haben.
Was uns an einer solchen Dorfgemeinde interessiert, die noch nicht dem zersetzenden Einfluss der englischen Herrschaft, namentlich der durch diese eingeführten Steuersysteme, zum Opfer gefallen, ist der Charakter, den die Arbeitsteilung in derselben annimmt. Wir fanden bereits bei den Indianern eine solche; eine viel höhere jedoch bietet die indische Dorfgemeinde.
Neben dem Gemeindevorstand, der Pateel heißt, wenn er aus einer einzelnen Person besteht, Pantsch dagegen, wenn er ein Kollegium von meist fünf Mitgliedern bildet, finden wir in der indischen Wirtschaftskommune noch eine Reihe von Beamten: den Karnam oder Matsaddi, den Rechnungsführer, der die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde zu ihren einzelnen Mitgliedern und zu anderen Gemeinden und zum Staate zu überwachen und zu leiten hat; den Tallier für die Erforschung von Verbrechen und Übertretungen, dem zugleich der Schuss der Reisenden und deren sicheres Geleit über die Gemeindegrenze in die nächste Gemeinde obliegt; den Toti, den Flurschütz und Landvermesser, der darauf zu sehen hat, dass nicht benachbarte Gemeinden die Grenzen der Flur verrücken, ein Umstand, der sich namentlich beim Reisbau leicht ereignen kann; den Aufseher über die Wasserläufe, der sie im Stand zu halten und dafür zu sorgen hat, dass sie gehörig geöffnet und geschlossen werden und jedes Feld genügend Wasser erhalte, was insbesondere beim Reisbau von großer Wichtigkeit; den Brahmanen zur Vollziehung der notwendigen Gottesdienste; den Schullehrer, der die Kinder im Lesen und Schreiben unterrichtet; den Kalender-Brahmanen oder Astrologen, der die glücklichen oder unglücklichen Tage für Säen, Ernten, Dreschen und andere wichtigen Arbeiten auszuforschen hat; den Schmied, den Zimmermann und Rademacher; den Töpfer; den Wäscher; den Barbier; den Kuhhirten; den Arzt; die Devadaschi (das Tanzmädchen); mitunter sogar einen Sänger.
Alle diese haben für die ganze Gemeinde und deren Mitglieder zu arbeiten und werden dafür entweder durch Anteile an der Feldmark, oder durch Anteile an den Ernteerträgen entschädigt. Auch hier bei dieser hochentwickelten Arbeitsteilung sehen wir Zusammenwirken der Arbeiten, Verteilung der Produkte.
Nehmen wir noch ein Beispiel, das Jedermann bekannt sein dürfte: das einer patriarchalischen Bauernfamilie, die ihren Bedarf selbst befriedigt; ein gesellschaftliches Gebilde, das sich aus einer Produktionsweise heraus entwickelt hat, wie wir sie eben in der indischen Wirtschaftskommune geschildert haben, einer Produktionsweise, die sich im Anfang der Entwicklung aller näher bekannten Kulturvölker nachweisen lässt.
Eine solche Bauernfamilie zeigt uns ebenfalls keine isolierten Menschen, sondern ein gesellschaftliches Zusammenarbeiten und ein Zusammenwirken verschiedener Arbeiten, die nach Alter, Geschlecht und Jahreszeit wechseln. Da wird gepflügt, gemäht, das Vieh gewartet, gemolken, Holz gesammelt, gesponnen, gewebt, genäht, gestrickt, geschnitzt, gezimmert &c. &c. Die verschiedensten Arbeiten wirken da zusammen, beziehen sich aufeinander; die Produkte werden hier ebenso wenig wie in den früheren Beispielen von den einzelnen Arbeitern ausgetauscht, sondern unter diese den Verhältnissen entsprechend verteilt.
Nehmen wir nun an , die Produktionsmittel einer Ackerbaugemeinde, wie wir sie geschildert, vervollkommneten sich so sehr, dass weniger Arbeit als bisher dem Ackerbau zu widmen ist. Arbeitskräfte werden frei, die vielleicht, wenn die technischen Hilfsmittel so weit entwickelt, dazu verwendet werden, ein auf dem Gemeindegebiet gelegenes Lager von Feuerstein auszubeuten, Feuersteinwerkzeuge und Waffen zu fabrizieren. Die Produktivität der Arbeit ist so groß, dass weit mehr Werkzeuge und Waffen erzeugt werden, als die Gemeinde braucht.
Ein Stamm nomadischer Hirten kommt auf seinen Wanderungen in Berührung mit dieser Gemeinde. Die Produktivität der Arbeit ist in diesem Stamm auch gestiegen, er ist dahin gekommen, mehr Vieh zu züchten, als er bedarf. Es liegt nahe, dass dieser Stamm gern seinen Überschuss an Vieh gegen überschüssige Werkzeuge und Waffen der Ackerbaugemeinde austauschen wird. Das überschüssige Vieh und die überschüssigen Werkzeuge werden durch diesen Austausch zu Waren.
Der Warenaustausch ist die natürliche Folge der Entwicklung der Produktivkräfte über die engen Bedürfnisse der urwüchsigen Gemeinwesen hinaus. Der ursprüngliche Kommunismus wird, von einer gewissen Höhe der technischen Entwicklung an, zu einer Schranke für deren Fortschreiten. Die Produktionsweise fordert eine Erweiterung des Kreises der gesellschaftlichen Arbeit; da aber die einzelnen Gemeinwesen einander fremd und unabhängig gegenüber standen, war diese Erweiterung nicht möglich durch Erweiterung der kommunistischen planmäßigen Arbeit, sondern nur durch gegenseitigen Austausch der Überschüsse der Arbeit der Gemeinwesen.
Wie der Warenaustausch auf die Produktionsweise innerhalb der Gemeinwesen zurückwirkte, bis die Warenproduktion die Produktion von einander unabhängiger Privatarbeiter wurde, denen die Produktionsmittel und die Produkte ihrer Arbeiten privateigenthümlich gehören, haben wir nicht zu untersuchen. Was wir zeigen wollen, ist Folgendes: Die Warenproduktion ist eine gesellschaftliche Art der Produktion; sie ist außerhalb des gesellschaftlichen Zusammenhanges undenkbar, ja sie bedeutet eine Ausdehnung der gesellschaftlichen Produktion über die Grenzen der ihr vorhergehenden kommunistischen (im Stamm, der Gemeinde oder der patriarchalischen Familie) hinaus. Aber der gesellschaftliche Charakter tritt bei ihr nicht offen zu Tage.
Nehmen wir einen Töpfer und einen Ackerbauer, einmal als Mitglieder einer indischen kommunistischen Dorfgemeinde, das andere mal als zwei Warenproduzenten. In dem ersteren Falle arbeiten beide in gleicher Weise für die Gemeinde; der eine liefert ihr seine Töpfe, der andere seine Feldfrucht ab; der eine erhält seinen Anteil an Feldfrüchten, der andere an Töpfen. Im zweiten Falle betreibt jeder unabhängig für sich seine Privatarbeit, aber Jeder arbeitet (vielleicht in demselben Maße, wie früher) nicht nur für sich, sondern auch für den Anderen. Hierauf tauschen sie ihre Produkte aus, und möglicherweise erhält der Eine eben so viel Feldfrüchte, der Andere eben so viel Töpfe, als er früher erhalten. Es scheint sich wesentlich nichts geändert zu haben, und doch sind beide Prozesse von einander grundverschieden.
In dem ersteren Falle sieht Jeder sofort, dass es die Gesellschaft ist, welche die verschiedenen Arbeiten in Zusammenhang bringt, welche den Einen für den Anderen arbeiten lässt und Jedem seinen Anteil an dem Arbeitsprodukt des Anderen direkt zuweist. Im zweiten Falle arbeitet Jeder anscheinend für sich, und die Art und Weise, wie Jeder zu dem Produkt des Anderen gelangt, scheint nicht dem gesellschaftlichen Charakter ihrer Arbeit geschuldet, sondern den Eigentümlichkeiten des Produkts selbst. Es scheint jetzt, dass nicht der Töpfer und der Feldarbeiter für einander arbeiten, dass also die Töpferarbeit und die Feldarbeit für die Gesellschaft notwendige Arbeiten sind, sondern dass den Töpfen und den Feldfrüchten mystische Eigenschaften inne wohnen, die ihren Austausch in gewissen Verhältnissen bewirken. Die Verhältnisse der Personen unter einander, wie sie der gesellschaftliche Charakter der Arbeit bedingt, erhalten unter der Herrschaft der Warenproduktion den Anschein von Verhältnissen von Dingen, nämlich von Produkten, unter einander. So lange die Produktion direkt vergesellschaftet war, unterlag sie der Bestimmung und Leitung der Gesellschaft und lagen die Verhältnisse der Produzenten zu einander klar zu Tage. Sobald aber die Arbeiten zu Privatarbeiten wurden, die unabhängig von einander betrieben wurden, sobald die Produktion damit eine planlose wurde, erschienen die Verhältnisse der Produzenten zu einander als Verhältnisse der Produkte. Fortan lag die Bestimmung der Verhältnisse der Produzenten zu einander nicht mehr bei diesen selbst; diese Verhältnisse entwickelten sich unabhängig vom Willen der Menschen, die gesellschaftlichen Mächte wuchsen ihnen über den Kopf, sie erschienen der naiven Anschauung vergangener Jahrhunderte als göttliche Mächte, sie erscheinen späteren „aufgeklärteren“ Jahrhunderten als Mächte der Natur.
Den Naturalformen der Waren werden jetzt Eigenschaften zugeschrieben, die mystisch erscheinen, so lange sie nicht aus den Verhältnissen der Produzenten zu einander erklärt werden. Wie der Fetischanbeter seinem Fetisch Eigenschaften andichtet, die nicht in seiner natürlichen Beschaffenheit begründet sind, so erscheint dem bürgerlichen Ökonomen die Ware als ein sinnliches Ding, das mit übersinnlichen Eigenschaften begabt. Marx nennt dies „den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden, und daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist.“
Diesen Fetischcharakter der Ware – und, wie wir später sehen werden, auch des Kapitals – hat Marx zuerst erkannt. Der Fetischismus ist es, der die Erkenntnis der Eigentümlichkeiten der Ware erschwert, ja unmöglich macht, so lange er nicht überwunden ist; es ist unmöglich, zum vollen Verständnis des Warenwertes zu gelangen, ohne sich des Fetischcharakters der Ware bewusst zu werden. Das Kapitel über