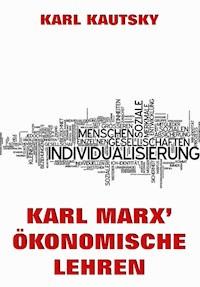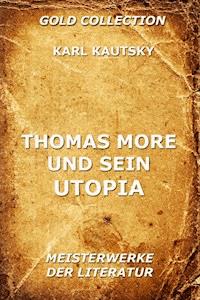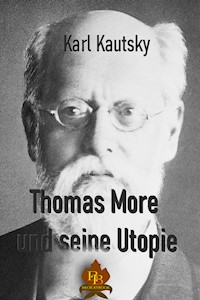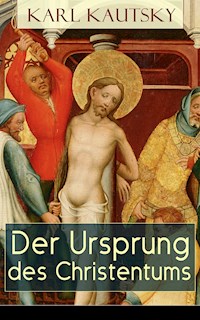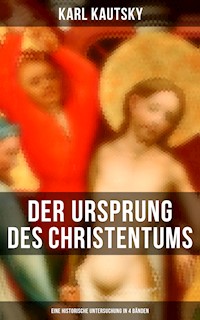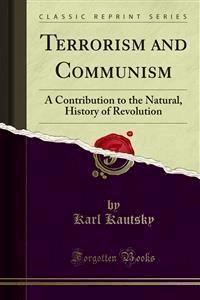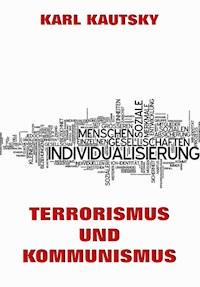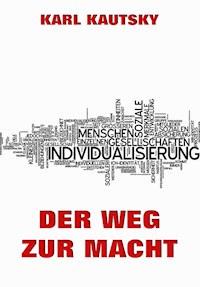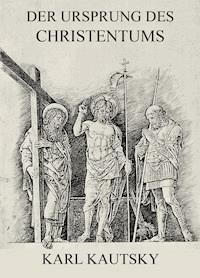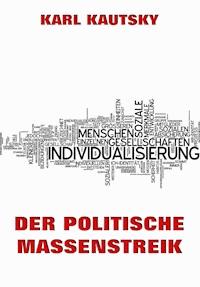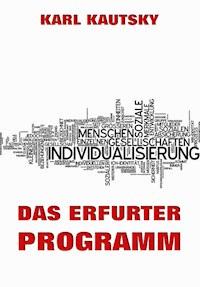Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses umfassende Werk Kautskys setzt sich mit den Zuständen im Rußland Trotzkis auseinander und spart nicht mit Kritik an der dort herrschenden Regierung. Inhalt: Vorwort I. Einleitendes II. Das Reitenlernen III. Die Demokratie a) Primitive und moderne Demokratie b) Die Bedeutung der Demokratie für den Aufstieg des Proletariats c) Die Bedrohung der Demokratie durch die Reaktion d) Die Entwaffnung der Bourgeoisie IV. Die Diktatur a) Die Marxsche Auffassung b) Die Diktatur der Stadt c) Diktatur und Revolution d) Die Diktatur der Verschwörer e) Der Bolschewismus f) Die Ergebnisse der bolschewistischen Diktatur g) Der drohende Zusammenbruch V. Der Arbeitszwang a) Der Arbeitermangel b) Theoretische Begründung der Arbeitspflicht c) Das Faultier d) Die Lohnarbeit e) Die freie Persönlichkeit f) Die Regelung der Arbeit durch den Sozialismus g) Der Antrieb zur Arbeit im Sozialismus h) Der reaktionäre Charakter des Bolschewismus
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von der Demokratie zur Staatssklaverei
Karl Kautsky
Inhalt:
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Von der Demokratie zur Staatssklaverei
Vorwort
I. Einleitendes
II. Das Reitenlernen
III. Die Demokratie
a) Primitive und moderne Demokratie
b) Die Bedeutung der Demokratie für den Aufstieg des Proletariats
c) Die Bedrohung der Demokratie durch die Reaktion
d) Die Entwaffnung der Bourgeoisie
IV. Die Diktatur
a) Die Marxsche Auffassung
b) Die Diktatur der Stadt
c) Diktatur und Revolution
d) Die Diktatur der Verschwörer
e) Der Bolschewismus
f) Die Ergebnisse der bolschewistischen Diktatur
g) Der drohende Zusammenbruch
V. Der Arbeitszwang
a) Der Arbeitermangel
b) Theoretische Begründung der Arbeitspflicht
c) Das Faultier
d) Die Lohnarbeit
e) Die freie Persönlichkeit
f) Die Regelung der Arbeit durch den Sozialismus
g) Der Antrieb zur Arbeit im Sozialismus
h) Der reaktionäre Charakter des Bolschewismus
Von der Demokratie zur Staatssklaverei, Karl Kautsky
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849628956
www.jazzybee-verlag.de
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Sozialistischer Schriftsteller, geb. 16. Okt. 1854 in Prag, verstorben am 17. Oktober 1938 in Amsterdam. Studierte 1874 bis 1878 in Wien Geschichte und Philosophie, war 1880–82 in Zürich als Schriftsteller tätig, begründete 1883 die sozialistische Revue »Die Neue Zeit« (Stuttg.), die er 1885–88 von London aus, seit 1890 in Stuttgart redigierte; jetzt lebt er in Berlin. K. schloss sich schon als Student der Sozialdemokratie an. Er ist entschiedener Anhänger von K. Marx und Fr. Engels, deren Ideen er zu verbreiten und weiterzubilden bestrebt ist. Er schrieb neben zahlreichen kleineren Abhandlungen: »Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft« (Wien 1880); »Karl Marx' ökonomische Lehren, gemeinverständlich dargestellt und erläutert« (Stuttg. 1887, 8. Aufl., 1904); »Thomas More und seine Utopie« (das. 1887); »Die Klassengegensätze von 1789« (das. 1889); »Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil erläutert« (5. Aufl., das. 1904); »Der Parlamentarismus, die Volksgesetzgebung und die Sozialdemokratie« (das. 1893); »Die Agrarfrage« (das. 1899,2. Aufl. 1902); »Bernstein und das sozialdemokratische Programm« (das. 1899); »Handelspolitik und Sozialdemokratie« (das. 1901); »Die soziale Revolution« (Berl. 1903). In der »Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen« (Stuttg. 1894 ff.) schrieb er »Die Vorläufer des neuern Sozialismus«, 1. Teil, und den Abschnitt über »Thomas More«.
Von der Demokratie zur Staatssklaverei
Eine Auseinandersetzung mit Trotzki
Vorwort
Die vorliegende Schrift wurde im Juni d. J. fertiggestellt, zu einer Zeit, in der die Welt noch nichts von der entsetzlichen Katastrophe ahnte, die jetzt durch Mißernte, Hungersnot und Seuchen über das russische Volk herausgebrochen ist.
Was Rußland heute vom Ausland in erster Linie braucht, Hilfeleistung, rasche und ausgiebige Hilfeleistung und nicht Kritik. Doch ist leider auch diese keineswegs überflüssig. Denn die Hungersnot ist nicht ein Produkt von Naturgewalten allein.
Gewiß ist die Dürre nicht ein Ergebnis der Sowjetregierung. Eine Konstituante hätte keinen Tropfen mehr Regen gebracht. Aber ein Ergebnis des Sowjetregimes ist es, daß Rußland von der Katastrophe überrascht wurde und nicht imstande ist, sich allein zu helfen.
Wenn die russische Landwirtschaft normal funktionieren würde, könnten die von der Dürre nicht betroffenen Gebiete des russischen Reiches genügende Überschüsse an Nahrung liefern, um das Defizit der Gebiete der Mißernte zu decken. Und wären die Eisenbahnen nicht unter der Moskauer Wirtschaft völlig zusammengebrochen, so vermöchten sie den Hungergebieten genügende Lebensmittel zuzuführen.
Heute muß man die Lebensmittel aus Amerika holen, und sie werden wegen des Mangels an Transportmitteln nicht weit in das Hungergebiet vordringen können.
Diese Übel lassen sich leider durch keine Änderung des Staatskurses rasch genug beheben, daß ihre Beseitigung bei der Bekämpfung des Massenelends in Betracht kommen könnte.
Eines aber ist sofort möglich.
Rußland leidet nicht bloß unter dem Verkommen seiner Produktion und seines Transportwesens, sondern auch unter dem Mangel an Bewegungsfreiheit. Das lähmt das russische Volk, verwandelt es in einen lebenden Leichnam, macht es unfähig, sich selbst zu helfen.
Nur das Fehlen jeglicher Preßfreiheit konnte es möglich machen, daß die weit erst Mitte Juli von der Mißernte erfuhr, von der Tatsache, daß in den Gebieten der Dürre seit März kein Regen gefallen war. Dem Kongreß der dritten Internationale, der bis zum Juli in Moskau tagte, wurde noch nichts von der Mißernte und Hungersnot gesagt. Fast müßte man annehmen, daß die Sowjetregierung damals selbst noch nichts davon wußte, sonst wäre es doch sträfliche Leichtfertigkeit gewesen, die Tatsache zu verheimlichen, statt sofort alles aufzubieten, um die Hilfeleistung in Gang zu bringen, ehe die Not alles Maß überschritt und Millionen direkt verhungerten.
Die Hilfeleistung könnte selbst nur dann die nötige Energie erlangen, wenn die Tatkraft des ganzen Volkes ihrer Fesseln entledigt und von der bureaukratischen Bevormundung befreit würde.
Dies zu tun, ist heute das wichtigste, was in Rußland selbst zur Bekämpfung der Hungersnot und der Seuchen geschehen kann.
Sicher darf die Hilfsaktion des Auslandes nicht an politische Bedingungen geknüpft werden. Aber das russische Volk und die russische Regierung müssen sich dessen bewußt werden, daß diese Aktion nur dann ihr bestes erreichen kann, wenn sie unterstützt wird durch die energische Mitwirkung des russischen Volkes selbst, die unmöglich ist, solange bureaukratische Einschnürung und Bevormundung es lähmt.
Die russische Regierung ist bereits dazu übergegangen, ökonomische Konzessionen zu machen. Von politischen will sie nichts wissen. Aber gerade diese können rascher wirken und sind in der heutigen Situation wichtiger, als die ökonomischen.
Ich weiß wohl, daß in der Politik Zureden in der Regel nichts hilft, am allerwenigsten gegenüber einer Diktatur. Aber wenn dieses Zureden unterstützt wird durch eine so eindringliche Sprache, wie sie der augenblickliche Zusammenbruch der russischen Ernährungswirtschaft spricht, dann bleibt es vielleicht doch nicht ohne Wirkung.
So glaube ich, daß das vorliegende Büchlein durch die russische Mißernte nicht überflüssig gemacht wird, obwohl ich es abfaßte, ohne von ihr Kenntnis zu haben.
Rußland aus dem Sumpfe herauszuführen, in dem es zu ersticken droht, ist die dringendste Aufgabe der Zeit, die dringendste Aufgabe vor allem für jeden Sozialisten, denn Sozialisten sind es, in deren Hände das Schicksal des russischen Volkes gelegt ist.
Die Irrlichter zu verlöschen, die sie immer tiefer in den Sumpf lockten, ihnen den Weg aus ihm heraus auf festen Boden zu weisen, ist unsere oberste Pflicht.
K. Kautsky
Berlin, August 1921
I. Einleitendes
Im Jahre 1919 veröffentlichte ich eine Schrift, in der ich historisch-kritische Parallelen zwischen der französischen Schreckensherrschaft von 1793, der Pariser Kommune von 1871 und der jetzigen Sowjetrepublik Rußlands zog.
Diese Arbeit, betitelt Terrorismus und Kommunismus, veranlaßte Trotzki, mir zu antworten und meine „gelehrte Schmähschrift“, wie er sich in seinem Vorwort ausdrückt, zu widerlegen. Er findet es in jenem Vorwort auch sonderbar, daß ich meine Schrift einen „Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution“ nenne. Vielleicht gibt es ihm etwas zu denken, wenn er daran erinnert wird, daß Marx im Vorwort zur 1. Auflage des Kapital von den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion spricht.
Trotzkis Erwiderung erschien im Sommer 1920 unter dem Titel: Terrorismus und Kommunismus, Anti-Kautsky, herausgegeben vom westeuropäischen Verlag der Kommunistischen Internationale. Wo ich in folgendem bei Zitaten bloß Seitenzahlen ohne Buchtitel angebe, ist das eben genannte Buch gemeint.
Daß ich nicht sofort zu einer Antikritik das Wort ergriff, sondern andere Arbeiten erledigte, die mir wichtiger dünkten, bezeugt schon, daß die Einwände Trotzkis mir nicht sehr schlagend erschienen, trotz des schweren Geschützes, das er auffahren läßt. Nennt er doch meine Schrift „eines der lügenhaftesten und gewissenlosesten Bücher“, das „unter einer gelehrten Kappe die Ohren des Ehrabschneiders hervorlugen läßt.“ (S. 154) Und er konstatiert: „Die russische Revolution hat Kautsky endgültig getötet“. (S. 153) Man muß sich nur wundern, warum da Lenin und Trotzki es noch notwendig finden, Bücher zu schreiben, um mich immer wieder von Neuem zu toten. Darauf zu antworten, fällt mir nicht ein und ebensowenig haben meine österreichischen Freunde Ursache, verteidigt zu werden, die Trotzki in seiner Antwort an mich ebenfalls aufs stärkste angreift.
Nur zur Erheiterung der Leser sei mitgeteilt, daß Trotzki gegen Fritz Adler den schweren Vorwurf erhebt:
„Friedrich Adler ging in ein bürgerliches Restaurant, um dort den österreichischen Ministerpräsidenten zu ermorden!“ (S. 150)
Er war so bar jedes proletarischen Empfindens, daß er dem Ministerpräsidenten nicht in einer Proletarierkneipe zu begegnen suchte. Wie tief gesunken muß da erst der Tischler Chalturin gewesen sein, der sich, um den Zaren in die Luft zu sprengen, 1880 in den kaiserlichen Winterpalast begab!
In den Jahren 1918 und 1919 war es noch schwierig, am Bolschewismus Kritik zu üben, zu einer Zeit, wo er noch das ganze revolutionär gesinnte Proletariat blendete und faszinierte. Heute sprechen die Tatsachen eine so laute Sprache, daß es keines besonderen Scharfsinnes mehr bedarf, um die Fehler des Bolschewismus zu erkennen.
Wenn ich trotzdem noch auf Trotzkis Schrift zurückkomme, so geschieht es nicht zu Zwecken der Abwehr, sondern um einige Gedanken zu entwickeln, zu denen er mich angeregt hat. Er äußert eine Reihe von, Auffassungen, über die eine Aussprache notwendig erscheint, weil in unseren eigenen Reihen darüber nicht allenthalben die nötige Klarheit herrscht.
Drei Fragen sind es, zu deren Erörterung Trotzki mich angeregt hat. Einmal die, aus welchen Gründen wir die Demokratie fordern. Ob wir keine anderen Gründe dafür haben, als die des Naturrechts.
Zweitens die, was die Diktatur eigentlich bedeutet. So viel darüber diskutiert worden ist und so viel an diktatorischer Praxis wir in den letzten Jahren gesehen haben, so wenig ist Klarheit darüber geschaffen worden, was die Diktatur in Wirklichkeit eigentlich sein soll. Je mehr das Wort gebraucht wird, desto unklarer erscheint es, desto widerspruchsvoller werden seine mannigfachen Anwendungen.
Endlich drittens tritt uns in der Broschüre Trotzkis die Frage entgegen, wie sich der Sozialismus zum Arbeitszwang stellt.
II. Das Reitenlernen
Ehe ich an die Erörterung dieser wichtigen Fragen herantrete, sei eine kleine Auseinandersetzung vorausgeschickt, deren Anlaß etwas scherzhafter Natur ist.
Trotzki hatte selbst 1918 in seiner Schrift Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten zugegeben, daß es dem russischen Proletariat an Organisation, Disziplin, Schulung mangle. Trotzdem hätten die Bolschewiks ihm die Fähigkeit zur Neuordnung des Produktionsprozesses zugetraut. „Wir waren überzeugt, daß wir alles erlernen und alles einrichten werden.
Darauf erwiderte ich in meiner Schrift Terrorismus usw., S. 117:
„Würde wohl Trotzki es wagen, eine Lokomotive zu besteigen und sie in Gang zu setzen, in der Überzeugung, er werde schon während ihres Laufes alles erlernen und einrichten?“ Kein Zweifel, er wäre dazu befähigt, aber bliebe ihm dazu die Zeit? Würde nicht bald die Lokomotive entgleist oder explodiert sein? Man muß die Qualitäten zur Lenkung einer Lokomotive vorher erlangt haben, ehe man es unternimmt, sie in Gang zu setzen. So muß das Proletariat vorher die Eigenschaften erworben haben, die es zur Leitung der Produktion befähigen, wenn es diese übernehmen soll. Sie duldet kein Vakuum, keinen Zustand der Leere, des Stillstandes, und am allerwenigsten in einem Zustand, wie ihn der Krieg geschaffen hat, der uns aller Vorräte entblößte, so daß wir von der Hand in den Mund leben und durch das Stocken der Produktion direkt dem Hungertod ausgeliefert werden.“
Trotzki zitiert aus diesen Ausführungen die Sätze über die Lokomotive und stellt ihnen folgende Betrachtung entgegen:
„Dieser lehrreiche Vergleich würde jedem Dompfarrer Ehre machen. Trotzdem ist er einfältig. Mit einem unvergleichlich größeren Recht könnte man fragen: würde Kautsky es wagen, sich rittlings auf ein Pferd zu setzen, bevor er gelernt hat, fest im Sattel zu sitzen und den Vierfüßler bei jeder Gangart zu lenken? Wir haben Grund anzunehmen, daß Kautsky sich zu einem so gefährlichen, rein bolschewistischen Experiment nicht entschließen würde. Anderseits fürchten wir aber auch, daß Kautsky, wenn er kein Pferd zu besteigen wagt, hinsichtlich der Erforschung der Geheimnisse des Reitens in eine schwierige Lage geraten würde. Denn das grundlegende bolschewistische Vorurteil besteht eben darin, daß man das Reiten nur erlernen kann, wenn man fest auf einem Pferde sitzt. (S. 82)“
Trotzki kennt mich leider schlecht. Ich habe in früheren Zeiten gelegentlich das „gefährliche, rein bolschewistische Experiment“ keineswegs gescheut und ein Pferd bestiegen, ohne Reiten gelernt zu haben. Und ich wurde nicht nur nicht abgeworfen, sondern habe lange Touren ohne Unfall auf dem Pferderücken gemacht. Und trotzdem verbleibe ich dabei, es für ein „grundlegendes bolschewistisches Vorurteil“ zu halten, zum Reiten lernen gehörten nur der Wille und die Courage, sich aufs Pferd zu setzen. Nein, verehrter Genosse Trotzki, dazu gehört auch eine Reihe Vorbedingungen. Ich hatte wohl das Reiten nicht erlernt, ehe ich das Pferd bestieg, aber das Pferd hatte, ehe ich es bestieg, gelernt, einen Reiter zu tragen. Und ich ritt nicht allein, sondern mit Freunden, die Reiten gelernt hatten und mir Winke und Anweisungen geben. Endlich wurde mir die Sache erleichtert dadurch, daß ich durch Turnen meinen Körper wohl geübt hatte. Wenn ich aber, ohne vorherige Übung meiner Muskeln und Nerven, allein, ohne den Rat sachverständiger Freunde es mir hätte beifallen lasen, ein nicht zugerittenes Pferd ohne Sattel und Zaum zu besteigen, in der Erwartung, ich brauche blos oben zu sitzen, um reiten zu lernen, dann wäre ich wohl binnen weniger als fünf Minuten abgeworfen worden. Und jedem anderen ginge es ebenso. Wenn der Herr Kriegsminister mir das nicht glaubt, dann frage er nur seine Kavalleristen. Natürlich kann man nicht reiten lernen ohne den Willen und die Courage, ein Pferd zu besteigen. Aber das allein genügt nicht, sondern Pferd und Reiter müssen vorbereitet und bestimmte Bedingungen müssen gegeben sein, soll es zu erfolgreichem Reiten kommen. So muß auch ein bestimmter Grad der Reife des Proletariats und der kapitalistischen Produktion und der theoretischen Einsicht erreicht sein, wenn aus dem Willen und der Courage des Proletariats zu politischer und sozialer Allmacht etwas Ersprießliches herauskommen soll. Das Beispiel mit dem Reiten spricht nur dafür, daß dem so ist, durchaus nicht dagegen. Wenn man mit dem sich über „Schmähschriften“ entrüstenden Trotzki von „Einfältigkeit“ reden will, so gibt es nichts einfältigeres, als Analphabeten einzureden, es genüge, wenn sie die Courage haben, sich das höchste zuzutrauen, um es auch zu leisten. Sie brauchten nichts gelernt zu haben. Die Praxis werde sie schon ausreichend belehren. Unter dem Zarismus bestand in Rußland der Glaube, ein General verstehe alles, ohne es gelernt zu haben. Man könne ihm jedes Ressort anvertrauen, er werde sich überall zurechtfinden. Die Bolschewiki haben das einfältige Vertrauen, daß Gott mit einem Amt auch den dazu nötigen Verstand gibt, nicht beseitigt; ihr Fortschritt besteht darin, daß sie vom Proletariat behaupten, was früher die Zaren von ihren Generalen glaubten.
Indes wird vielleicht gegen das Beispiel vom Reiten ein Bedenken erhoben werden. Heute allerdings fängt man das Reiten auf geschulten Pferden, mit einem ausgebildeten technischen Apparat an Sätteln, Steigbügeln, Zügeln und unter der Anweisung geübter Reiter an. Aber einmal muß der Mensch doch angefangen haben, ohne Reitlehrer, ohne Reitzeug, ein ungerittenes Pferd zu besteigen. Die ersten Menschen, die das Reiten zuwege brachten, müssen doch die Kühnheit gehabt haben, sich ohne alle Vorbereitung auf ein Pferd zu schwingen. Vorher muß es ihnen ganz unmöglich gewesen sein, irgendwelche Erfahrungen in bezug auf das Reiten zu gewinnen. Also nur dadurch, daß sie sich aufs Pferd setzten, konnten sie die zum richtigen Reiten nötige Reife der Bedingungen schaffen.
Das sieht unwiderleglich aus und ist es doch nicht. In fast allen Dingen ist nichts schwerer zu erforschen, als die ersten Anfänge. Die liegen meist sehr im Dunklen. Am meisten bei Vorgängen, die in vorhistorischer Zeit begonnen haben. Da ist man nur auf Indizienbeweise und Hypothesen angewiesen.
Es scheint mir indessen alles darauf hinzuweisen, daß der Mensch nicht auf dem Pferde das Reiten gelernt hat, sondern auf dem Esel, der in den ältesten Zeiten viel mehr als Reittier genannt wird, wie das Pferd. Der Esel war weniger temperamentvoll, bedächtiger, niedriger, leichter zu besteigen. Da lag es nahe, nachdem man ihn an das Tragen toter Lasten gewöhnt, deren Abwerfen keinen großen Schaden anrichten konnte, und nachdem der Zügel zu seiner Lenkung erfunden war, ihn auch zur Beförderung von Menschen zu benutzen.
Das gezähmte Pferd scheint zunächst nur dazu gebraucht worden zu sein, schnellfüßigen Jünglingen rasche Fortbewegung zu erleichtern, indem sie sich an der Mähne festhielten und neben dem Pferde einherliefen, von ihm halb getragen, halb gezogen. Erst nachdem die Pferde auf diese Weise zu Kameraden des Menschen geworden waren, und nachdem man die beim Esel entwickelten Erfahrungen und technischen Behelfe auf sie übertrug, waren die Vorbedingungen geschaffen für Menschen, die sich mit dem Wesen des Pferdes besonders gut vertraut gemacht hatten, Pferde zu besteigen, die ihnen besonders anhänglich waren. Bei den Reitervölkern verbindet den Menschen und das Pferd die innigste Freundschaft. Nur bei solchen, vom Menschen aufgezogenen, nicht bei wild eingefangenen Pferden konnten die ersten Reitversuche gelingen.
Also auch von dieser Seite betrachtet, zeigt das Beispiel des Reitens, daß eine bestimmte Reife der Bedingungen erforderlich war, ehe man mit Erfolg versuchen konnte, ein Pferd zu besteigen und es sich dienstbar zu machen.
Wer das „rein bolschewistische Experiment“ riskiert, ohne die nötigen Vorbedingungen, ohne Kenntnis der Pferdenatur, und ohne große durch Leibesübungen erlangte Gewandtheit, ohne Sattel, Steigbügel, Zügel, ein ungerittenes Pferd zu besteigen, im Vertrauen auf Trotzkis Versicherung, er brauche sich nur rittlings aufs Pferd zu setzen, alles weitere würden ihn seine Erfahrungen lehren, dessen erste Erfahrung wird die sein, daß er binnen wenigen Minuten im Graben liegt, im besten Fall zerfetzt und zerschunden, wahrscheinlicher aber mit gebrochenem Genick.
Das russische Volk und die Proletarier aller Länder, so weit sie dem Kommunismus anhängen, erfreuen sich heute dieser angenehmen Konsequenzen der bolschewistischen Methode, aufs rascheste vorwärts zu kommen.
Doch Trotzki ist noch nicht geschlagen. Er fragt, wo das Proletariat denn die ihm nötige Reife herbekommen soll, ehe es zur Macht gelangt.
„Die Bourgeoisie errichtet für das Proletariat keine Akademien für Staatsverwaltung und überläßt ihm den Staatshebel nicht zu zeitweiligen Versuchen.“ (S. 82)
Andere Mittel für das Proletariat, sich zu bilden und höher zu entwickeln, kennt Trotzki offenbar nicht. Er hat ganz vergessen, daß der Kampf gegen die Bourgeoisie, der jahrzehntelange Klassenkampf, die Akademie des Proletariats ist. In diesem Kampfe begründet es riesenhafte Organisationen mit großen Verwaltungsaufgaben. Dieser Kampf zwingt es, sich eine Presse zu schaffen, drängt es, den Erforschern des gesellschaftlichen Gefüges seine Aufmerksamkeit zu schenken; er bringt ihm wachsenden Einfluß und wachsende Erfahrungen in bezug auf Staat und Gemeinden.
Das ist die Methode, durch die das Proletariat die Fähigkeiten erwirbt, um im Sattel zu sitzen.
Bereits 1850, als er noch Blanquistischen Ideengängen nahe stand und den Klassenkampf vornehmlich in der Form des Bürgerkriegs sah, rief Marx seinen putschistischen Gegnern im Kommunistenbund zu:
„Während wir den Arbeitern sagen: Ihr habt 15, 20, 50 Jahre Bürgerkriege und Völkerkämpfe durchzumachen, nicht nur um die Verhältnisse zu ändern, sondern um euch selbst zu ändern und zur politischen Herrschaft zu befähigen, sagt ihr im Gegenteil: ‚Wir müssen gleich zur Herrschaft kommen, oder wir müssen uns schlafen legen.‘“
Die Kommunisten lieben es, den jungen Marx aus der Zeit um 1848 herum zu zitieren, aber für das eben abgedruckte Zitat zeigen sie kein Interesse.
Doch Trotzki hat noch ein Argument in Bereitschaft, eines, das ihm „vielleicht das wichtigste“ erscheint:
„Niemand läßt dem Proletariat die Wahl, ob es das Pferd besteigen will oder nicht, ob es die Macht gleich ergreifen oder dies aufschieben soll.“
Gewiß gibt es solche Situationen. Eine solche war in Rußland nach dem militärischen Zusammenbruch von 1917 gegeben. Freilich stimmt schlecht zu dem obigen Satz das krampfhafte Streben, allenthalben die Weltrevolution zu machen, ohne Rücksicht auf die gegebenen realen Verhältnisse der verschiedenen Länder außerhalb Rußlands.
Doch hier fragen wir nicht, ob die Ergreifung der politischen Macht durch das Proletariat in Rußland zu billigen war oder nicht: Die russische Revolution von 1917 war ein Elementarereignis wie jede große Revolution, das man ebenso wenig verhindern, wie nach Belieben herbeiführen konnte. Aber damit ist noch nicht die Frage beantwortet, was die Sozialisten in diesem Falle zu tun hatten. Und da liegt die Antwort für einen Marxisten klar zutage: sie hatten den gegebenen Reifegrad der ökonomischen Verhältnisse sowie des Proletariats in Betracht zu ziehen und danach die Aufgaben zu bestimmen, die sie dem siegreichen Proletariat setzten.
Vor dem Aufkommen der marxistischen Geschichtsauffassung, die die geschichtliche Entwicklung von der ökonomischen abhängig macht, und weiß, daß diese gesetzmäßig vor sich geht und keine Phase überspringen kann – vor dieser Geschichtsauffassung sahen in Zeiten des Umsturzes die Revolutionäre keine Schranken für ihr Wollen. Mit einem Sprunge suchten sie das Höchste zu erreichen. Dabei scheiterten sie stets und daher endete jede Revolution, trotz des wirklichen Fortschritts, den sie brachte, mit einem Zusammenbruch der Revolutionäre. Marx lehrt die Methode, auch in revolutionären Zeiten sich nur solche praktische Aufgaben zu stellen, die mit den gegebenen Mitteln und Kräften zu lösen sind und dadurch Niederlagen zu vermeiden.
Diese Methode haben die Menschewiki in Rußland empfohlen, in Georgien zur Anwendung gebracht, mit bestem Erfolg. Die Bolschewiks dagegen haben dem russischen Proletariat Aufgaben gestellt, die es bei der Unreife der Verhältnisse unmöglich zu lösen vermochte. Kein Wunder, daß ihr Kommunismus gescheitert ist; aber ebenso selbstverständlich, daß sie niemand grimmiger hassen, als die Menschewiki, deren Existenz und deren Gedeihen in Georgien gegen den Bolschewismus beständig die Anklage erhob, daß er die Revolution durch seine Methoden ruiniere, die er bei anderer Methode hätte erfolgreich gestalten können.
Darum mußten die Menschewiki in Rußland und Georgien in brutalster und grausamster Weise vernichtet und vor dem internationalen Proletariat verleumdet werden als Gegenrevolutionäre.
Natürlich bringt die Verlogenheit als Mittel des politischen Kampfes den Lügner mitunter in arge Verlegenheit. So wurde mir aus Briansk erzählt, daß zur Zeit Denikins dort bolschewistische Werber für die rote Armee auftauchten. Wie überall, so erzählten sie auch dort den Arbeitern, die Menschewiks seien mit Denikin im Bunde. So sollten zwei Fliegen mit einem Schlage getroffen werden: Denikin und die Menschewiks. Jedoch die Arbeiter waren menschewistisch gesinnt, und sie erklärten, wenn die Menschewiks zu Denikin hielten, müsse dieser ein famoser Kerl sein. Daher setzten sie der Rekrutierung Widerstand entgegen.
Erst als die Menschewiks auftraten, den Arbeitern zeigten, daß die Bolschewiks logen und daß die Bekämpfung Denikins für jeden Menschewik eine Pflicht sei, gelang die Rekrutierung. Und die menschewistischen Soldaten in der roten Armee zählten zu den besten in der Kampagne gegen Denikin. Das weiß Trotzki selbst sehr genau.
Trotzdem fährt er jedoch unentwegt fort, die Menschewiks als die Verbündeten Koltschiaks und Denikins zu denunzieren. So auf S. 46 seiner Schrift. Sie ist voll von derartigen Vergewaltigungen der Wahrheit.
III. Die Demokratie
a) Primitive und moderne Demokratie
Nun zur Frage der Demokratie. Warum fordere ich sie? Darüber berichtet Trotzki:
„Das theoretische Renegatentum Kautskys besteht darin, daß er, das Prinzip der Demokratie als absolut und unwandelbar anerkennend, von der materialistischen Dialektik zu dem Naturrecht