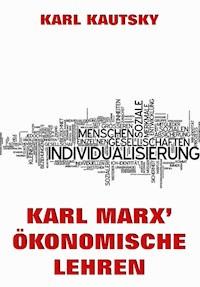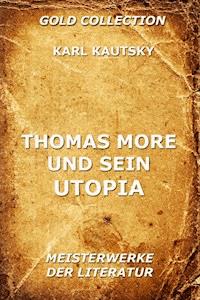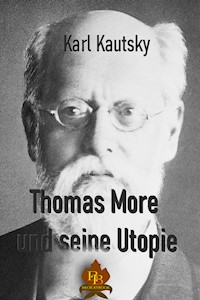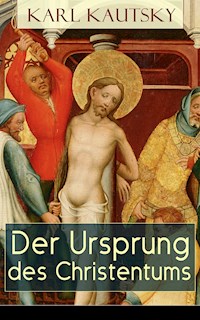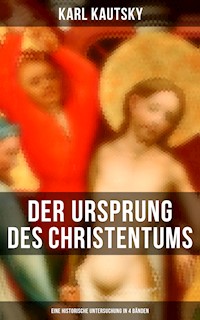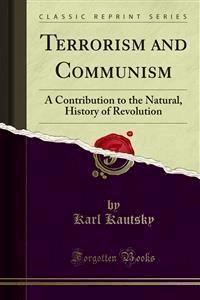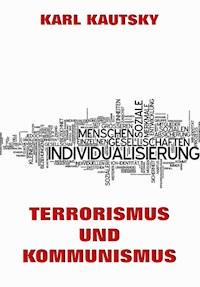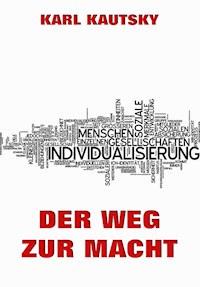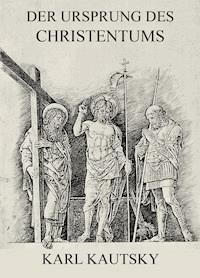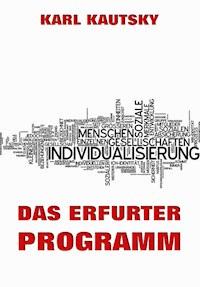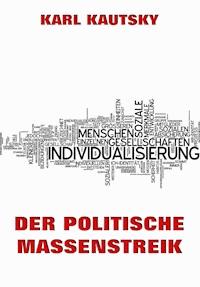
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Beitrag zur Geschichte der Massenstreikdiskussionen innerhalb der deutschen Sozialdemokratie. Inhalt: Vorwort 1. Die Anfänge des politischen Massenstreiks 2. Der anarchistische Generalstreik 3. Engels und Liebknecht über den Generalstreik 4. Die ersten politischen Streiks in Belgien 5. Die Anerkennung des politischen Streiks durch die marxistische Theorie 6. Bernstein über den politischen Massenstreik 7. Der österreichische Parteitag von 1894 8. Parvus über Staatsstreich und Massenstreik 9. Der Revisionismus 10. Der belgische Streik von 1902 und die Auffassung der Genossin Luxemburg 11. Mehring gegen Parvus 12. Streiks in Holland, Schweden, Adler auf dem Wiener Kongreß von 1903 13. Hilferding zur Frage des Generalstreiks 14. Eckstein über den Generalstreik 15. Allerhand Revolutionäres 16. Der Kongreß von Amsterdam, Der Streik in Italien 17. Die Schrift der Genossin Roland-Holst 18. Der Kölner Gewerkschaftskongreß 19. Revisionistischer und marxistischer Massenstreik 20. Der Kongreß von Jena 1905 21. Diskussionen über die Anwendung des Massenstreiks 22. Der Mannheimer Parteitag 23. Das russische Vorbild 24. Der Weg zur Macht 25. Politische Ungeduld 26. Der preußische Wahlrechtskampf 27. Was nun? 28. Der Magdeburger Parteitag 29. Die Reichstagswahl von 1912 und ihre Folgen 30. Die Aktion der Masse 31. Eckstein über Masse und Organisation 32. Der Jenaer Parteitag von 1913 Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten Literatur in einer Sammlung. Lesen Sie die besten Werke großer Schriftsteller,Poeten, Autoren und Philosophen auf Ihrem elektronischen Lesegerät. Dieses Werk bietet zusätzlich * Eine Biografie/Bibliografie des Autors.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der politische Massenstreik
Karl Kautsky
Inhalt:
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Der politische Massenstreik
Vorwort
1. Die Anfänge des politischen Massenstreiks
2. Der anarchistische Generalstreik
3. Engels und Liebknecht über den Generalstreik
4. Die ersten politischen Streiks in Belgien
5. Die Anerkennung des politischen Streiks durch die marxistische Theorie
6. Bernstein über den politischen Massenstreik
7. Der österreichische Parteitag von 1894
8. Parvus über Staatsstreich und Massenstreik
9. Der Revisionismus
10. Der belgische Streik von 1902 und die Auffassung der Genossin Luxemburg
11. Mehring gegen Parvus
12. Streiks in Holland, Schweden, Adler auf dem Wiener Kongreß von 1903
13. Hilferding zur Frage des Generalstreiks
14. Eckstein über den Generalstreik
15. Allerhand Revolutionäres
a) Revolutionsherde
b. Die bewaffnete Insurrektion
c. Die verschiedenen Arten des Streiks
d. Die Macht der Organisation
e. Die Vorbedingungen des politischen Streiks
f. Der Nutzen der Diskutierung des politischen Streiks
16. Der Kongreß von Amsterdam, Der Streik in Italien
17. Die Schrift der Genossin Roland-Holst
18. Der Kölner Gewerkschaftskongreß
19. Revisionistischer und marxistischer Massenstreik
20. Der Kongreß von Jena 1905
21. Diskussionen über die Anwendung des Massenstreiks
a) Nachwirkungen des Jenaer Kongresses
b) Henriette Roland-Holst
c. Friedrich Stampfer
d. Grundsätze oder Pläne
22. Der Mannheimer Parteitag
a. Bebels Rede
b. Legiens Rede
c. Friede zwischen Partei und Gewerkschaften
23. Das russische Vorbild
a. Darstellung des Luxemburgischen Gedankengangs
b. Primitive und entwickelte Streikbedingungen
c. Die Konterrevolution
24. Der Weg zur Macht
25. Politische Ungeduld
26. Der preußische Wahlrechtskampf
27. Was nun?
I.
II.
III.
IV.
28. Der Magdeburger Parteitag
29. Die Reichstagswahl von 1912 und ihre Folgen
30. Die Aktion der Masse
a. Das Wesen der Masse
b. Die Leistungen der Masse
c. Die historischen Wandlungen der Massenaktion
31. Eckstein über Masse und Organisation
32. Der Jenaer Parteitag von 1913
a. Der Boden der Diskussion
b. Die beiden Resolutionen
c. Die Bedingungen des Massenstreiks
Der politische Massenstreik, Karl Kautsky
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849629021
www.jazzybee-verlag.de
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Sozialistischer Schriftsteller, geb. 16. Okt. 1854 in Prag, verstorben am 17. Oktober 1938 in Amsterdam. Studierte 1874 bis 1878 in Wien Geschichte und Philosophie, war 1880–82 in Zürich als Schriftsteller tätig, begründete 1883 die sozialistische Revue »Die Neue Zeit« (Stuttg.), die er 1885–88 von London aus, seit 1890 in Stuttgart redigierte; jetzt lebt er in Berlin. K. schloss sich schon als Student der Sozialdemokratie an. Er ist entschiedener Anhänger von K. Marx und Fr. Engels, deren Ideen er zu verbreiten und weiterzubilden bestrebt ist. Er schrieb neben zahlreichen kleineren Abhandlungen: »Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft« (Wien 1880); »Karl Marx' ökonomische Lehren, gemeinverständlich dargestellt und erläutert« (Stuttg. 1887, 8. Aufl., 1904); »Thomas More und seine Utopie« (das. 1887); »Die Klassengegensätze von 1789« (das. 1889); »Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil erläutert« (5. Aufl., das. 1904); »Der Parlamentarismus, die Volksgesetzgebung und die Sozialdemokratie« (das. 1893); »Die Agrarfrage« (das. 1899,2. Aufl. 1902); »Bernstein und das sozialdemokratische Programm« (das. 1899); »Handelspolitik und Sozialdemokratie« (das. 1901); »Die soziale Revolution« (Berl. 1903). In der »Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen« (Stuttg. 1894 ff.) schrieb er »Die Vorläufer des neuern Sozialismus«, 1. Teil, und den Abschnitt über »Thomas More«.
Der politische Massenstreik
Ein Beitrag zur Geschichte der Massenstreikdiskussionen innerhalb der deutschen Sozialdemokratie
Vorwort
Nach den Diskussionen über den Massenstreik, die dem jüngsten Parteitag sein Gepräge gaben, wurde mir von befreundeter Seite der Wunsch ausgesprochen, ich möge meine älteren Artikel über den Massenstreik, die in der Neuen Zeit erschienen waren, den jüngeren Genossen durch einen Neudruck wieder zugänglich machen.
Daraufhin nahm ich mir jene Artikel wieder einmal vor und fand zu meiner Ueberraschung, daß sie an Aktualität nichts verloren hatten. Tatsächlich sind seit der russischen Revolution in der Frage des politischen Massenstreiks keine neuen Gesichtspunkte zutage getreten. Unsere Diskussionen seither haben uns nicht Fleck gebracht. Ja, mancher von uns hat vergessen, was wir schon vor einem Jahrzehnt und früher gewußt hatten.
An meinen früheren Artikeln fand ich nicht nur im allgemeinen, sondern auch in Details kaum etwas zu revidieren, wenn man absieht von den Erwartungen, die ich an die russische Revolution geknüpft. Diese erwiesen sich freilich als zu hoch gespannt. Es liegt eben im Wesen einer jeden revolutionären Bewegung, das Kraftbewußtsein und die Hoffnungen der Revolutionäre aufs höchste zu steigern.
Immerhin, trotzdem meine theoretische Stellung zum Massenstreik früher die gleiche war wie heute, entstammen meine alten Artikel einer anderen Situation als der heutigen, manches in ihnen hätte befremdet, wenn ich sie einfach abdruckte. Ich mußte sie entweder umarbeiten oder mit einem Kommentar versehen. Ich zog das letztere vor, da mir daran lag, zu zeigen, wie alt die verschiedenen Richtungen sind, die heute in der Diskussion des Massenstreiks aufeinanderstoßen.
Als Vorarbeit zu diesem Kommentar stellte ich die Aeußerungen über den Massenstreik zusammen, die vom Beginn seiner Erörterung au von deutschen Sozialdemokraten oder unter ihrer Mitwirkung an die Oeffentlichkeit gelangt waren und prinzipielle Bedeutung hatten – das heißt, alle Aeußer1mgen, soweit sie mir leicht zugänglich, in Artikeln der Neuen Zeit, in Broschüren, in Protokollen der Parteitage und der internationalen Kongresse niedergelegt waren. Von der Tagespresse sah ich ab.
Jene Aeußerungen trug ich zunächst nur zu meiner Selbstverständigmg als Grundlage meines Kommentars zusammen. Als sie mir vereinigt vorlagen, fand ich jedoch, daß eine Uebersicht darüber von großer Nützlichkeit nicht nur für mich, sondern für jeden wäre, der sich mit der Frage des Massenstreiks befaßt und erfahren will, in welcher Weise sich unsere Anschauungen darüber entwickelt haben. Diese Zusammenstellung herauszugeben, erschien mir noch weit zweckmäßiger als der bloße Neudruck meiner alten Artikel.
Was aber die Grundlage des Kommentars hätte bilden sollen, erforderte nun erst recht einen ausgedehnten Kommentar. So ist mir unter den Händen die vorliegende Schrift nach und nach angewachsen, sehr wider meinen Willen, da meine Zeit durch andere, dringende Arbeiten genügend besetzt war. Ist so meine Arbeit weit größer geworden, als ich ursprünglich beabsichtigte, so durfte ich sie unter den gegebenen Umständen doch nicht so weit ausdehnen, daß sie zu einer erschöpfenden Darstellung wurde. Die außerdeutsche Literatur über den politischen Massenstreik habe ich hier nicht dargestellt. Die deutsche ist ebenfalls, wie schon erwähnt, nicht vollständig benutzt, da die Tagespresse nicht herangezogen wurde. Auch bei der Geschichte der bisherigen Praxis des Massenstreiks habe ich mich aus einige Andeutungen beschränkt. Wer mehr darüber in der deutschen Parteiliteratur erfahren will, den verweise ich auf die Berichte in der Neuen Zeit und das Buch der Genossin Roland-Holst über: Generalstreik und Sozialdemokratie, von dem in meiner Arbeit noch gehandelt wird. Es reicht freilich nur bis zur russischen Revolution, deren Erfahrungen es auch in seiner zweiten Auflage, die zu Ende des Jahres 1905 erschien, nur unvollkommen verwerten konnte. Ueber die russische Revolution selbst orientieren uns verschiedene Schriften, unter denen die der Genossin Luxemburg über den Massenstreik, von der im folgenden noch die Rede sein wird, und die Tscherewanins: Das Proletariat und die russische Revolution, die beide Extreme darstellen, zwischen denen, wie mir dünkt, die Wahrheit in der Mitte liegt.
Die Entstehung der vorliegenden Schrift und ihr ursprünglicher Zweck rechtfertigt es wohl, daß meine eigenen Arbeiten hier ausführlicher wiedergegeben werden als die anderer; ausführlicher als am Platze wäre, wenn es sich, bloß und eine historische Darstellung des Werdens der Idee vom Massenstreik handelte.
Ich verfolge hier eben nicht einen, sondern drei Zwecke. Einmal die Neuausgabe meiner alten Artikel. Dann die Wiedergabe der wichtigsten Ausführungen in den Schriften und Reden deutscher Genossen, die in der Diskussion des Massenstreiks einen neuen Gesichtspunkt entwickeln oder eine Wendung anzeigen. Und endlich die Skizzierung der Wandlungen in den tatsächlichen Verhältnissen, durch die unsere Anschauungen vom Massenstreik gewandelt wurden.
Die Ausführungen letzterer Art sind in anderer Schrift gesetzt als die Wiedergabe älterer Publikationen. Wer diese Publikationen schon kennt, kann sie hier in ihrem Abdruck leicht überschlagen und die parteigeschichtlichen Partien allein lesen.
Andererseits habe ich das Inhaltsverzeichnis so gestaltet, daß meine Schrift auch als Nachschlagewerk benutzt werden kann in Fällen, wo es gilt, die Haltung einzelner Genossen oder einzelner Kongresse in der Frage des Massenstreiks festzustellen.
So hoffe ich, meinem Buche eine Gestalt gegeben zu haben, in der es jedem Genossen, der künftighin an einer Diskussion über den Massenstreik teilnehmen will, viele Arbeit erspart und manche vergessene Erkenntnis neu erschließt. Diese Diskussion zum Abschluß zu bringen, wird mir freilich, nicht gelingen. Das will ich auch gar nicht erreichen. Man kann heute noch sagen, was ich am Schluß meiner Vorrede zum Buch der Genossin Roland-Holst über den Generalstreik im Juli 1905 aussprach:
„Die Diskussion über den Massenstreik abzuschließen, ist ganz unmöglich einer Kampfmethode gegenüber, deren Praxis erst begonnen hat, und die uns ... jeden Tag neue Aufschlüsse bringt und neue Gesichtspunkte eröffnet.“
Das wurde zwar unter dem Eindruck der russischen Revolution geschrieben, gilt aber auch heute noch. Der Massenstreik bildet immer noch den meist umstrittenen Punkt unserer Taktik und er wird es bleiben so lange, bis entweder seine Stunde schlägt oder unsere Kraft so überwältigend wächst, daß er überflüssig wird.
Ich bin zufrieden, wenn man von meiner Schrift dasselbe sagen kann, was ich 1905 von dem Buch der Genossin Roland-Holst mit Recht erwartete, als ich es mit den Worten einleitete:
„Es wird ... die Diskussion auf ein höheres Niveau erheben und sie fruchtbringend gestalten.“
Berlin, Februar 1914Karl Kautsky
1. Die Anfänge des politischen Massenstreiks
Der Streik, die einmütige Verweigerung der Arbeit durch eine Anzahl Lohnarbeiter, ist die ihrer Klasse eigentümliche Waffe. Wo es Lohnarbeiter gibt, gibt es auch Streiks. Wir finden solche schon im alten Aegypten. Bei den Handwerksgesellen des Mittelalters und der neueren Zeit spielten sie eilte große Rolle. Von ihnen hat sie das moderne Proletariat übernommen.
Sie sind seine schärfste Waffe, aber keineswegs ein unfehlbares Zwangsmittel. Wohl ist es richtig, daß die Ausbeuter des Proletariats von seiner Arbeit leben, ohne sie nicht existieren können. Aber von derselben Arbeit leben auch die Proletarier selbst, sie können die Kapitalisten durch Arbeitsverweigerung nicht aushungern, ohne sich selbst auszuhungern. und dabei hat der Kapitalist die Aussicht, länger auszuhalten als der Arbeiter. Seine Klassenlage beruht ja darauf, daß er über Kapital verfügt, über Geld, mit dem er Produktions- und Lebensmittel kaufen kann, indes der Arbeiter erst durch den Verkauf seiner Arbeitskraft zu Ge1d und Lebensmitteln kommt.
Indes, wenn der Streik auch kein unfehlbares Zwangsmittel ist, so kann er doch ein sehr erhebliches Uebel für den Kapitalisten werden. Ob er unter dem Druck des Streiks den Arbeitern nachgibt, hängt davon ab, ob die Bewilligung ihrer Forderungen ihm als das kleinere Uebel erscheint.
In den Anfängen der proletarischen Bewegung gehen die Streiks der Arbeiter in der Regel verloren, auch dann, wenn sie nicht von den Behörden unterdrückt werden. Und doch wiederholen sie sich immer wieder, wenigstens dort, wo die neue Fabrikindustrie große Arbeitermassen in einigen Zentren zusammenballt, aus ihren alten Verhältnissen herausreißt und in neue versetzt, die noch unerträglicher sind als die alten, und um so revoltierender wirken, je mehr sie der Macht der Gewohnheit entbehren. Mögen die Streiks auch verloren gehen! Die Arbeiter verlieren dadurch nichts, sie müssen streiken, es ist die einzige Form des Protestes, die einzige Form der Betätigung als freie Menschen, die ihnen übrig bleibt und die sie moralisch hebt, selbst wenn sie ohne materielle Erfolge bleibt.
Doch die Situation bessert sich für die Arbeiter, sobald sie sich gewerkschaftlich organisieren. Solange ihnen eine Organisation fehlt, treten sie zu gemeinsamem Handeln nur dann zusammen, wenn irgendein starker Anstoß sie alle gleichzeitig erregt. Es ist großenteils Sache des Zufalls, ob dieser Anstoß gerade in eine Zeit fällt, in der für die Arbeiter ein Erfolg möglich ist. Oft fehlt da auch den Streikenden die richtige Einsicht bei der Aufstellung ihrer Forderungen, und selbst wenn sie etwas erreichen, geht es leicht wieder verloren, sobald der Anstoß aufhört, der die Arbeiter vereinigt.
Alles das ändert sich zugunsten der Arbeiter, sobald sie zu einer Vereinigung zusammentreten, die über die Zeit des Arbeitskampfes hinaus bestehen bleibt und ständig die Arbeitsbedingungen und den Arbeitsmarkt überwacht.
Durch die Gewerkschaft werden die Lohnbewegungen nicht nur .plaumäßiger und sachkundiger und dadurch ihre Erfolge größer, es wird auch jeder Erfolg nun zu einem dauernden.
Dazu kommt die große Verstärkung der Arbeiter gegenüber den Kapitalisten, daß sie nun in die Lage kommen, über Fonds zu verfügen. Der Rat liberaler Sozialreformer, die Arbeiter sollten sparen, um Kapitalisten zu werden, war Unsinn. Aber damit ist nicht jedes Sparen der Arbeiter verurteilt. Sie können nichts Zweckmäßigeres tun, als sparen, und ihre Kriegskasse zu füllen.
Wir sehen von den sonstigen Vorteilen ab, die die Gewerkschaften den Arbeitern bieten. Doch sonderbar, je stärker sie werden, je mehr sie die Lage der Arbeiter verbessern, um so vorsichtiger werden sie bei jeder Streikbewegung – aber freilich, um so gewaltiger und zäher wird der Kampf, wenn es einmal zu einem solchen kommt. Das heißt, sonderbar erscheint es nur auf den ersten Blick, daß mit der wachsenden Stärke der Organisation nicht auch ihre Lust, jeden Kampf aufzunehmen, in gleichem Maße zunimmt. Wenn man näher zusieht, ist diese Erscheinung ganz natürlich. Die Organisationen haben jetzt etwas zu verlieren: die Errungenschaften, die sie bisher den Unternehmern abgetrotzt, den Kriegsschatz, auf dem ein gut Teil ihrer Kampfesfähigkeit beruht, und endlich, und das ist das wichtigste, das Vertrauen ihrer Mitglieder.
Wie immer aber der Streik sich gestalten mag, ob organisiert oder unorganisiert, zunächst hat er nur ökonomischen Charakter. Es ist ein Kampf der Arbeiter gegen den 1mteruehmer. Der Gegensatz zwischen ihnen ist ein rein ökonomischer. Rein ökonomische Forderungen bilden den Kampfpreis. Daran ändert sich nichts, auch wem der Kampf nicht mit einem einzelnen Unternehmer, sondern mit einer ganzen Gruppe ausgefochten wird.
Indes auch hier kann schließlich die Quantität in die Qualität umschlagen. Eine Streikbewegung kann eine solche Ausdehnung und Bedeutung gewinnen, daß sie ein neben nicht bloß für die Beteiligten, sondern für die ganze Gesellschaft wird und dadurch den Staat zum Einschreiten auffordert. Damit bekommt sie einen politischen Charakter.
Der kann mm auch wieder von zweierlei Art sein.
Die Streikbewegung kann ihrem Ziele nach eine ökonomische bleiben, aber ihre Wirkungen werden politische. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn etwa ein Bergarbeiterstreik zur Erringung des Achtstundentages zwar die Grubenbesitzer kalt läßt, dagegen das ganze ökonomische Leben so schädigt, daß es die gesetzgebenden Faktoren für das kleinere Uebel halten, wenn sie den Grubenbesitzern den Achtstundentag gesetzlich aufzwingen, den diese freiwillig nicht gewähren wollen.
Das ist eine Art des Streiks, die in dem Maße an Bedeutung zunehmen dürfte, in dem die Unternehmerverbände an Macht wachsen. Doch kann man sie nicht einen politischen Streik im eigentlichen Sinne des Wortes nennen. Als solcher ist nur jener zu bezeichnen, der auf die Gesetzgebung nicht um einer ökonomischen, sondern um einer politischen Wirkung willen einen Druck auszuüben sucht, vor allem der Streik zur Gewinnung oder zum Schutz eines politischen Rechts. Nur mit dem politischen Streik dieser Art haben wir es hier zu tun.
Er ist von vornherein nur als Massenstreik denkbar. Bloß dort kann er in Frage kommen, wo das Proletariat einen energischen Kampf um ein politisches Ziel führt, dessen Erreichung seine große Mehrheit als Lebensnotwendigkeit erkennt und nur dort, wo das industrielle Proletariat bereits für das ökonomische Leben, nicht bloß einzelner Industriezweige, sondern der ganzen Nation, entscheidende Bedeutung gewonnen hat, wo es in großen Massen in den Industriezentren konzentriert und daran gewöhnt ist, den Streik als wirksame Waffe zu gebrauchen.
Der politische Streik selbst kann wieder verschiedene Formen annehmen. Er kann ein bloßer Proteststreik sein oder ein sogenannter Demonstrationsstreik. Diese wollen nur eine moralische Wirkung erzielen, dauern nur kurze Zeit, mitunter nur einen Tag, und können auf kleine Gebiete im Lande, oft auf eine einzelne Stadt beschränkt sein.
Anderer Art ist der politische Zwangs- oder Pressionsstreik, auch Kampfstreik genannt, der so wie ein ökonomischer Streik 0nsbricht, um die Gewährung einer bestimmten Forderung dnrchzusetzeu oder um eine bestimmte proletarierfeindliche Maßregel zu verhindern. Er kann also, wie der ökonomische Streik, ein Angriffs- oder Abwehrstreik sein. Seine Dauer ist unbestimmt, umfaßt meist eine längere Periode. Er endet, wie auch ein ökonomischer Streik, mit einem Sieg, einer Niederlage oder einem Vergleich. Er kann ebenfalls, so wie dieser, unter Umständen unentschieden abgebrochen werden, was aber in der Regel wie eine Niederlage wirken wird.
Wenn man an den politischen Massenstreik denkt, hat man vorwiegend die letztere Art, den Zwangsstreik, im Auge. auch im folgenden ist stets dieser verstanden, wenn vom Massenstreik ohne nähere Kennzeichnung gesprochen wird.
Politische Massenstreiks traten schon früh in der Arbeiterbewegung, wenigstens Englands, auf, das lange vor den anderen Staaten eine starke und konzentrierte Fabrikbevölkerung aufwies. Im Anfang der Bewegung, in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, geht es dabei noch etwas bunt durcheinander. Die einzelnen Streikarten treten keineswegs streng gesondert auf. Diese Sonderung ist erst das Werk einer langen Entwickelung, die eine Arbeitsteilung in der Arbeiterbewegung herbeiführte, ökonomischen und politischen Kampf, ökonomische und politische Organisationen trotz ihrer inneren Zusammengehörigkeit trennte, und auch innerhalb der einzelnen Organisationen mit wachsender Erfahrung eine methodische Untersuchung, Sonderung und Anwendung der einzelnen Kampfmittel, über die sie verfügen, herbeiführte. So wird auch die Streiktaktik der Gewerkschaften den besonderem Verhältnissen der einzelnen Gewerbe und Situationen angepaßt.
Der großartigste politische Massenstreik der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts war der von 1842. Die Löhne der Arbeiter Englands waren aufs tiefste gesunken; was sie noch aufrecht hielt, war ein erbitterter Kampf ums allgemeine Wahlrecht. In dieser Situation gewann der Gedanke eines Massenstreiks rasch an Boden. Schon 1839 war der Generalstreik, der „heilige Monat“ propagiert worden, doch kam es damals nur zu einem umfassenden Demonstrationsstreik am 12. August. Im Augnst 1842 aber verbreitete sich der Streik mit Blitzesschnelle, fast vollständige Arbeitsruhe über das ganze nördliche Industriegebiet Englands wurde erreicht. Zunächst galt der Streik, der ganz spontan ausbrach, nur der Erhöhung der Löhne, als er aber solche Ausbreitung fand, wurde ihm ein politisches Ziel gegeben, die „Volkscharter“, das heißt ein demokratisches Wahlrecht. Doch alle Begeisterung half nichts. Es fehlten Fonds zur Unterstützung der Feiernden und es fehlte eine zentralisierte Organisation, die sie hätte leiten können. Diejenigen, die durch das Vertrauen der Arbeiter als ihre Führer in Betracht kamen, waren uneinig. Daher erreichte der Streik nichts. So wie er ohne festes Ziel und sichere Leitung begonnen hatte, hörte er durch allmähliches Abbröckeln einzelner Arbeiterschichten von der vierten Woche an auf, bis Ende September auch die letzte Streikbewegung erloschen war.
Die Rache der Bourgeoisie für die Angst, die sie ausgestanden, tobte sich nun in den wüstesten Verfolgungee aus. Noch schlimmer aber war die Erschütterung des Vertrauens der Arbeitermassen Englands zum Chartismus, diesen Vorläufer der Sozialdemokratie, das nie wieder völlig wiederhergestellt wurde. Wohl erlebte der Chartismus noch einmal einen kurzen Aufschwung 1847, jedoch nach neuerlichem Versagen 1848 hörte er für immer als Massenbewegung auf.
Diese Erfahrung war nicht geeignet, für den politischen Massenstreik einzunehmen. Als sich in Europa anfangs der sechziger Jahre die Demokratie von den Schlägen der Reaktion, die nach 1848 hereingebracht war, wieder erholte und nun die Arbeiterbewegung mit neuer Kraft lind auf höherer Stufe wieder einsetzte, da wollte die junge Sozialdemokratie vom politischen Massenstreik nichts wissen. Ihre Abneigung wurde noch vermehrt dadurch, daß sich jetzt die Anarchisten des Gedankens bemächtigten.
2. Der anarchistische Generalstreik
Die Erfahrungen der großen französischen Revolution hatten deutlich gezeigt, wie eine politische zu einer sozialen Revolution werden kann, wie die Staatsgewalt, von einer aufsteigenden Klasse erobert, das machtvollste Mittel werden kann, die Gesellschaft ihren Bedürfnissen anzupassen, wenn diese Bedürfnisse mit denen der allgemeinen ökonomischen Entwickelung zusammenfallen. Der Mechanismus, der es in einem modernen Großstaat den unteren Klassen ermöglicht, zur Beherrschung von Gesetzgebung und Regierung zu gelingen, ist der des Repräsentativsystems bei allgemeinem, gleichem und geheimem Wahlrecht.
Neben dem Streik bildet also das allgemeine Wahlrecht ein wichtiges Kampfmittel des Proletariats. Das letztere ist aber ihm nicht eigentümlich. Es ist ein Kampfmittel aller Klassen die über größere Massen verfügen, also des Kleinbürgertums und der Bauernschaft nicht minder als des Proletariats.
Schon das bewirkt, daß das allgemeine Wahlrecht dort, wo jene anderen Klassen überwiegen, nicht notwendigerweise im proletarischen Interesse wirken muß. Es kann unter Umständen auch arbeiterfeindliche Resultate liefern.
Dazu kommt, daß der Parlamentarismus am meisten die Bourgeoisie begünstigt, aus Gründen, die hier zu entwickeln, zu weit abschweifen hieße. Ich habe sie in meiner Schrift über die Volksgesetzgebung dargetan. Wo die Bourgeoisie die Nation geistig beherrscht, wird sie auch das Parlament beherrschen, die unteren Klassen sich dadurch dienstbar machen, das allgemeine Wahlrecht in ein Mittel, sie zu täuschen und bei der Nase herumführen, verwandeln. Nicht Kleinbürgertum und Bauernschaft, sondern nur das Proletariat vermag sich zu geistiger und politischer Unabhängigkeit von der bürgerlichen Führung zu erheben, aber auch das setzt eine längere Schulung und Reifung voraus.
Lange ehe es noch eine bewußte Klassenbewegung besaß, trat das Proletariat in den Kampf um allgemeines Wahlrecht und Parlamentarismus unter dem Einflusse der bürgerlichen Demokratie ein, deren Illusionen es übernahm, als genüge bereits der Besitz demokratischer Rechte, das Volk zum Herrn im Staate zu machen und damit das Glück der Volksmasse zu begründen.
Die Revolution von 1848 führte in Frankreich zur Republik des allgemeinen Stimmrechts. Aber das Resultat war nicht das größte Glück der größten Zahl, sondern der schroffste Klassenkampf, der zur Junischlächterei führte.
Das bewirkte in weiten Kreisen des Proletariats, namentlich Frankreichs und der von ihm beeinflußten Länder, nicht bloß ein Verschwinden der demokratischen Illusionen über Parlament und Wahlrecht, sondern in begreiflicher Reaktion darüber hinaus eine gänzliche Verkennung dessen, was Wahlrecht und Parlament für ein kraftvolles selbständiges Proletariat werden könnten, ja eine förmliche Feindschaft gegen Parlamentarismus und Wahlrecht.
Das wurde nicht gebessert dadurch, daß nach 1850 in Frankreich und später, in den sechziger Jahren in Deutschland und England, bürgerliche, ja reaktionäre Regierungen das allgemeine Wahlrecht sich nutzbar zu machen suchten und zeitweise nutzbar machten, entweder um die politischen Selbständigkeitsgelüste der liberalen Bourgeoisie durch den Appell an die unteren Klassen zu dämpfen, wie dies Napoleon und Bismarck taten, oder um einen Teil des Proletariats als wertvollen Bundesgenossen für eine Fraktion der besitzenden Klassen zu gewinnen wie dies Gladstone und Disraeli versuchten.
So weit die Arbeiterklasse damals das Wahlrecht erhielt, verdankte sie es nicht so sehr ihrer Macht, als politischen Spekulationen ihrer Gegner. Namentlich in Frankreich wirkte das allgemeine Wahlrecht lange ganz reaktionär, dank einmal der Stärke der Bauernschaft und zum anderen dem politischen Druck des Kaiserreichs, der jede Organisation und jede Aufklärung des Proletariats durch die Presse unterband. Das Parlament selbst war machtlos und korrupt. Das Proletariat hatte weder die Möglichkeit, frei seine Wahlkämpfe auszufechten, noch auch die, durch eine Parteiorganisation die gewählten Abgeordneten zu überwachen und seiner Disziplin unterzuordnen.
Alles das bewirkte, daß Frankreich nach 1848 zur Heimat des Antiparlamentarismus wurde. Solange die politische Macht des Kaiserreichs dauerte, fand er seinen besten Ausdruck im friedlichen Anarchismus Proudhons, der durch ganz zahme Mittel die Proletarier zu heben suchte. Als aber die Arbeiterklasse wieder Kraft und Mut zum Kampfe und zur Opposition fand, da reichte der Proudhonismus nicht mehr aus. Allenthalben bemächtigte sich jetzt die Arbeiterklasse der Waffe der gewerkschaftlichen Organisation und des Streiks. In England, wo diese schon eingebürgert waren, erstand neben ihnen, in Deutschland noch vor ihnen eine starke Beteiligung des Proletariats an den Wahlkämpfen und parlamentarischen Kämpfen. In Frankreich wurde eine ähnliche Entwickelung durch eine neue Niederlage des Proletariats, in der Pariser Kommune, unterbrochen. Um so mehr gedieh dort und in den von ihm geistig beherrschten Bewegungen Italiens, Spaniens, Belgiens, der französischen Schweiz, der Gedanke, durch den Streik Wahlkampf und Parlamentarismus überflüssig zu machen. Wohl mußte man zugeben, daß der Streik nicht für alle Zwecke ausreiche und kein unfehlbares Zwangsmittel sei. Aber das sollte nur für den gewöhnlichen Streik gelten. Wenn einmal die Arbeiter insgesamt streikten, dann mußte die Wirkung eine unwiderstehliche sein.
Mit diesen Erwartungen suchten die anarchistischen Generalstreikler die Arbeiterschaft von der Beteiligung an Wahlkämpfen und an parlamentarischer Betätigung abzuhalten. So störten sie überall unsere praktische Arbeit, erschwerten die Sammlung und Erstarkung des Proletariats, und deshalb, nicht etwa wegen ihrer Spekulationen über die Staatslosigkeit der kommenden sozialistischen Gesellschaft, mußten die auftauchenden Arbeiterparteien sie und ihre Generalstreikidee auf das entschiedenste abwehren.
3. Engels und Liebknecht über den Generalstreik
Schon in der alten Internationale tauchte die Idee des Generalstreiks auf. Jedoch in den ersten Jahren ihres Bestehens spielten Wahlkämpfe noch keine Rolle im Leben der Völker. Um so mehr aber Kriege der Nationen. Als Mittel zur Verhinderung des Krieges erscheint der Generalstreik in einer Resolution der Internationale, es war ein Beschluß des Brüsseler Kongresses (1868), den die Franzosen und Belgier beherrschten. Von 97 Delegierten waren dort 66 Belgier, 18 Franzosen, daneben nur 4 aus Deutschland, 8 aus der Schweiz und 11 aus England. Schon drohte damals der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, und so wurde auf die Tagesordnung des Kongresses die Frage gesetzt, wie sich die Arbeiter im Falle eines europäischen Krieges verhalten sollten. Der Kongreß sprach sich nicht nur gegen den Krieg aus, sondern verpflichtete auch die Arbeiter, alles aufzubieten, ihn zu verhindern, und erklärte:
„Daß es dazu ein wirksames, gesetzmäßiges und sofort durchführbares Mittel gibt;
daß die Gesellschaft nicht bestehen kann, wenn die Produktion eine Zeitlang stillsteht;
daß es also genügte, die Arbeit einzustellen, um einen Krieg unmöglich zu machen,
daher empfiehlt der Kongreß den ... Arbeitern die Einstellung der Arbeit für den Fall, daß in ihrem Lande ein Krieg zum Ausbruch kommen sollte.“
In dieser Resolution wird also der Generalstreik aufs stärkste, aber auch naivste als unfehlbares und einfaches Zwangsmittel proklamiert. Die Zwangsgewalt soll darin liegen, daß die Gesellschaft ohne die Arbeit der Arbeiter nicht leben kann; die guten Leute vergaßen, daß die Arbeiter auch in der Gesellschaft leben und daß sie jene Klasse bilden, die der Arbeit zu ihrer Existenz am unmittelbarsten bedarf.
Daß die Resolution völlig wirkungslos blieb, daß beim wirklichen Ausbruch des Krieges niemand an die Einstellung der Arbeit auch nur dachte, ist bekannt. Sie rief aber nicht einmal Diskussionen auf dem Kongreß, wenigstens nicht in seinen öffentlichen Sitzungen oder unmittelbar danach hervor. So wenig beschäftigte damals noch jene Idee die Arbeiter.
Später, unter den Bakunisten, wurde es anders, und nun hielt es Engels gelegentlich für notwendig, Kritik an der Idee des Generalstreiks zu üben.
So schrieb er für den Volksstaat eine Denkschrift über den Aufstand in Spanien im Sommer 1873. Damals hatte der spanische König Amadeo abgedankt, die Republik war proklamiert worden.
Die Regierung schrieb die Wahlen zu einer konstituierenden Nationalversammlung (Cortes) aus. Die Internationale mußte Stellung nehmen. Doch die Bakunisten hatten zu entschieden jede Beteiligung an den Wahlen als „todeswürdiges Verbrechen“ gebrandmarkt, als daß sie in den Wahlkampf hätten eintreten können. Andererseits wagten sie in der damaligen Situation doch nicht, ihren Anhängern jede Wahlbeteiligung zu verbieten. Sie wählten den schlauen Ausweg, keine Parteikandidaten aufzustellen, aber den Arbeitern freizustellen, ob sie für andere Kandidaten stimmen wollten oder nicht. So wurden fast ausschließlich Bourgeoisrepublikaner gewählt.
Nachdem Engels das unsinnige Verfahren dargestellt und gegeißelt, fährt er fort:
„Die Allianzisten (Bakunisten) konnten unmöglich in der lächerlichen Lage verharren, in die sie sich durch ihre schlaue Wahltaktik versetzt hatten; sonst war es zu Ende mit ihrer bisherigen Herrschaft über die spanische Internationale. Sie mußten wenigstens zum Schein handeln. Was sie retten sollte, war – der allgemeine Streik.
Der allgemeine Streik ist im Bakunistischen Programm der Hebel, der zur Einleitung der sozialen Revolution angesetzt wird. Eines schönen Morgens legen alle Arbeiter aller Gewerke eines Landes oder gar der ganzen Welt die Arbeit nieder und zwingen dadurch in wenigstens vier Wochen die besitzenden Klassen, entweder zu Kreuze zu kriechen oder auf die Arbeiter loszuschlagen, so daß diese dann das Recht haben, sich zu verteidigen und bei dieser Gelegenheit die ganze alte Gesellschaft über den Haufen zu werfen. Der Vorschlag ist weit davon entfernt, neu zu sein; französische und nach ihnen belgische Sozialisten haben seit 1848 das Paradepferd stark geritten, das aber ursprünglich englischer Rasse ist. Während der auf die Krise von 1837 folgenden raschen und heftigen Entwickelung des Chartismus war schon 1839 der „heilige Monat“ gepredigt worden, die Arbeitseinstellung auf nationalem Maßstab (siehe Engels, Lage der arbeitenden Klasse, 2. Auflage S. 234) und hatte solchen Anklang gefunden, daß die Fabrikarbeiter von Nordengland im Juli 1842 die Sache auszuführen suchten.
Auch auf dem Genfer Allianzistenkongreß vom 1. September 1873 spielte der allgemeine Streik eine große Rolle, mir wurde allseitig zugegeben, daß dazu eine vollständige Organisation der Arbeiterklasse und eine gefüllte Kasse nötig sei. Und darin liegt eben der Haken. Einerseits werden die Regierungen, besonders wenn man sie durch politische Enthaltung ermutigt, weder die Organisationen noch die Kassen der Arbeiter so weit kommen lassen, und andererseits werden die politischen Ereignisse und die Uebergriffe der herrschenden Klassen die Befreinng der Arbeiter zuwege bringen, lange bevor das Proletariat dazu kommt, sich diese ideale Organisation und diesen kolossalen Reservefonds anzuschaffen. Hätte es sie aber, so brauchte es nicht den allgemeinen Streik, um zum Ziele zu gelangen ... Die Wunderwirkung des allgemeinen Streiks wurde überall gepredigt, man bereitete sich darauf vor, in Barcelona und Alcoy damit den Anfang zu machen.“
In Alcoy kam’s zum Streik, der bald zu einem „Straßenkampf“ mit 32 Gendarmen wurde, in dem die Streikenden siegten. Als einige Tage darauf die Regierung Truppen einmarschieren ließ, war alles vorbei. Und zu, weiteren Streiks kam es nicht. Wohl erhoben sich in vielen Orten die Arbeiter, aber zu bewaffnetem Aufstand und unter Führung bürgerlicher Partikularisten, die gegen die zentrale Regierung rebellierten. In Barcelona hatte die Predigt des Generalstreiks nicht den Erfolg, daß ein solcher wirklich ausbrach, sondern nur, daß inmitten der allgemeinen Aufstandsepidemie die Stadt, in der die Bakunisten am mächtigsten waren, ruhig blieb.
„Jede Stadt handelte auf eigene Faust, nicht das Zusammenwirken mit den andereu Städten, sondern die Trennung von ihnen wurde für die Hauptsache erklärt,“ getreu den Vorschriften Bakunins, der jede Zentralisation für verderblich hielt, es jeder Stadt, jedem Dorf, jeder Gemeinde überließ, den Krieg auf eigene Faulst zu führen. „Die vereinzelten, planlosen und blödsinnigen Aufstände“ wurden schließlich von der zentralen Regierung leicht mit einer Handvoll Truppen einer nach dem anderen unterworfen. (Internationales aus dem Volksstaat, S. 16–33)
Eine schärfere Kritik jenes Generalstreiks war nicht denkbar.
Das spanische Fiasko trug vielleicht die Hauptschuld daran, daß die Idee des Generalstreiks für einige Zeit aus dem Arsenal der Anarchisten verschwand. Bald nach jenen Vorkommnissen entwickelten die abnormen Verhältnisse Rußlands die Taktik des Terrorismus durch Attentate auf einzelne Personen, die Träger des staatlichen Verfolgungsapparates. Das russische Vorbild hat seit Bakunin bis heute eine große Wirkung auf die Anarchisten Westeuropas ausgeübt. Sie übersahen die Verschiedenheiten der politischen und sozialen Bedingungen hier und dort und nahmen unbesehen die russischen Methoden an. Der Anarchismus setzte vorübergehend an Stelle des Generalstreiks die „Propaganda der Tat“.
Erst als diese auch in Rußland versagte und die spanischen Erfahrungen vergessen waren, andererseits in Frankreich die Gewerkschaftsbewegung größe Bedeutung erhielt, kam in dieser die anarchistische Idee des Generalstreiks in den Vordergrund. Aber sie setzte sich jetzt nicht mehr die Bedingung einer „vollständigen Organisation der Arbeiterklasse“. Das hätte doch den Generalstreik zu weit hinausgeschoben. Die französischen Gewerkschaften blieben lange schwach und ihre finanzielle Kraft gering. Eine große Organisation brachte aber auch die Gefahr des Zentralismus mit sich, den jeder gute Anarchist noch mehr haßt als den Kapitalismus. Und überdies hatte die Erfahrung gelehrt, daß gerade starke Gewerkschaften mit vollen Kassen Streikabenteuern sehr ablehnend gegenüberstanden, indes unorganisierte Massen leichter dafür zu haben waren. Wohl mußten diese geschult werden, aber nicht durch große Organisationen. Vielmehr die Praxis der Streiks selbst, die sich immer erneuern, sollte die Massen immer mehr erbittern, aber auch immer vertrauter mit der Streiktaktik machen. Der wiederholte Streik, das war die revolutiouäre Gymnastik.
An Stelle der Forderung der vollständigen Organisation des Proletariats setzten die französischen Gewerkschaften, soweit sie von Anarchisten oder ehemaligen Anarchisten geleitet wurden, die Erwartung, daß die Arbeiter stets bereit seien, loszuschlagen und zu streiken, wenn nur ein paar entschlossene Kerle tapfer in kühner Initiative vorangingen und die anderen mit sich fortrissen. Große Gewerkschaften mit gefüllten Kassen verwandelten sich aus einer Vorbedingung des Generalstreiks in ein Hemmnis, das zu verhindern war oder wenigstens mit Mißtrauen und Abneigung betrachtet wurde. Freilich, ohne Organisation konnten auch die Anarchisten nicht auskommen. Aber es sollten kleine Vereine einer verwegenen Elite sein, die bereit war, selbst mit dem Teufel anzubinden. Das war die Uebersetzung des Blanquismus aus dem Politischen ins Oekonomische. So hat sich die anarchistische Idee des Generalstreiks, die von vornherein ein Hindernis jeder politischen Arbeit war, auch zu einem Hindernis jeder fruchtbaren gewerkschaftlichen Arbeit gestaltet, zu einer Ursache der Zersplitterung und Schwächung der Gewerkschaften dort, wo sie die Arbeiter beherrscht.
Als die neue Internationale ihren ersten Kongreß hielt, in Paris 1889, meldete sich auch wieder die Idee des Generalstreiks zum Wort, vertreten durch den Franzosen Tressaud. Er forderte, die Maifeier, die auf diesem Kongresse festgesetzt wurde, solle durch einen Generalstreik unterstützt werden. Als Anfang der sozialen Revolution solle der Kongreß den Generalstreik beschließen.
Liebknecht entgegnete kurz mit denselben Argumenten, die Engels schon vorgebracht hatte, der Generalstreik setze eine so starke und einheitliche Organisation der Arbeiter voraus, wie sie in der bürgerlichen Gesellschaft nicht erreichbar sei. Hätten die Arbeiter aber einmal trotz alledem eine so starke Organisation, „dann sind sie die Herren der Welt. Und die Arbeit dann einzustellen, wäre erst recht eine grenzenlose Torheit“.
Der Antrag wurde mit großer Mehrheit verworfen.
Nicht besser ging es der Resolution, die Nieuwenhuis auf dem Brüsseler Kongreß 1891 einbrachte, in der gefordert wurde, zu erklären, „daß die Sozialisten aller Länder eine etwaige Kriegserklärung mit einem Aufruf des Volks zu allgemeiner Arbeitseinstellung beantworten werden“. In demselben Brüssel, wo auf dem internationalen Kongreß von 1868 der gleiche Antrag einstimmig angenommen ward, fand er jetzt eine große Mehrheit gegen sich.
In dem gleichen Brüssel vollzogen sich jedoch inzwischen Ereignisse, die einer neuen Auffassung des Generalstreiks den Weg bahnten.
4. Die ersten politischen Streiks in Belgien
Belgien ist ein eigenartiges Land, wie geschaffen zum internationalen Vermittler. Die Bevölkerung besteht zur Hälfte aus deutschen (Flämen), zur Hälfte aus Franzosen (Wallonen). Und das Gebiet bildet auf der einen Seite eine Fortsetzung Frankreichs, auf der anderen Seite Deutschlands.
So begegneten sich auch in seiner Arbeiterbewegung französische mit deutschen Elementen und bildeten einen eigenartigen, eklektischen Sozialismus. De Paepe suchte zwischen Proudhon und Bakunin auf der einen Seite und Marx auf der anderen zu vermitteln. In der Theorie kommt man mit der Vermittelung nicht weit, dagegen kann sie in der Praxis unter Umständen wertvoll sein, wenn sie hilft, gleichstrebende Elemente zu vereinigen und damit ihre Kraft zu vermehren. In Belgien führte sie dazu, daß französischer Elan und deutsche Organisationsfähigkeit sich in der „Arbeiterpartei“ zusammenfanden, die 1885 gegründet wurde. Da lag es nahe, daß eine weitere „Synthese“, das heißt Zusammenfassung in einer höheren Einheit, vollzogen wurde: die anarchistische Idee des Generalstreiks, die auch in Belgien Wurzel gefaßt hatte, vereinigte sich jetzt mit der des Wahlrechtskampfes. Aus einem Mittel, das Wahlrecht zu ersetzen, wurde er dort ein Mittel, es zu erkämpsen. Von 1886 an begann in Belgien eine rege Streikkampagne, die bei der Schwäche der Organisationen noch zahlreiche Züge primitiver oder anarchistischer Streikbewegungen trug, gleivhzeitig aber auch eine energische Wahlrechtskampagne, die beide, ähnlich wie Jahrzehnte vorher in der Chartistenbewegung, zeitweise zusammenflossen.
Im Jahre 1891 gelang es einer gewaltigen Streikbewegung, namentlich der Kohlengräber, Regierung und Kammer zu bewegen, eine Wahlreform in Angriff zu nehmen. Aber die neue 1892 gewählte Kammer glaubte, sich billig von ihrer Verpflichtung loskaufen zu können. Sie beriet die Wahlreform, lehnte aber das allgemeine Wahlrecht ab, am 11. April 1893. Damit entfesselte sie einen Streiksturm der gesamten Arbeiterschaft, der alle früheren Streikbewegungen in den Schatten stellte und jeden Moment zu einem wahrhaften Aufstand anzuschwellen drohte. Regierung und Kammer, erschreckt, der Truppen nicht sicher, klappten zusammen und bewilligten am 18. April, was sie am 11. verweigert. Freilich mußte man das Pluralsystem mit in Kauf nehmen, immerhin hatte der Streik einen unzweifelhaften und glänzenden Sieg errungen.
Damit hatte die Erfahrung bewiesen, daß der Streik der Massen zu einer wirksamen politischen Waffe werden könne. Es hieß jetzt für die bisherigen absoluten Gegner des Generalstreiks, dieser Erfahrung Rechnung zu tragen.
5. Die Anerkennung des politischen Streiks durch die marxistische Theorie
Die gewaltigen Ereignisse in Belgien beschäftigten notwendigerweise die Parteigenossen aller Länder aufs lebhafteste. Natürlich auch uns jüngeren Marxisten. Trotz unserer Gegnerschaft gegen den anarchistischen Generalstreik konnten wir uns der Erkenntnis nicht verschließen, daß hier eine Methode, politische Wirkungen zu erzielen, auftauchte, die bisher unbeachtete Möglichkeiten in sich berge.
Schon unter dem Eindruck der ersten noch etwas chaotischen Bewegung hatte ich im August 1891 in einem Artikel der Neuen Zeit über das geplante Parteiprogramm zwar den Generalstreik als Mittel, die Revolution zu erzwingen, abgelehnt, doch hinzugefügt:
„Damit ist nicht gesagt, daß nicht unter Umständen, wenn eine große Entscheidung bevorsteht, wenn gewaltige Ereignisse die Arbeitermassen aufs tiefste aufgewühlt haben, ausgedehnte Arbeitseinstellungen große politische Wirkungen hervorrufen können.“(Neue Zeit, IX. 2, S. 757)
Das war meines Wissens die erste marxistische Stimme in Deutschland, die die Möglichkeit anerkannte, den Streik für die Erreichung politischer Ziele anzuwenden.
Der zweite Streik von 1893 bekräftigte meine Ansicht und vertiefte sie. Noch in demselben Jahre bekam ich Gelegenheit, ihr Ausdruck zu geben.
Auf dem Internationalen Kongreß, der vom 6. bis 12. August in Zürich tagte, beantragte die französisch:e Delegation, den „allgemeinen Streik“ (grève universelle) auf die Tagesordnung zu setzen. Es war nicht ganz klar, was unter diesem Streik zu verstehen sei. Das Wort wurde einmal im Sinne von Weltstreik, internationalem Streik, bald im Sinne von Generalstreik gebraucht.
Zwölf Nationen stimmten dafür, den Gegenstand zu behandeln, sechs dagegen, darunter Deutschland. Er kam als letzter auf die Tagesordnung. In die Kommission zu seiner Beratung wurde unter anderen ich gewählt und ich arbeitete einen Resolutionsentwurf aus, den sie akzeptierte. Er lautete:
„In Erwägung, daß Streiks nur unter bestimmten Verhältnissen und zu bestimmten Zwecken mit Erfolg unternommen werden können, diese jedoch nicht im vorhin ein festzustellen sind;
in Erwägung, daß ein Weltstreik schon wegen der so ungleichen ökonomischen Entwickelung der verschiedenen Länder unausführbar, von dem Moment aller, wo er ausführbar wird, nicht mehr nötig ist;
in weiterer Erwägung, daß selbst ein sich auf ein Land beschränkender allgemeiner Streik, wenn friedlich durchgeführt, aussichtslos ist, weil die Streikenden die ersten waren, die der Hunger träfe und zur Kapitulation zwänge, ein gewaltsamer Streik aber von den herrschenden Klassen unbarmherzig niedergeschlagen würde, erklärt der Kongreß,
daß unter den gegenwärtigen sozialen und politischen Verhältnissen im besten Falle ein Generalstreik einzelner Industrien mit Erfolg durchgeführt werden kann. Der Massenstreik kann allerdings unter bestimmten Umständen eine sehr wirksame Waffe nicht bloß im ökonomischen, sondern auch im politischen Kampf werden. Er ist jedoch eine Waffe, deren erfolgreiche Anwendung eine kraftvolle gewerkschaftliche und politische Organisation der Arbeiterklasse voraussetzt.
Der Kongreß empfiehlt daher den sozialistischen Parteien aller Länder die energischste Förderung~, dieser Organisation und geht über die Frage des Weltstreiks zur Tagesordnung über.“
In dieser Resolution wurde zum erstenmal von einer sozialdemokratischen Körperschaft (der Kongreßkommission) der Streik als Machtmittel in politischen Kämpfen anerkannt; zum. erstenmal das Wort Massenstreik zur Kennzeichnung dieses Streiks im Gegensatz zum anarchistischen Generalstreik angewandt und gleichzeitig auf die Notwendigkeit der Organisation für die erfolgreiche Anwendung des Massenstreiks hingewiesen und die Förderung der Organisation als die Form der Vorbereitung für solche Streiks bezeichnet.
Leider kam jedoch die Frage des allgemeinen Streiks wegen Zeitmangels in Zürich nicht mehr zur Verhandlung. Die Resolution wurde ohne Debatte begraben. Es ist ein Irrtum, wenn das Internationale sozialistische Bureau in Brüssel sie in seiner 1902 erschienenen Sammlung von Resolutionen der internationalen Kongresse als angenommen aufführt.
6. Bernstein über den politischen Massenstreik
In Deutschland beschränkte man sich zunächst auf die rein akademische Erörterung des Massenstreiks. Voran ging dabei E. Bernstein, der im Februar 1894 in der Neuen Zeit einen Artikel über den Streik als politisches Kampfmittel veröffentlichte, in dem er sich hauptsächlich auf die Erfahrungen des englischen Massenstreiks von 1842 stützte, aber auch auf den belgischen Streik Bezug nahm. Er kam zu folgendem Ergebnis:
„Unter ähnlichen Verhältnissen, wie sie in Belgien gegeben waren, halte ich den Streik in der Tat für eine brauchbare Waffe, auch des politischen Kampfes. Wie jeder Streik ist der politische Streik eine zweischneidige Waffe – er ist es in noch höherem Grade, weil er größere Massen der Arbeiterschaft in die Aktion ruft, weitere Kreise der Bevölkerung in Mitleidenschaft zieht. Er ist deshalb auch eine nur selten, nur in bestimmten Ausnahmefällen anzuwendende, die größte Umsicht, die kühlste Erwägung der in Betracht kommenden Verhältnisse erheischende Waffe. Wenn es nötig ist, sich aller Illusionen in bezug auf seine Wunderkraft zu entschlagen, so ist es nicht minder nötig, ihn nicht mit Argumenten a priori abzuweisen, die wohl auf diese Illusionen, nicht aber auf den Kern der Sache passen.
Als Generalstreik in dem Sinne, daß eines Tages alle Arbeiter den ‚Pflug‘ usw. in die Ecke legen und dadurch der heutigen Gesellschaftsordnung ein rapides Ende bereiten, ist er ein poetischer Traum, eine Utopie. Als Mittel, die Arbeiter auf die Barrikaden zu führen, ist er ein Wahnsinn, denn kein zurechnungsfähiger Mensch glaubt bei der heutigen Technik des in allen Ländern herrschenden Militarismus an nennenswerte Chancen des Volks im offenen Kampf gegen das Heer.
Aber in allen Ländern treten Momente ein, wo die bisher herrschenden Klassen und Gewalten an sich selbst irre geworden sind, wo im Volk, sei es infolge industrieller Krisen, sei es als Wirkung politischer Mißwirtschaft, tiefgehende Unzufriedenheit obwaltet, während oben Kopflosigkeit herrscht, Uneinigkeit und halbe Geneigtheit zu Konzessionen. Das sind Situationen, wo der politische Streik das bewirken kann, was einst der Barrikadenkampf leistete. Er stellt vielleicht noch größere Ansprüche als dieser. Er erfordert eine geschulte Arbeiterschaft, die sich dessen bewußt ist, daß es für bankerotte Regierungen kein besseres Lebenselixier gibt, als wenn sie ‚Retter der Gesellschaft‘ spielen können Er erheischt ferner das Vorhandensein guter Arbeiterorganisationen, stark genug, um auf die unorganisierten Arbeiter bestimmenden Einfluß auszuüben.
Ein solcher Streik, umsichtig und energisch geleitet, kann im entscheidenden Moment den Ausschlag für die Arbeiterklasse geben. Auf die Wahl des richtigen Momentes kommt allerdings alles an. Das ist den Arbeitern immer und immer wieder einzuprägen gegenüber der Vorstellung, daß man nur den Generalstreik zu wollen brauche, um ihn zu haben, und daß jede Provokation dazu recht sei. Nur wenn er im rechten Moment und mit der Wucht, die allerdings auch nur dieser möglich macht, eintritt, ist er geeignet, die schon verwirrten Gewalthaber zu denjenigen Zugeständnissen zu bewegen, zu denen sie sich bisher nicht entschließen konnten; nur dann stärkt er die Position der Fordernden und schwächt die der Verweigernden.
Der politische Streik kommt in erster Reihe für Länder in Betracht, wo die Arbeiter das Wahlrecht noch nicht oder nur in durchaus unzureichender Weise besitzen. Er kann aber auch in solchen Ländern erforderlich werden, wo ein ausgedehntes Wahlrecht bereits besteht. Auch dort werden die wichtigsten Entscheidungen oft genug von außerparlamentarischen Ereignissen bestimmt werden. Es ist deshalb keine verlorene Mühe, sich über die Mittel klar zu werden, die der Arbeiterklasse im außerparlamentarischen Kampf für die Erreichung politischer Zwecke zur Verfügung stehen.“
Diese vor zwanzig Jahren geschriebenen Ausführungen sind auch heute noch beachtenswert. Sie enthalten bereits die wesentlichsten Momente, die für den politischen Streik in Frage kommen.
7. Der österreichische Parteitag von 1894
In der deutschen Sozialdemokratie blieb es zunächst bei diesen akademischen Betrachtungen. Einen praktischen Widerhall fand bei uns der belgische Streik von 189s nicht. Der preußische Landtag kümmerte uns noch wenig, zum Reichstag besaßen wir das Wahlrecht. Ein dringendes Bedürfnis, uns mit dem Massenstreik zu beschäftigen, lag nicht vor.
Anders in Oesterreich, wo die Partei eben um jene Zeit in eine Wahlrechtsbewegung eingetreten war. Diese wurde durch das belgische Beispiel mächtig angefeuert. Unsere österreichischen Genossen kannten von nun an jahrelang keinen heißeren Wunsch, als möglichst bald „belgisch reden“ zu können. Freilich, die Mehrheit unter ihnen wußte genau, daß der bloße „Wille zur Tat“ allein nicht genügt. Entscheidend sind die Bedingungen der Tat. Und diese lagen in Oesterreich ganz anders als in Belgien.
Eine Minderheit hätte am liebsten gleich losgeschlagen. Der Wiener Parteitag von 1894 sollte sich mit der Frage des Massenstreiks zur Erringung des Wahlrechts beschäftigen.
Unter den zu diesem Kongreß Geladenen suchten sowohl Engels wie ich in Zuschriften beruhigend zu wirken. Engels ging in seiner Zuschrift auf die Frage des Massenstreiks nicht ein. Er bemerkte nur kurz:
„Der diesjährige Parteitag hat besonders wichtige Aufgaben zu erfüllen. Es handelt sich in Oesterreich um die Erkämpfung des allgemeinen Wahlrechts, jener Waffe, die in der Hand einer klassenbewußten Arbeiterschaft weiter trägt und sicherer trifft als das kleinkalibrige Magazingewehr in der Hand des gedrillten Soldaten. Die herrschenden Klassen – Feudaladel wie Bourgeoisie – sträuben sich aus allen Kräften dagegen, den Arbeitern diese Waffe zu überliefern. Der Kampf wird langwierig und heftig sein. Aber wenn die Arbeiter die politische Einsicht, die Geduld und Ausdauer, die Einmütigkeit und Disziplin beweisen, denen sie nun schon so viele schöne Erfolge verdanken, so kann der endliche Sieg ihnen nicht entgehen. Auf ihrer Seite kämpft die ganze geschichtliche, die ökonomische wie die politische Notwendigkeit. Und mag auch das volle, gleiche Wahlrecht nicht auf den ersten Schlag erkämpft werden, schon jetzt dürfen wir ein Hoch ausbringen den künftigen Vertretern des Proletariats im österreichischen Reichsrat.“
Also an die Geduld, Ausdauer, Disziplin appellierte Engels und nicht an die „kühne Initiative“ ohne Rücksicht auf die Konsequenzen.
In gleichem Sinne war meine Zuschrift gehalten, nur ging sie auf die Frage des Massenstreiks näher ein. Hatte ich in Zürich ihn Jahr vorher den Massenstreik akzeptiert, so hieß es jetzt vor unzeitigem Gebrauch der neuen Waffe warnen, auf ihre Zweischneidigkeit, ihre Bedingtheit durch bestimmte Verhältnisse hinzuweisen. Ich schrieb:
„In dem Kampf ums Wahlrecht, der jetzt entbrannt ist, und namentlich in der Frage des politischen Streiks, die ja so sehr die Gemüter bewegt, können die österreichischen Genossen sich an keine fremden Beispiele halten.
Wohl hat die Geschichte der Arbeiterbewegung bereits zwei Beispiele politischer Streiks zu verzeichnen: das eine der Ausstand von 1842 in England, das andere der belgische Streik des vorigen Jahres, jener verunglückt, dieser erfolgreich, beide hervorgegangen aus einem Kampf ums Wahlrecht. Aber wie verschieden waren die Verhältnisse, unter denen sie stattfanden, von den jetzigen Verhältnissen Oesterreichs! England wie Belgien sind hochentwickelte Industrieländer ohne zuverlässige stehende Armee. Beide Male fiel der Streik zusammen mit einem, namentlich in England, heftigen Kampf zwischen zwei bedeutenden Fraktionen der herrschenden Klassen, und beide Male kam es zum Streik erst, nachdem durch eine längere Reihe von Jahren – in England von 1835 bis 1842, in Belgien von 1886 bis 1893 – eine mächtige Wahlrechtsbewegung die gesamte Volksmasse aufs tiefste aufgewühlt hatte.
In Oesterreich, einem ökonomisch rückständigen Agrarland, einem Lande des Militarismus, rüstet sich die Sozialdemokratie, nach kaum einjähriger allgemeiner Agitation für das allgemeine Wahlrecht, dieses einer Koalition der besitzenden Klassen zu entreißen: das ist eine Situation, wie sie noch nicht dagewesen ist, die einzig in ihrer Art besteht. Sie allein bezeichnet schon einen Triumph des österreichischen Proletariats und eine Bankerotterklärung der herrschenden Klassen; sie beweist ebensosehr deren Schwäche, Feigheit und Ratlosigkeit, wie die Kühnheit und Kraft des organisierten Proletariats Oesterreichs.
Diese Eigenschaften, verbunden mit seiner Einsicht und Besonnenheit, sind es, die aus der Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung seit dem Parteitag von Hainfeld eine Kette von Siegen gemacht haben; sie sind es, die alle Gewähr bieten, daß das organisierte Proletariat und seine Vertretung sich der gegenwärtigen Situation völlig gewachsen zeigen, so ausnehmend schwierig und beispiellos sie auch ist, und so mannigfaltig auch die Fragen sind, die ihrer Lösung harren.“
Man sieht, auch hier die Mahnung zur Besonnenheit, die Warnung vor unzeitigem Losschlagen, so deutlich ausgesprochen, wie ein Außenseiter sprechen durfte. Außerdem wies ich schon damals auf die Notwendigkeit hin, sich nicht durch Beispiele aus dem Auslande blenden zu lassen, sondern die Bedingungen des Massenstreiks im eigenen Lande zu studieren.
Zu dem Punkt der Tagesordnung: Das allgemeine Wahlrecht und der Generalstreik sprach unter anderem Viktor Adler. Auch er mahnte zur Vorsicht:
„Die Regierung und das Parlament sollen überzeugt werden, daß die Arbeiterschaft sich im äußersten Notfall nicht scheut, auch die äußersten Mittel zu ihrer politischen Selbsterhaltung anzuwenden.
Das zwingt uns zur genauen Ueberlegung dessen, was in unseren Kräften steht. Wir können nicht mehr Kraft einsetzen, als wir haben. Und wenn wir über unsere Kräfte die Gegner täuschen, so mag das für uns von Vorteil sein; wehe aber der Partei, wenn sie sich selbst über ihre eigene Kraft täuscht. Das zu verhindern, ist unsere Aufgabe und dazu war dieser Parteitag notwendig ...
Ich bin der Ansicht, daß man den Massenstreik nur anwenden darf, wenn man muß. Es gilt für jeden von uns, daß unser Leben uns nichts gilt gegenüber dem Zweck, der zu erreichen ist. Das gilt für den einzelnen. Auch die Partei hat ein Leben. Auch für die Partei handelt es sich in gewissen Momenten um Tod und Leben. Es handelt sich da nicht nur um die aufgespeicherte Arbeit von jahrelanger Organisation von Hunderten und Tausenden von Genossen, sondern es handelt sich vor allem auch um die Zukunft der Partei, und wir sind verantwortlich nicht nur für die Unterlassung eines solchen Mittels, sondern wir sind auch verantwortlich für die Niederlage in einem solchen Falle, der gleichbedeutend ist mit dem ungeheuersten Rückschlag für das ganze Proletariat überhaupt. (Sehr richtig!) Wir dürfen diese Mittel nicht früher anwenden, bis wir sagen können, es ist unsere Ueberzeugung, daß erstens die Aussichten, daß dieses Mittel Wirkung hat, so groß als möglich sind, und zweitens, daß um kein anderes Mittel mehr übrig bleibt, und drittens, daß der Preis dieser Anwendung auch diesem Mittel halbwegs gleich sei ...
Ich beantrage folgende Resolution:
„Die von der Regierung vorgeschlagene Wahlreform wird als Verhöhnung der Arbeiterschaft mit Entrüstung zurückgewiesen. Der Parteitag erklärt, das Wahlrecht mit allen der Arbeiterklasse zur Verfügung stehenden Mitteln erkämpfen zu wollen, dazu gehört neben den angewendeten Mitteln der Agitation und Organisation auch der Massenstreik.
Die Parteivertretung mit den Vertretern der Organisationskreise wird beauftragt, alle Vorkehrungen zu treffen, um, falls die Hartnäckigkeit der Regierung und der bürgerlichen Parteien das Proletariat zum Aeußersten zwingen sollte, den Massenstreik als letztes Mittel im geeigneten Zeitpunkt anordnen zu können.“
Diese Resolution unterscheidet sich von den bisher eingebrachten dadurch, daß ein bestimmter Zeitpunkt nicht genannt ist und daß der Parteivertretung ausdrücklich gesagt wird, der Parteitag weiß, daß er ein scharfes, ein zweischneidiges Schwert in ihre Hand legt und der Parteitag die Parteivertretung beauftragt, von diesem Schwerte nur dann Gebrauch zu machen, wenn es an der Zeit ist, und nicht früher als sie muß. Anders kann ich mir Ihre Verantwortung und auch die der künftigen Parteivertretung nicht vorstellen, aus wem immer sie bestehen möge.“
Adler akzeptierte also den Massenstreik als letztes, äußerstes Mittel des Kampfes, doch lehnte er jede bedingungslose Verpflichtung zu seiner Anwendung ab.
Ein starker Bruchteil des Parteitages war anderer Meinung. Der Parteivorstand wurde hart getadelt, weil er die Diskussion des Massenstreiks gehindert und gebremst habe; andererseits wurde gefordert, daß der Wahlrechtskampf mit dem Kampf um den Achtstundentag verquickt werde. Am meisten erbitterte das Hinausschieben des Massenstreiks, endlich wurde auch die Anschauung ausgesprochen, man solle sich bei der Massenstreikagitation mehr an die Unorganisierten als an die Organisierten halten. So meinte Nesel, er sei „überzeugt, daß die Unorganisierteu leichter in den Streik eintreten, weil die organisierten Genossen es sich überlegen werden, die Organisation aufs Spiel zu setzen, während die anderen nichts zu verlieren haben“.
Man sieht, schon auf jenem Parteitag wurden bei der Besprechung des politischen Massenstreiks eine Reihe von Momenten ins Treffen geführt, mit denen wir uns auch jüngst wieder zu beschäftigen hatten.
Zu den schärfsten Kritikern der Genossen vom Parteivorstand gehörte Hueber. Er warf ihnen vor, sie hätten den richtigen Moment zum Massenstreik bereits verpaßt und damit Parteiverrat begangen. Nach den großen Massenversammlungen und Demonstrationen sei weitere Zurückhaltung nicht mehr am Platze gewesen, deshalb habe Unsicherheit und Mutlosigkeit in unseren Reihen Platz gegriffen.
Da Hueber einmal in seiner Rede Bebel zitierte, der als Gast anwesend war, meldete sich dieser zum Wort und führte unter anderem aus:
„Genosse Hueber hat meine Worte: ‚Marschieren Sie vorwärts, immer vorwärts‘ für seine Anschauung verwertet. Ich nehme es ihm nicht übel, aber wenn das in meiner Gegenwart geschieht, muß ich meinen Worten eine gewisse Interpretation geben. Ich bin überzeugt, daß, was immer der Parteitag in den nächsten Stunden beschließt, es kein Schritt nach rückwärts, sondern nur ein Schritt nach vorwärts sein wird. (Sehr richtig!) Aber es ist auch notwendig, daß man, wenn man in so schwieriger Situation ist wie Sie, jeden Schritt genau erwägt. Es liegt in dem Wesen der Sozialdemokratie, daß ihr Streben beständig nach vorwärts gerichtet ist. Aber das Maß des Vorwärtsschreitens hängt von den jeweiligen Umständen ab, ob das Tempo langsamer oder schneller geht. Ich bin unter Umständen auch ein Freund des Stürmens. Es gibt aber Momente, wo der Sturm das Verderblichste ist, was geschehen kann. Und es scheint mir, als ob Genosse Hueber, der als Stürmer aufgetreten ist, die Machtfaktoren nicht genügend an Betracht gezogen hat, die berücksichtigt werden müssen.
Gerade in Ihrer Situation kann unter Umständen ein Stürmen dazu führen, geschlagen zu werden, und das wäre das Bedenklichste, was geschehen könnte. Das Stürmen wäre dann der größte Rückschritt.“
Bei der Abstimmung wurde zunächst mit allen gegen eine Stimme ein Antrag der tschechischen Genossen angenommen, der im Prinzip den Massenstreik anerkannte. Alle anderen Anträge wurden abgelehnt, mit Ausnahme der Resolution Adlers, die aber auf eine starke Opposition stieß. Sie erhielt nur 66 gegen 42 Stimmen.
Unter den „Stürmern“ von damals ist indes wohl keiner mehr, der nicht heute ebenfalls für die Resolution Adlers stimmen würde.
Sollten jetzt deutsche Genossen die damalige Haltung Adlers als „opportunistische“ und „revisionistische“ bezeichnen wollen, so muß ihnen entgegengehalten werden, daß dann vor zwanzig Jahren zu den Opportunisten und Revisionisten neben mir auch Bebel und Engels zählten.
Tatsächlich haben die österreichischen Genossen noch lange arbeiten müssen, ehe sie das Wahlrecht eroberten. Sie gewannen es erst im Jahre 1905, und das unter dem Drucke ungarischer Unruhen und der russischen Revolution. Es gibt aber heute keinen Sozialdemokraten in Oesterreich, der die Meinung hegte, es wäre anders möglich gewesen, man hätte den Sturm schon 1894 wagen sollen.
8. Parvus über Staatsstreich und Massenstreik
Die Debatten des Wiener Parteitags schienen zunächst für die deutsche Sozialdemokratie nur theoretisches Interesse zu Haben. Doch bereitete sich damals bereits eine Situation vor, die dem Massenstreik auch für Deutschland ein praktisches Interesse zu geben versprach.
Im Gegensatz zu Bismarck hatte der junge Wilhelm II. erwartet, mit der Sozialdemokratie durch einige Konzessionen an die Arbeiterschaft fertig zu werden. Das schon längst morsche Ausnahmegesetz brach in den Wahlen vom 20. Februar 1890 zusammen und ein neuer Kurs begann. Doch war es ein Kurs sehr kurzatmiger Anläufe, die viel versprachen, aber nichts hielten.
Die Regierung blieb nach wie vor abhängig von den Junkern, der hohen Finanz, der Schwerindustrie. Deren Methoden der Niederhaltung des Proletariats waren nicht die der Beschwichtigung, sondern die der brutalen Gewalt. Der Einfluß der Sozialdemokratie auf die arbeitenden Massen schwand nicht, sondern wuchs nach wie vor, ihre Stimmenzahl stieg von 1890 bis 1893 um 360.000, ihre Mandate um 9, und die politischen wie die sozialen Gegensätze wurden immer schroffer. Das wurde nicht besser durch die anarchistische Propaganda der Tat, die gerade in der ersten Hälfte der neunziger Jahre wohl nicht in Deutschland, aber in Frankreich, nicht zum wenigsten unter polizeilicher Nachhilfe, noch einmal einigen Anhang fand und durch sinnlose Gewalttaten die ganze Gesellschaft gegen alle revolutionären Elemente aufs tiefste empörte, womit sie den Zweck ihrer polizeilichen Zuhälter vollständig erreichte.
Unter dem Eindruck teils dieser Schreckenstaten, die am 24. Juni 1894 in der Ermordung des Präsidenten Carnot gipfelten, teils der wachsenden Erfolge und der unversöhnlichen Opposition der Sozialdemokratie erwuchs das Bestreben, es von neuem mit der Peitsche zu versuchen, da die dürftigen Zuckerbrötchen als bloßer Hohn nur aufreizend gewirkt hatten. Am 5. Dezember 1894 ging dem Reichstag eine Vorlage zur Bekämpfung des Umsturzes zu, die freilich nicht Gesetz wurde, da die bürgerlichen Parteien sich über die Ziele und Methoden des Kampfes gegen die Sozialdemokratie nicht einigen konnten und einander bei den Erörterungen darüber selbst in die Haare gerieten, namentlich Zentrum und Nationalliberale. Im Mai 1895 wurde der Gesetzentwurf begraben.
Er hatte aber gezeigt, wessen man sich von dem neuen Kurse zu versehen hatte. War es auch unwahrscheinlich, daß man das bankerotte Sozialistengesetz erneuern werde, so mußte man um so mehr mit Versuchen rechnen, die wachsende proletarische Flut durch Aufhebung politischer Rechte, namentlich des allgemeinen Wahlrechts einzudämmen.
Damals schrieb Engels in seiner letzten öffentlichen Aeußerung, der seitdem viel umstrittenen Vorrede zu den Marxschen Klassenkämpfen in Frankreich, daß von dem gegebenen gesetzlichen Boden die Sozialdemokratie den größten Vorteil habe, daß sie auf ihm wachse und gedeihe und die größte Torheit beginge, wollte sie ihn verlassen. Aber eben deshalb war er auch davon überzeugt, die Gegner würden alles aufbieten, ihr diese Grundlage zu rauben, ja, womöglich einen Straßenkampf und eine Arbeitermetzelei zu provozieren. Er sah kein anderes Mittel dagegen, als jeder Provokation so lange auszuweichen, bis wir in der Bevölkerung und damit auch in der Armee so stark geworden seien, daß man nicht mehr wagen könne, diese gegen uns aufzubieten.
Das wurde im März 1895 geschrieben. Ein Jahr darauf veröffentlichte Bebel in der Neuen Zeit, 20. Mai 1896, einen Artikel unter dem Titel: Soll man die Sozialdemokratie zur akuten Revolution, zu Straßenkämpfen zwingen?; der Artikel bildete die Besprechung einer gleichnamigen Schrift des Freiherrn v. Fechenbach-Laudenbach, die „ihre Entstehung dem berüchtigten Artikel der Hamburger Nachrichten verdankt, in dem geraten wurde, die „Sozialdemokratie zur gewaltsamen Revolution zu zwingen“.
Bebel bezeichnete die Schrift als eines jener „Wetterzeichen, die erraten lassen, woher der Sturm kommt“. Wie aber sich im Sturm behaupten, darüber zu sprechen, erschien ihm als verfrüht oder Unklug. Er sprach nicht davon.
In dieser Situation gewann nun auch für Deutschland die Frage des Massenstreiks neues Interesse. Gab es denn eine andere Waffe, den drohenden Angriff offen abzuwehren, oder blieb uns nichts anderes übrig, als unterirdischen Widerstand, wie wir ihn unter dem Sozialistengesetz geübt, so lange zu leisten, bis wir stark genug waren, das Aufgebot des Militärs nicht mehr fürchten zu müssen?
Diesmal war es Parvus, der den Massenstreik befürwortete, in einer ausgedehnten, heute noch sehr lesenswerten Artikelserie der Neuen Zeit im Mai und Juni 1896. Die Abhandlung führte den Titel: Staatsstreich und politischer Massenstreik. Sie knüpfte an eine damals erschienene Broschüre des Generalmajors v. Boguslawski an, die ein energisches Vorgehen gegen die Sozialdemokratie, Deportation ihrer Führer und Abschaffung des geheimen Wahlrechts forderte. Tue der Reichstag dabei nicht mit, dann bleibe nur der Staatsstreich übrig.
Parvus untersuchte die einzelnen politischen Faktoren, die Klassen, die Parteien, das Militär und kam, ebenso wie ein Jahr vorher Engels, zu dem Schluß, der Barrikadenkampf sei aussichtslos:
„Die Losung für das Verhalten des Volkes der bewaffneten Macht gegenüber während eines Staatsstreichs würde also lauten: Keinen Barrikadenkampf! Keinen gewaltsamen Widerstand! Sich nicht provozieren lassen! Ruhig ausharren, bis die moralische Zersetzung, die unbedingt eintreten müßte, die Anstifter der ruchlosen Tat in Verwirrung bringt und zum Rückzuge zwängt. Aber wird auch das Volk die nötige Kaltblütigkeit bewahren und den Zusammenhalt haben, um dieser schwierigen Aufgabe zu genügen, ohne doch ängstlich und desparat zu werden?
Die Revolution hatte ihr mechanisches Bindemittel, die Barrikade. Nun ist die Barrikade zu Boden geschleift. Daraus ergibt sich, daß alle jene zusammenhanglosen Volkselemente, die nur auf diese mechanische Weise vereinigt werden konnten und deren ganze Widerstandskraft in der Barrikade lag, politisch widerstandslos gemacht worden sind. Dadurch ist die revolutionäre Macht des Kleinbürgertums völlig gebrochen. Dadurch büßt es auch seine Rolle als Leiter der unorganisierten Proletariermassen während des revolutionären Kampfes ein. Dagegen könnte aber wohl noch eine Gesellschaftsklasse, die von vornherein organisiert ist, im passiven Widerstand, wie er schon geschildert wurde, ausharren. Das heißt mit anderen Worten: die gezogenen Kanonen und das kleinkalibrige Gewehr haben der bürgerlichen Revolution ein Ende bereitet, sie haben aber die politische Widerstandskraft des Proletariats durchaus nicht gebrochen.
Wie die Arbeiter ohne mechanische Bindemittel zusammenhalten können, zeigen die Streiks.