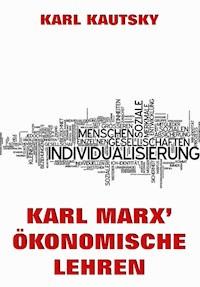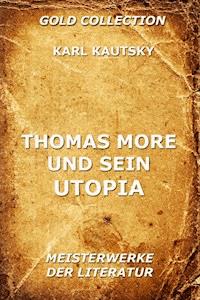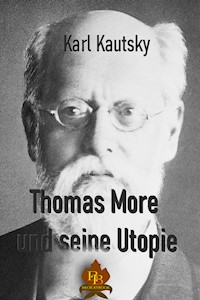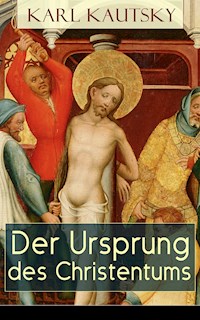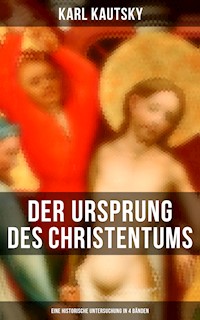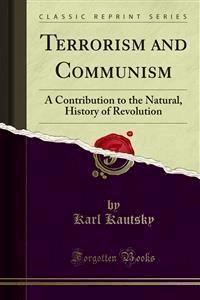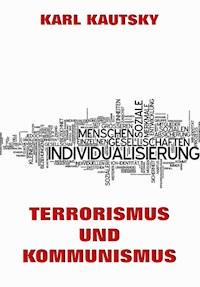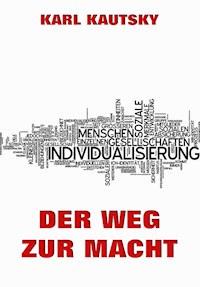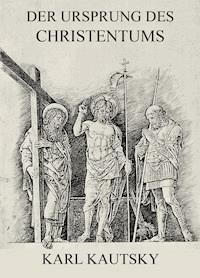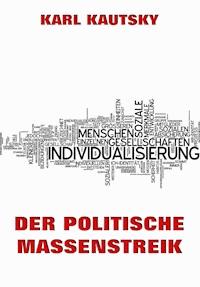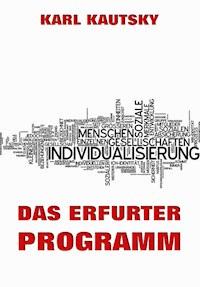Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kautskys umfassendes Werk greift die Geschichte des Sozialismus auf und beschreibt die historische Entwicklung von den Wurzeln bis ins beginnende 20. Jahrhundert. Inhalt: Erster Abschnitt - Der platonische und der urchristliche Kommunismus Erstes Kapitel - Der Idealstaat Plato's Zweites Kapitel - Der urchristliche Kommunismus Zweiter Abschnitt - Die Lohnarbeiter im Mittelalter und im Zeitalter der Reformation Erster Kapitel - Die Entstehung eines freien, städtischen Zweites Kapitel - Die Handwerksgesellen Drittes Kapitel - Kapital und Arbeit im Bergbau Viertes Kapitel - Kapital und Arbeit in der Weberei Dritter Abschnitt - Der Kommunismus im Mittelalter und im Zeitalter der Reformation Erstes Kapitel - Der klösterliche Kommunismus Zweites Kapitel -Der ketzerische Kommunismus. Sein allgemeiner Charakter Drittes Kapitel - Der ketzerische Kommunismus in Italien und Südfrankreich Viertes Kapitel - Die Begharden Fünftes Kapitel - Die Lollharden in England Sechstes Kapitel - Die Taboriten Siebentes Kapitel - Die böhmischen Brüder Achtes Kapitel - Die deutsche Reformation und Thomas Münzer Neuntes Kapitel - Die Wiedertäufer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 877
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Vorläufer des neueren Sozialismus
Karl Kautsky
Inhalt:
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Die Vorläufer des neueren Sozialismus
Vorwort
Einleitung
Erster Abschnitt - Der platonische und der urchristliche Kommunismus
Erstes Kapitel - Der Idealstaat Plato’s
1. Plato und seine Zeit
II. Das Buch vom Staat
Zweites Kapitel - Der urchristliche Kommunismus
I. Die Wurzeln des urchristlichen Kommunismus
II. Das Wesen des urchristlichen Kommunismus
III. Der Verfall des urchristlichen Kommunismus
IV. Das Kirchengut im Mittelalter
Zweiter Abschnitt - Die Lohnarbeiter im Mittelalter und im Zeitalter der Reformation
Erster Kapitel - Die Entstehung eines freien, städtischen Handwerkerstandes
I. Die Hörigkeit
II. Die Anfänge des Handwerks
III. Die Zunft
Zweites Kapitel - Die Handwerksgesellen
I. Die Anfänge des Gesellenwesens
II. Lehrling, Geselle, Meister
III. Die Kämpfe zwischen Gesellen und Meistern
IV. Die Gesellenverbände
V. Die städtische Arbeiteraristokratie.
Drittes Kapitel - Kapital und Arbeit im Bergbau
I. Markgenossenschaft und Bergrecht
II. Der kapitalistische Großbetrieb im Bergbau
III. Die Bergarbeiter
Viertes Kapitel - Kapital und Arbeit in der Weberei
Dritter Abschnitt - Der Kommunismus im Mittelalter und im Zeitalter der Reformation
Erstes Kapitel - Der klösterliche Kommunismus
Zweites Kapitel -Der ketzerische Kommunismus. Sein allgemeiner Charakter
I. Das Papstthum, der Mittelpunkt der Angriffe des ketzerischen Kommunismus
II. Der Gegensatz von Arm und Reich im Mittelalter
III. Der Einfluß der christlichen Ueberlieferung
IV. Die Mystik
V. Die Askese
VI. Die Internationalität und der revolutionäre Geist
Drittes Kapitel - Der ketzerische Kommunismus in Italien und Südfrankreich
I. Arnold von Brescia
II. Die Waldenser
III. Die Apostelbrüder
IV. Die ökonomischen Wurzeln der Bauernkriege
V. Die Erhebung Dolcino’s
Viertes Kapitel - Die Begharden
I. Die Anfänge der Begharden
II. Ludwig der Bayer und der Papst
III. Die katholische Reaktion unter Karl IV.
Fünftes Kapitel - Die Lollharden in England
I. Die Wiclifsche Bewegung
II. Die Lollhardie
III. Der Bauernkrieg von 1381
Sechstes Kapitel - Die Taboriten
I. Die große Kirchenspaltung
II. Die sozialen Verhältnisse Böhmens vor den Hussitenkriegen
III. Beginn der Hussitischen Bewegung
IV. Die Parteien innerhalb der Hussitischen Bewegung
V. Die Kommunisten in Tabor
VI. Der Untergang Tabors
Siebentes Kapitel - Die böhmischen Brüder
Achtes Kapitel - Die deutsche Reformation und Thomas Münzer
I. Die deutsche Reformation
II. Martin Luther
III. Der sächsische Bergsegen
IV. Die Schwärmer von Zwickau
V. Münzer’s Biographen
VI. Münzer’s Anfänge
VII. Münzer in Allstätt
VIII. Die Wurzeln des großen Bauernkrieges
IX. Münzer’s Vorbereitungen der Erhebung
X. Der Bauernkrieg
Neuntes Kapitel - Die Wiedertäufer
I. Die Wiedertäufer vor dem Bauernkrieg
II. Die Lehren der Wiedertäufer
III. Der Wiedertäufer Glück und Ende in der Schweiz
IV. Die Wiedertäufer in Süddeutschland
V. Die Wiedertäufer in Mähren
VI. Die Unruhen zu Münster
VII. Die Wiedertäufer in Straßburg und in den Niederlanden
VIII. Die Eroberung Münsters
IX. Das neue Jerusalem
a) Die Quellen
b) Das Schreckensregiment
c) Der Kommunismus
d) Die Vielweiberei
X. Münsters Fall
Die Vorläufer des neueren Sozialismus, Karl Kautsky
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849628949
www.jazzybee-verlag.de
Karl Kautsky – Biografie und Bibliografie
Sozialistischer Schriftsteller, geb. 16. Okt. 1854 in Prag, verstorben am 17. Oktober 1938 in Amsterdam. Studierte 1874 bis 1878 in Wien Geschichte und Philosophie, war 1880–82 in Zürich als Schriftsteller tätig, begründete 1883 die sozialistische Revue »Die Neue Zeit« (Stuttg.), die er 1885–88 von London aus, seit 1890 in Stuttgart redigierte; jetzt lebt er in Berlin. K. schloss sich schon als Student der Sozialdemokratie an. Er ist entschiedener Anhänger von K. Marx und Fr. Engels, deren Ideen er zu verbreiten und weiterzubilden bestrebt ist. Er schrieb neben zahlreichen kleineren Abhandlungen: »Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft« (Wien 1880); »Karl Marx' ökonomische Lehren, gemeinverständlich dargestellt und erläutert« (Stuttg. 1887, 8. Aufl., 1904); »Thomas More und seine Utopie« (das. 1887); »Die Klassengegensätze von 1789« (das. 1889); »Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil erläutert« (5. Aufl., das. 1904); »Der Parlamentarismus, die Volksgesetzgebung und die Sozialdemokratie« (das. 1893); »Die Agrarfrage« (das. 1899,2. Aufl. 1902); »Bernstein und das sozialdemokratische Programm« (das. 1899); »Handelspolitik und Sozialdemokratie« (das. 1901); »Die soziale Revolution« (Berl. 1903). In der »Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen« (Stuttg. 1894 ff.) schrieb er »Die Vorläufer des neuern Sozialismus«, 1. Teil, und den Abschnitt über »Thomas More«.
Die Vorläufer des neueren Sozialismus
Vorwort
Es ist wohl nicht zu viel gesagt oder ein Unrecht gegen Vorgänger auf dem Gebiet der Geschichtschreibuug des Sozialismus, wenn wir den Satz aussprechen, daß eine nach wissenschaftlichen Grundsätzen geschriebene umfassende Geschichte des Sozialismus bisher noch nicht existirt. Und wenn wir von Benoit Malon’s vorwiegend deskriptiver und pragmatischer Histoire du socialisme absehen, so müssen wir diesem Satz den zweiten hinfügen, daß die neuere Zeit nicht einmal den Versuch einer solchen aufzuweisen hat. Diese Thatsache ist um so auffallender, als das Bedürfniß nach einer Geschichte der Entwicklung des sozialistischen Gedankens und der sozialistischen Bewegung offenbar in hohem Grade vorhanden ist. Aber sie scheint uns auf keinem Zufall zu beruhen.
In den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts, als Chartismus und Kommunismus in den vorgeschritteneren Ländern den Staatsmännern schon praktisch zu schaffen machten und überall die Theoretiker und das dem öffentlichen Leben folgende Publikum interessirten, entsteht zuerst eine Geschichtschreibung des Sozialismus und entwickelt sich sogar zu einer gewissen Blüthe. Gegner und Anhänger des Sozialismus spüren dessen Vorgeschichte auf, hier ziemlich wahllos Alles, was nach ihm aussieht, zusammenstellend, während dort schon nach einer gewissen Methode und einheitlichen Grundsätzen bestimmte Epochen oder bestimmte Erscheinungen kritisch untersucht werden. Dies die Zeit, wo die Villegardelle und Robert von Mohl, die Reybaud und die Lorenz von Stein, die Sudre und die Karl Grün schrieben. Auch Sargant kann man noch dieser Periode zuzählen.
Die „Internationale“ und die Pariser Kommune gaben den Anstoß zu einer zweiten Periode der Geschichtschreibung des Sozialismus: in die fallen die Werke von Rudolf Meyer und Jäger, Dühring und Laveleye. Sie schließt ab mit dem schon erwähnten Werke Benoit Malon’s.
Seitdem ist der Sozialismus immer mehr in den Vordergrund getreten, er hat begonnen, der Angelpunkt der gesammten europäischen Gesellschaft zu werden, und sich fast überall auf den gleichen theoretischen Boden gestellt, den des Kommunistischen Manifestes. Die Macht und Geschlossenheit, die Klarheit und Zielbewußtheit der vom Sozialismus ergriffenen Massen wächst von Tag zu Tag; alle Klassen der europäischen Gesellschaft werden gedrängt, sich mit dem Sozialismus zu befassen, der für sie alle eine Lebensfrage geworden ist: die Literatur über soziale Fragen vermehrt sich ins Ungeheure – aber die Geschichtschreibung des Sozialismus, statt in gleichem Maße zu wachsen, wird nicht nur relativ, sondern auch absolut immer unfruchtbarer. Eine umfassende, selbständige Darstellung der Entwicklung des Sozialismus ist seit dem Beginn der achtziger Jahre nicht mehr erschienen. Selbst die Zahl der Monographien über einzelne Theile der Geschichte des Sozialismus ist gegenwärtig im Verhältniß zur gesammten soziologischen Literatur äußerst spärlich. Die meisten derselben, wie die von Pöhlmann oder Loserth, sind rein fachwissenschaftliche, akademische Arbeiten.
Die eine Ursache dieser Erscheinung dürfte darin zu suchen sein, daß das Material enorm gewachsen ist, so daß es für den Einzelnen immer schwieriger wird, dasselbe in seiner Gesammtheit zu übersehen und zu beherrschen.
Aber dieser Grund allein erscheint uns nicht ausreichend, das merkwürdige Phänomen zu erklären, daß die Geschichtschreibung des Sozialismus eine so geringe Anziehungskraft auf unsere Gelehrten ausübt.
In der ersten Epoche dieser Geschichtschreibung wird dieselbe vorwiegend betrieben von mehr oder weniger entschiedenen Gegnern des Sozialismus. In der zweiten Epoche sind die Vertreter dieser Richtung bereits daraus verschwunden. Alle namhafteren Geschichtschreiber des Sozialismus in den siebziger Jahren und dem Anfang der achtziger haben oder suchen mehr oder weniger Berührungspunkte mit dem Sozialismus, nicht blos Dühring und Malon, sondern auch R. Meyer und Laveleye. Die bürgerliche Apologetik hatte schon damals jedes Interesse an der Geschichtschreibung des Sozialismus verloren.
Und das ist nicht schwer zu begreifen.
Der bürgerliche Apologet, der geschworene Anwalt der Grundlagen, auf denen die moderne Gesellschaft aufgebaut ist, kann im Sozialismus unmöglich etwas Anderes sehen, als eine unbegreifliche Verirrung. Für ihn kann die Geschichtschreibung des Sozialismus nicht den Zweck haben, diesen in seiner Entwicklung begreiflich zu machen, sondern nur den Zweck, zu zeigen, daß er unvereinbar sei mit dem Wesen des Menschen und der Gesellschaft. Und so lange die kapitalistische Produktionsweise in der Epoche aufsteigender Entwicklung sich befand, war der Sozialismus thatsächlich unvereinbar mit den Bedürfnissen der Produktionsweise und unmöglich als dauernde Form der Gesellschaft.
Bis in die vierziger Jahre bot daher die Geschichte des Sozialismus eine Reihe von Thatsachen, die von den Apologeten in ihrem Sinne verwerthet werden konnten. Die sozialistischen Ideen erschienen als leere Träume, die Geschichte der Versuche, den Sozialismus praktisch durchzuführen, zeigte anscheinend nichts als eine Reihe von Niederlagen und mißglückten Experimenten.
Das hat sich seitdem geändert. Die Geschichte der sozialistischen Ideen ist heute die Geschichte der „Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“; und die Geschichte der sozialistischen Praxis ist, seitdem die Vereinigung von Sozialismus und Arbeiterbewegung sich vollzogen, eine Geschichte stets wachsender Erfolge. Diese Erfolge sind heute ebenso anerkannt wie die wissenschaftliche Grundlage des Sozialismus: ein jeder Versuch, die Vorgänger der heutigen Sozialisten herabzuziehen und zu verkleinern, würde nur dazu dienen, den heutigen Sozialismus in um so hellerem Lichte erscheinen zu lassen, ohne das Geringste zu Gunsten der bestehenden Gesellschaft zu beweisen.
Die Geschichte des Sozialismus bezeugt heilte zu deutlich dessen siegreiches Vorwärtsstreben auf allen Gebieten, die er erfaßt, als daß bürgerliche Gelehrte ein großes Verlangen empfinden sollten, sie umfassend zur Darstellung zu bringen. Soweit sie sich überhaupt mit dem Thema befassen, geben sie nur kleine Abschnitte daraus, die meist rein akademischer Natur und ohne jede Beziehung auf den heutigen Sozialismus sind, und welche die allgemeine Richtung der Gesammtentwicklung nicht erkennen lassen.
Es ist höchst bezeichnend, daß jüngst fast gleichzeitig zwei Universitäten, die von Paris und die deutsche von Prag, Vorlesungen über die Geschichte des Sozialismus inhibirt haben, obgleich, wenigstens an der Prager Universität, der Dozent ein Mann von erprobt loyaler Gesinnung war.
In demselben Maße, in dem in der bürgerlichen Wissenschaft das Interesse an der Geschichte des Sozialismus abnimmt, und ans denselben Gründen wächst dies Interesse bei den Sozialisten. Aber trotz dieses Interesses vermögen sie auch die vollkommenste Objektivität ihren Vorgängern gegenüber zu bewahren.
Es kann nicht unsere Aufgabe sein, hier das Verhältniß der modernen Form des Sozialismus zu den früheren Formen desselben auseinanderzusetzen. Auch würde es zu weit führen, hier auf die materialistische Geschichtsauffassung des modernen Sozialismus einzugehen, die eine vollkommen objektive Geschichtschreibung ermöglicht. Das hieße dem Inhalt des vorliegenden Werkes vorgreifen. Es genügt hier, darauf hinzuweisen, daß der moderne Sozialist seinen Vorgängern völlig unbefangen gegenübersteht. Ihr Sozialismus ist nicht der seinige, die Verhältnisse, denen sie entsprossen, sind verschieden von denen, die ihn umgeben. Wie immer also das Urtheil über seine Vorgänger ausfallen mag, es trifft nicht den Sozialismus, für den er eintritt, er ist an diesem Urtheil nicht direkt, nicht als Kämpfer interessirt.
Allerdings, wenn auch unbefangen und uninteressirt, so steht er seinen Vorgängern doch nicht gleichgiltig gegenüber. Eine tiefe Sympathie muß ihn mit jenen verbinden, die Aehnliches wollten, demselben Ziele zustrebten, wie er. Daß sie sozialistischen Idealen nachstrebten, zu einer Zeit, wo die Gesellschaft noch nicht aus sich selbst die Mittel entwickelte, dieselben zu verwirklichen, daß sie Unmög1iches anstrebten und scheiterten, muß seine Sympathien für sie sogar verstärken, denn diese Sympathien stehen naturgemäß auf Seite aller Unterdrückten und Unterliegenden. Und wenn er gar noch sehen muß, daß die Unterlegenen nicht blos von den Siegern, sondern auch von einer interessirten Geshichtschreibung bis auf den heutigen Tag beschimpft, verleumdet und besudelt werden, so wird der Zorn und Haß gegen die Verleumder seine Sympathie mit den Verleumdeten nur um so höher aufflammen machen.
Aber so stark diese auch sein und sich äußern mag, sie steht der Erforschung der Wahrheit nicht im Wege; ja gerade die große Sympathie mit seinen Vorgängern ist für den heutigen Sozialisten ein weiterer Grund, sich eifrigst in das Studium derselben zu versenken; und es ist klar, daß es einem Sozialisten leichter möglich wird, als einem bürgerlichen Schriftsteller, das Gefühls- und Gedankenleben der früheren Sozialisten zu erfassen und zu begreifen.
Erkennt man die volle Bedeutung der jüngsten Form des Sozialismus erst, wenn man ihre früheren Formen versteht, so begreift man diese wieder viel besser, wenn man in der Gegenwatt inmitten der sozialistischen Bewegung steht. Sehr richtig bemerkt Heine, daß, „indem man die Gegenwart durch die Vergangenheit zu erklären sucht, zu gleicher Zeit offenbar wird, wie diese, die Vergangenheit, erst durch jene, die Gegenwart, ihr eigentlichstes Verständniß findet und jeder Tag ein neues Licht auf sie wirft, wovon unsere bisherigen Handbuchschreiber keine Ahnung hatten.“
Angesichts alles dessen darf man wohl sagen, daß, während die bürgerliche Wissenschaft sich immer mehr von der Geschichtschreibung des Sozialismus abwendet, diese Aufgabe immer mehr den Bekennern des modernen Sozialismus zufällt.
Wenn dieser trotzdem eine umfassende selbständige Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der sozialistischen Bestrebungen und Ideen nicht früher erzeugt hat, liegt der Grund davon nahe genug. Welche Urthei1e immer ihre Stellung den Vertretern des modernen Sozialismus gegenüber den bürgerlichen Gelehrten bei der Abfassung eines derartigen Werkes bieten mag, so bringt diese Stellung doch auch einen ernstlichen Mangel mit sich: den Mangel an Zeit.
„Wie im sechzehnten Jahrhundert, giebt es in unserer bewegten Zeit auf dem Gebiete der öffentlichen Interessen bloße Theoretiker nur noch am Seite der Reaktion.“ (Engels) Dies gilt vor Allem von der Sozialdemokratie. Sie hat kein Mitglied aufzuweisen, das als bloßer Theoretiker gelten könnte. Jeder ihrer Theoretiker ist auch praktischer Kämpfer, der mit Wort und Schrift, mit Rath und That eingreift in die Klassenkämpfe des Proletariats. Wie wenig die beiden Begründer der heutigen sozialistischen Theorie davon eine Ausnahme machen, ist bekannt.
Unter ihren Anhängern, die bestrebt sind, im Sinne der Meister theoretisch weiter zu wirken, sind die Mehrzahl Redakteure, Journalisten, Parlamentarier &c. Gilt es also schon für die bürgerliche Wissenschaft, daß das Gebiet der Geschichte des Sozialismus so umfangreich geworden ist, daß es dem Einzelnen fast unmöglich wird, es in seiner Gesammtheit zu bewältigen, wenn er das nicht zu seiner einzigen Lebensaufgabe macht, so gilt dies noch viel mehr von der Sozialdemokratie. Es ist also nicht zu verwundern, wenn dieselbe bisher auf diesem Gebiete nur einzelne Monographien, keine umfassende Gesammtdarstellung geliefert hat.
Es lag nahe, dem Bedürfniß nach einer solchen abzuhelfen in der Form einer planmäßigen Zusammenfassung von Monographien über alle wichtigen Epochen in der Geschichte des Sozialismus. Die Idee der Gesammtdarstellung eines wissenschaftlichen Gebiets in Form einer Sammlung von Einzeldarstellungen ist nicht neu; sie ist, namentlich auf dem Felde der Geschichte, schon wiederholt mit Glück angewendet worden.
Unleugbar hat diese Form auch ihre Nachtheile. Volle Einheitlichkeit läßt sich nicht erzielen, auch wenn, wie im vorliegenden Falle, alle Mitarbeiter auf dem gleichen Standpunkte stehen. Die Einheitlichkeit der Darstellung ist von vornherein ausgeschlossen; Fäden, die der eine Autor begonnen, werden von dem nächsten nicht weiter fortgesponnen; Wiederholungen auf der einen Seite, Lücken auf der anderen lassen sich nicht vermeiden. Aber nicht einmal völlige Einheitlichkeit des Inhalts ist in allen Fällen erreichbar; denn bei aller Uebereinstimmung des Standpunktes sind doch die Augen der verschiedenen Autoren verschieden; jeder ist eine Individualität für sich, und die volle Einheitlichkeit wird um so weniger erzielbar sein, je mehr die gemeinsame Grundlage nicht eine Schablone ist, sondern eine Methode, die jeder selbständig anwendet, und je komplizirter die Erscheinungen, um die es sich handelt.
Die Herausgeber hoffen, daß diese Nachtheile in vorliegendem Werk auf ein Minimum reduzirt sind, durch eine Gliederung des Stoffes, die Wiederholungen und Lücken soweit als möglich ausschließt und jedem einzelnen Autor ein möglichst in sich geschlossenes Gebiet zuweist.
Der Zweck dieses Werkes ist kein rein akademischer. Die Erschließung der Vergangenheit soll der Gegenwart größere Klarheit bringen. Nur jene Erscheinungsformen des Sozialismus sind in den Kreis der vorliegenden Darstellungen gezogen, die auf die Bildung des modernen Sozialismus von Einfluß gewesen sind. Von einer umfassenden Behandlung des urwüchsigen Kommunismus wurde abgesehen. Eine solche hätte den Umfang dieses Werkes ungebührlich erweitert und seinen Charakter völlig verändert. Die Geschichte des urwüchsigen Kommunismus ist die Geschichte des gesammten Menschengeschlechts von seinen Anfängen bis weit in die historische Zeit hinein.
Wir durften um so eher davon absehen, unser Unternehmen durch eine umfassende Darstellung des urwüchsigen Kommunismus übermäßig zu erweitern, als dieser die Bildung neuerer sozialistischer Ideen nur wenig beeinflußt hat. Es schien genügend, ja übersichtlicher und daher wünschenswerther, den urwüchsigen Kommunismus nur gelegentlich zu berühren, so oft seine Beeinflussung des neueren Sozialismus sichtbar wird.
Aber auch nicht alle Erscheinungsformen des bewußten Sozialismus wurden in den Bereich dieses Werkes gezogen. Formen, denen blos akademisches Interesse innewohnt, die aber zur Entwicklung des modernen Sozialismus nichts beigetragen haben, wie z. B. der chinesische Sozialismus, blieben ausgeschlossen.
Die quellenmäßige Darstellung sollte nach dem ursprünglichen Plan der Arbeit auf die Erscheinungen des neueren Sozialismus vom Zeitalter der Reformation, von Münzer und More an, beschränkt sein. Die früheren Erscheinungsformen sollten in einer Einleitung nur kurz berührt werden, soweit diese zum Verständniß des Folgenden nöthig war. Daß diese Einleitung unerwartete Dimensionen angenommen hat und trotz größter Knappheit ebenso viele Bogen einnimmt, als sie Seiten einnehmen sollte, wird Niemand wundern, der den Stoff kennt.
Dadurch ist eine Zweitheilung des ersten Bandes nothwendig geworden. Der zweite Theil desselben wird die Darstelluug der Entwicklung des Sozialismus bis zur großen französischen Revolution fortführen und in einem besondern Abschnitt eine Uebersicht der religiösen kommunistischen Kolonien in Amerika geben, trotzdem die meisten derselben unserem Jahrhundert angehören. Ihr Charakter verweist sie in ein früheres Zeitalter; sie sind viel mehr verwandt mit Sekten des 16. und 17. Jahrhunderts, mit Wiedertäufern, Mennoniten und Quäkern, als mit Robert Owen, Fourier und Cabet, deren Zeitgenossen sie sind, und gehören demgemäß auch noch in den ersten Band.
Das ganze Werk ist auf vier Bände berechnet, die mit Ausnahme des dritten, der Mehring’s Geschichte der deutschen Sozialdemokratie enthalten wird, unter der Redaktion der Unterzeichneten erscheinen. Ob es gelingt, den ungeheuren Stoff in diesen Rahmen zusammenzudrängen, muß die Erfahrung lehren. Auf jeden Fall bleibt die Eintheilung der ersten drei Bände die im Prospekt angezeigte.
Groß ist die Aufgabe, die wir uns gestellt, aber wir geben uns der Hoffnung hin, daß es uns gelingen wird, ein ihrer nicht unwürdiges Resultat zu erzielen. Wir haben uns bemüht, die Unterstützung der anerkannt zuverlässigen und kompetenten literarischen Vertreter der Internationalen Sozialdemokratie für unser Unternehmen zu gewinnen, und mit ihrer Hilfe glauben wir dem zu bewältigenden Stoff gewachsen zu sein. Die einzige Garantie fruchtbarer Arbeit liegt darin, daß sie von Leuten verrichtet wird, die ihren Stoff kennen und ihn mit Lust und Liebe behandeln. An diese Richtschnur haben wir uns gehalten. Jeder Mitarbeiter dieses Unternehmens schreibt nur über solche Kapitel der Geschichte, die er zum Gegenstand spezieller Studien gemacht, die sein besonderes Interesse m Anspruch genommen. Ein Jeder giebt sein Bestes, und wenn es dem Buch gelingt, den Lesern ebensoviel Interesse einzuflößen wie seinen Verfassern, so ist sein Erfolg gewiß.
London und Stuttgart, Februar 1895 E. Bernstein K. Kautsky
Einleitung
Die moderne, internationale Sozialdemokratie hat geschichtlich zwei Wurzeln. Beide entstammen demselben Boden – der bestehenden Wirthschafts- und Eigenthumsordnung. Beide haben dasselbe Ziel – die Aufhebung der unsäglichen Leiden, welche unsere Gesellschaft über so viele ihrer Mitglieder, namentlich aber über die Schwächsten unter ihnen, die Besitzlosen, verhängt, durch Aufhebung dieser Wirthschafts- und Eigenthumsordnung. Aber beide sind völlig verschieden in ihrem Wesen.
Die eine dieser Wurzeln – der kommunistische Utopismus – entstammt den höheren Klassen. Die Träger dieses Utopismus gehören zu den geistigen Spitzen der Gesellschaft. Die andere der Wurzeln der Sozialdemokratie – der Gleichheitskommunismus – entstammt den untersten Klassen der Gesellschaft, jenen, die bis vor wenigen Jahrzehnten auch geistig zu den tiefstehenden zählten. Der Utopismus verdankte sein Entstehen der tiefen Einsicht hochgebildeter Männer, die von den besonderen Interessen der Klasse, der sie entsprossen waren, nicht beherrscht wurden. Der Gleichheitskommunismus ist roh und naiv; nicht soziale Einsicht, nicht uninteressirtes Denken und Fühlen haben ihn geschaffen, sondern dringende materielle Bedürfnisse, der Kampf im Klasseninteressen.
Der bürgerliche, philanthropische, utopistische Kommunismus beginnt mit Thomas More. Der Gleichheitskommunismus des modernen kämpfenden Proletariats ist noch jünger. Seine ersten Regungen zeigen sich in der englischen Revolution des 17. Jahrhunderts.
Aber beide, der Utopismus wie der Gleichheitskommunismus der kapitalistischen Periode, haben ihre Vorgänger. Das Staatsideal, das Plato aufstellte, ist auf die Utopisten nicht ohne Einfluß geblieben, und die Anfänge des Gleichheitskommunismus tragen noch die Spuren des religiösen Kommunismus christlicher Sekten. Freilich ist die Beeinflussung keine sehr tiefgehende gewesen. So wie die kapitalistische Gesellschaft wesentlich verschieden ist von der antiken und der feudalen, so ist der neuere Kommunismus ein ganz anderer als der Plato’s und der des ursprünglichen oder des mittelalterlichen Christenthums. Jede dieser Arten des Kommunismus wurzelt in ihrer Zeit, entnimmt dieser ihre Kraft und ihre Ziele. Ihre Vorgänger können ihr kaum mehr sein als eine Stütze, an die sie sich lehnt, die ihr Selbstgefühl erhöht und in manchen Punkten das Auffinden von Beweisgründen erleichtert. Sie können sehr bedeutend ihr äußeres Auftreten, jedoch sehr wenig ihr innerstes Wesen beeinflussen.
Zum vollen Verständniß der Ursprünge des modernen Sozialismus ist es indeß unerläßlich, diejenigen seiner Vorgänger in Betracht zu ziehen, die sie in erkennbarer Weise beeinflußt haben – wie eben gesagt, den platonischen und den christlichen Kommunismus.
Aber deren Betrachtung ist für uns noch von einem anderen Gesichtspunkte aus von Bedeutung – und dieser Gesichtpunkt ist der wichtigere. Man kann die besonderen Eigenthümlichkeiten einer Erscheinung nur erkennen, wenn man diese mit anderen, gleichartigen Erscheinungen vergleicht. Eine derartige Vergleichung der verschiedenen Erscheinungsformen des Kommunismus hat schon oft stattgefunden, aber meist, um den entgegengesetzten Zweck zu erreichen; nicht um die besonderen Eigenthümlichkeiten des modernen Sozialismus hervortreten zu lassen, sondern um sie zu verwischen. Da werden die verschiedenen Arten des Kommunismus zusammen in den gleichen Topf geworfen, und was für die eine gilt, soll unterschiedslos für alle gelten. Diese Methode ist nicht nur sehr bequem, denn die allen Arten des Kommunismus gemeinsamen Züge liegen an der Oberfläche, sie ist auch für die Gegner der Sozialdemokratie sehr erwünscht, indem sie ihnen erlaubt, alles Mißliche und Unangenehme, was früheren Kommunisten passirt ist, als die naturnothwendige Folge der Bestrebungen des heutigen Sozialismus hinzustellen.
Um dessen Eigenart zu erkennen, ist es höchst nothwendig, die Eigenart seiner Vorgänger zu erforschen; und auf seine Daseinsberechtigung und seine Aussichten wird ein neues Licht fallen, wenn wir die Bedingungen kennen lernen, unter denen seine Vorgänger erwachsen und vergangen sind. Dies wird vornehmste Aufgabe in den ersten Abschnitten des vorliegenden Bandes bilden. Wir werden dabei genöthigt sein, neben einer Geschichte kommunistischer Ideen und Bestrebungen auch ein gut Stück allgemeiner Entwickelungsgeschichte der Gesellschaft zu geben. Wird der Weg dadurch auch etwas verschlungener und länger, so bietet er dafür auch größere Mannigfaltigkeit und gewährt die Möglichkeit weiterer Ausblicke. Und unser Interesse und unsere Sympathie für die Helden des Geistes und des Schwertes, die in den vergangenen Jahrhunderten um die Vernichtung jeglicher Ausbeutung und Unterdrückung gerungen, kann nur wachsen, wenn wir nicht blos ihre Ideen und ihre Thaten kennen, sondern sie auch aus ihrer Zeit begreifen lernen.
Erster Abschnitt - Der platonische und der urchristliche Kommunismus
Erstes Kapitel - Der Idealstaat Plato’s
1. Plato und seine Zeit
Nichts irriger, als die weitverbreitete Anschauung, der Kommunismus widerspreche dem Wesen des Menschen, der Menschennatur. Im Gegentheil, an der Wiege der Menschheit stand der Kommunismus, und er ist noch bis zu unserer Zeit die gesellschaftliche Grundlage der meisten Völker des Erdballs gewesen.
Weit entfernt, unvereinbar zu sein mit dem Gesetze des Kampfes ums Dasein, bildete er vielmehr die wichtigste Waffe der Menschheit in diesem Kampfe. Nur durch die innigste Zusammenschließung zu kleineren oder größeren Gemeinschaften konnten die nackten, waffenlosen Menschen der Vorzeit sich in den Wildnissen gegenüber ihren furchtbaren Feinden behaupten. Der primitive Mensch lebte nur in und mit seinem Gemeinwesen, seine Persönlichkeit hatte noch nicht die Nabelschnur zerrissen, die sie damit verband. In Gemeinschaft erwarben die Menschen ihren Lebensunterhalt – gemeinsam jagten sie, gemeinsam fischten sie –, in Gemeinschaft wohnten sie, gemeinsam vertheidigten sie das gemeinsame Land, den gemeinsamen Grund und Boden.
Aber das änderte sich mit den Fortschritten der Produktion. Sie erzeugten neben dem Gemeineigenthum das Privateigenthum. Ursprünglich umfaßte nur einige geringfügige Gegenstände des persönlichen Gebrauchs, die meist ihr Träger auch selbst verfertigt hatte, Schmuck, Waffen und dergl., Gegenstände, die so mit ihrem Urheber und Träger verwachsen schienen, daß man sie ihm oft nach seinem Ableben mit in’s Grab gab.
Aber almälig nahm das Privateigenthum an Umfang und Bedeutung zu, es begann auch auf bedeutendere Produktionsmittel sich zu erstrecken Und ergriff schließlich sogar das wichtigste Produktionsmittel, die Grundlage unserer Seins, den Grund und Boden. Die Jagd und die Weidewirthschaft verlangen noch das Gemeineigenthmn au Grund und Boden. Ganz anders der Ackerbau. Er wurde bis zur Entwickelung des modernen, landwirthschaftlichen Großbetriebes am besten betrieben in der Einzelwirthschaft besonderer Familien, und diese Einzelwirthschaft bedarf zu ihrer Entwickelung des Privateigenthums an Grund und Boden. Wo der Ackerbau sich entwickelt und die früheren Produktionsformen verdrängt, da entwickelt sich auch immer stärker das Bedürfniß nach dem Privateigenthum an Grund und Boden.
Die Entwickelung der städtischen Industrie und des Handels bedingt von vornherein das Privateigenthum an den Produktionsmitteln und Produkten. Aber nicht nur der Bereich des Privateigenthums dehnt sich immer mehr aus, es verliert auch eine seiner Schranken nach der anderen, die immer lästiger werden, je mehr der Handelsverkehr und die das Privateigenthum erheischenden Produktionsweisen sich entwickeln.
Es wurde aus einem rein persönlichen Eigenthum, das nach dem Tode des Besitzers mit ihm vernichtet wurde oder an die Gemeinschaft zurückfiel, ein auf andere Personen vererbliches Eigenthum.
Die ursprüngliche Gleichheit verschwand, das Privateigenthum wurde zu einer gesellschaftlichen Macht, die Gesellschaft spaltete sich in Eigenthümer, die herrschten, und Eigenthumslose, die in Abhängigkeit waren, das Erwerben von Privateigenthum wurde zu einer gesellschaftlichen Nothwendigkeit. Das Aufkommen des Geldes endlich verwandelte die Erwerbslust in einen maßlosen Drang.
Das Bedürfniß nach Gebrauchsgütern ist stets ein beschränktes. So lange der Reichthum nur in Gebrauchsgütern besteht, verlangt man nicht mehr davon, als man zu einem bequemen, angenehmen Leben nöthig ist. Geld dagegen kann man nie genug haben, denn Geld ist die Waare, mit der man alle anderen kaufen kann, eine Waare, die nicht verdirbt, die stets verwendbar ist. Das Aufhäufen von Schätzen, von großen Vermögen weit über das eigene Bedürfniß hinaus, wird nun zu einer Lebensaufgabe der Besitzenden. Der Gegensatz zwischen Reich und Arm kann von nun an ein unermeßlicher werden, und er wird es überall, wo die Bedingungen dazu sich bilden.
Die Verhältnisse der Menschen zueinander und ihr ganzes Denken und Sein verändern sich damit. Die Hingabe für das Gemeinwesen, die Selbstaufopferung, war ehedem die Haupttugend des Menschen gewesen. Sie schwindet nun immer mehr dahin. Jeder ist sich selbst der Nächste. Die Gemeinwesen zerfallen in Klassen, die einander auf das Erbittertste bekämpfen, sie zerfallen in Individuen, von denen jedes nur seinen eigenen Vortheil im Auge hat, von denen jedes dem Gemeinwesen möglichst wenig giebt und möglichst viel nimmt. Immer· lockerer werden die Bande, die den Einzelnen an sein Gemeinwesen fesseln und dieses zusammenhalten; es verkommt oder wird die Beute eines Volkes, das in seiner Entwickelung zurückgeblieben, noch kommunistische Tugend und kommunistische Kraft besitzt.
Das ist die Geschichte aller Nationen und Staaten im Alterthum.
Vielleicht am schnellsten und auffallendsten vollzog sich dieser Entwickelungsgang in Athen. Der Zeitraum vor der Beendigung der Perserkriege bis zur Unterjochung Griechenlands durch Philipp von Macedonien umfaßt kaum anderthalb Jahrhunderte (479–338 vor Beginn unserer Zeitrechnung). Am Beginn desselben finden wir (auch abgesehen von den Sklaven, die ja nicht zum Gemeinwesen gehörten) wohl schon Klassenunterschiede und Klassengegensätze, bevorrechtete Aristokraten und rechtlose Volksschichten, Reiche und Arme, aber noch waren diese Gegensätze nicht so weit gediehen, um das gemeinsame Interesse am Staatswesen in der freien Bevölkerung zu ersticken. Im letzten Drittel dieses Zeitraums gab es in Attika neben einer Menge Sklaven fast nur noch Reiche und Bettler.
„In früherer Zeit,“ rief der damals lebende Redner Demosthenes in einer seiner Gerichtsreden, „war es anders als jetzt. Damals war Alles, was dem Staate angehörte, reich und glänzend, unter den einzelnen Bürgern aber zeichnete sich äußerlich keiner vor dem anderen aus. Noch jetzt kann Jeder von Euch sich durch eigenen Anblick überzeugen, daß die Wohnungen eines Themistokles, eines Miltiades und aller übrigen großen Männer der Vorzeit durchaus nicht schöner und ansehnlicher waren als die ihrer Mitbürger. Dagegen sind die zu ihrer Zeit errichteten öffentlichen Gebäude und Denkmale so großartig und prachtvoll, daß sie ewig unübertrefflich bleiben werden; ich meine die Propyläen, die Arsenale, die Säulengänge, die Hafenbauten des Piräus und andere öffentliche Werke unserer Stadt. Jetzt aber giebt es Staatsmänner, deren Privatwohnungen viele öffentliche Gebäude an Pracht überbieten, und welche so große Landgüter zusammengekauft haben, daß die Felder von Euch Allen, die Ihr hier als Richter versammelt seid, an Ausdehnung denselben nicht gleichkommen. Was dagegen jetzt von Staatswegen gebaut wird, das ist so unbedeutend und ärmlich, daß man sich schämen muß, davon zu reden.“
In ganz Griechenland konnte man diese Erscheinung beobachten, aber am auffallendsten zeigte sie sich in Athen, denn dieses war durch die Perserkriege der mächtigste Staat in Griechenland geworden und es hatte die griechische Freiheit vor dem Perserjoche nur gerettet, um den Griechen sein eigenes Joch aufzulegen. Fast die ganze Bevölkerung der Inseln und Küsten des ägäischen Meeres (und noch manche Küstenstadt und Insel außerhalb desselben) wurde ihm unterthan und zinspflichtig, neben der Sklavenarbeit und den Profiten eines mächtig aufblühenden Handels wurden Kriegsbeute und Tribute Unterworfener stete Einkommensquellen der Bevölkerung Athens, Mittel, die Reichen noch reicher zu machen und die übrigen Freien, die aus den großen Staatseinnahmen Nutzen zogen, der Arbeit zu entwöhnen, sie ins Lumpenproletariat hinabzudrücken, die ganze Bevölkerung zu korrumpiren und zu entnerven. Sies wurden aber auch Mittel, Athen in ganz Griechenland auf’s Aeußerste verhaßt zu machen.
Schließlich kam es zu einem Kampf auf Leben und Tod zwischen dem sich stetig ausbreitenden Athen und den noch nicht von ihm unterworfenen Staaten des Peloponnes unter der Führung Spartas. Dieser Kampf war aber nicht nur ein Krieg gegen die Oberherrschaft Athens, er war auch ein Krieg zwischen Demokratie und Aristokratie. Athen war der demokratischste Staat Griechenlands, Sparta der aristokratischste. In allen Athen unterworfenen Staaten mußten vornehmlich die Aristokraten die Zeche zahlen; sie wurden in erster Linie geplündert, nicht das Volk. In Athen selbst wälzte das Volk die Staatslasten so viel als möglich auf die Aristokraten und Reichen ab. Athen wurde daher allenthalben von den Aristokraten und Reichen besonders bitter gehaßt; in diesem Staate selbst war die soziale Zersetzung, waren die Gegensätze zwischen Arm und Reich so weit gediehen, daß die Aristokraten und Reichen Athens mit Sparta, mit dem Landesfeinde, liebäugelten und konspirirten. Ein Sieg Spartas erschien ihnen als das beste Mittel, die Herrschaft des Volkes zu stürzen.
Der entscheidende Kampf zwischen Athen nud Sparta, der sogenannte peloponnesische Krieg, dauerte fast dreißig Jahre (431–404) und endete mit der völligen Vernichtung der athenischen Macht. Athen wurde auf Attika beschränkt und von Sparta abhängig. An Stelle der Demokratie trat ein Regiment charakterloser Kreaturen Spartas.
Das war eine Situation, die besonders aufforderte, Einkehr zu halten, über die Ursachen des Gedeihens und Verfallens der Staaten nachzudenken. Die Frage nach der besten Staatsverfassung war damals allgemein.
1mter diesen historischen Verhältnissen erwuchs Plato.
Er wurde wenige Jahre nach dem Beginn des peloponnesischen Krieges zu Athen geboren als Sohn eines alten aristokratischen Hauses. Er hat auch seine aristokratische Abkunft nie verleugnet und stets eine Abneigung gegen die Demokratie bewahrt. In angenehmen Vermögensumständen konnte er ganz der Entwickelung seines Geistes leben und fing früh an, sich mit Dichtkunst und Philosophie zu beschäftigen. Seine Bekanntschaft mit Sokrates – wahrscheinlich in seinem 20. Lebensjahr – wurde für ihn entscheidend. Er widmete sich von nun an völlig der Philosophie und wurde des Sokrates bedeutendster Schüler. Aber er erweiterte den Sokratischen Ideenkreis durch selbständige Studien und eine Reihe von Reisen, die er nach dem Tode seines Freundes und Meisters unternahm, Reisen, die ihn nach Aegypten, Cyrene, Süditalien und Sizilien führten.
Von seinen Reisen zurückgekehrt, trat er in Athen öffentlich als Lehrer auf. Aber noch zweimal unterbrach er seine Lehrthätigkeit, um längere Reisen nach Sizilien auszuführen.
Die Ursache davon ist bezeichnend für den Verfall des politischen Lebens zu Plato’s Zeit. Dieser hatte ein System besonderer politischer Grundsätze entwickelt, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, aber es fiel ihm auch nicht ein, auch nur das Geringste zu thun, um seinen Ueberzeugungen und Anschauungen durch Theilnahme am politischen Leben Geltung zu verschaffen.
Damit ist jedoch nicht gesagt, daß seine Ideen über Staat und Gesellschaft nicht praktisch gemeint waren, daß sie bloße Phantasien bleiben sollten.
368 starb der ältere Dionysius, Tyrann (Alleinherrscher) von Syrakus. Sein Sohn, Dionysius der Jüngere, hatte einige philosophische Allüren an den Tag gelegt und galt für einen Reformer, wie das bei Kronprinzen seit jeher der Brauch gewesen zu sein scheint. Dion, Plato’s Freund und des Dionysius Schwager, hoffte diesen für ihre gemeinsamen Bestrebungen zu gewinnen, und Plato selbst reiste auf diese Ansicht hin nach Syrakus, um durch den Tyrannen zu erreichen, wofür er in der Demokratie keinen Finger rührte: die Verwirklichung seiner politischen Ideale.
Natürlich erlebte er eine arge Enttäuschung. Dionysius hatte es ganz gern, wenn die Philosophen sich an seinen Hof drängten und dessen Ruhm vermehrten, aber sie durften ihn nicht bei den Freuden stören, die Wein, Weib und Gesang bereiten konnten. Als ihm die Philosophen unbequem wurden, ließ sie der „Philosoph auf dem Thron“ einfach hinauswerfen – verbannen. Als Plato, dadurch nicht gewitzigt, einige Jahre später eine zweite Reise au den Hof von Syrakus unternahm, zog er sich die Feindschaft des Tyrannen in einem solchen Grade zu, daß er froh sein mußte, sein Leben zu retten und mit einem blauen Auge davon zu kommen.
Damit endigte die politische Thätigkeit unseres Philosophen. Seine Lehrthätigkeit setzte er dagegen bis zu seinem Tode fort, der in seinem 81. Jahre eintrat.
II. Das Buch vom Staat
Von den Schriften Plato’s kommt für uns hier nur eine in Betracht, die erste philosophische, systematische Vertheidigung des Kommunismus, die auf uns gekommen ist: die Politeia, das Buch vom Staat, dessen Entstehungszeit wahrscheinlich in die Zeit kurz vor seiner ersten Reise an den Hof Dionysius des Jüngeren um 368 fällt.
Den wesentlichen Inhalt dieses Buches bildet die Untersuchung der Frage: Welches ist die beste Staats- und Gesellschaftsverfassung?
Daß die bestehenden Staats- und Gesellschaftsformen schlecht sind, unterliegt für Plato keinem Zweifel.
Das Privateigenthum, sagt er, der Gegensatz zwischen Reich und Arm, führt zum Untergang der Staaten.
„Verhalten sich nicht Tugend und Reichthum so, daß, läge jedes von ihnen auf der Schale einer Waage, Eines absteigen müßte, wenn das Andere aufsteigt? ... Werden also der Reichthum und die Reichen in einem Staat geehrt, so werden die Tugend und die Guten minder geachtet ... Ein solcher Staat ist nothwendig nicht einer sondern zwei: den einen bilden die Armen, den anderen die Reichen, welche Beide zusammenwohnen, Einer dem Anderen Böses sinnend (ἐπιβουλεύοντες ) ... und am Ende sind sie (die herrschenden Reichen) außer Stande, einen Weg zu führen, weil sie sich entweder der Menge bedienen müssen, vor welcher sie sich dann, wenn sie bewaffnet ist, mehr fürchten als· vor den Feinden; oder wenn sie sich ihrer nicht bedienen, so erscheinen sie dann im Gefecht nur als eine geringe Streitmacht, und überdies wollen sie keine Steuern zahlen, weil sie das Geld so sehr lieben.“
Die Armen aber, die Proletarier, vergleicht Plato mit Drohnen – ein bezeichnender Vergleich, der uns deutlich den Unterschied zwischen dem antiken und dem modernen Proletariat zeigt. Die freien Besitzlosen waren zumeist Lumpenproletarier. Heute lebt die Gesellschaft von den Proletariern, damals lebten die Proletarier von der Gesellschaft. Sie lebten von der Ausbeutung des Staates und der Reichen, die aus Sklavenarbeit und Erpressungen Unterworfener ihre Einnahmen zogen. Aber, meint Plato weiter, die zweibeinigen Drohnen unterscheiden sich von den geflügelten: nicht alle unter ihnen sind stachellos.
„Aus den Stachellosen werden Bettler auf ihr Alter, aus den mit Stacheln bewehrten alles Gaunervolk ... Diebe und Beutelschneider und Tempelräuber und Verüber ähnlicher Schandthaten.“ (VIII. Buch, 6. und 7. Kap.)
Ein Staat, in dem zwei derartige Staaten miteinander in Zwietracht leben, ist dem Untergang geweiht, mögen nun die Reichen herrschen (Oligarchie) oder die Armen (Demokratie).
Welche Staatsverfassung schlägt aber Plato an Stelle dieser „schlechten Verfassungen“ vor?
Nur der Kommunismus, meint er, kann die Zwietracht bannen.
Aber er ist viel zu sehr Aristokrat, um die Klassenunterschiede aufheben zu wollen. Der Kommunismus soll zum staatserhaltenden konservativen Element gemacht werden, jedoch nur als Kommunismus der herrschenden Klasse. Wird das Privateigenthum für die herrschende Klasse aufgehoben, dann, sagt et, hört jede Versuchung für diese auf, das arbeitende Volk auszubeuten und zu bedrücken, dann werden die Herrschenden nicht mehr Wölfe sein, sondern treue Wachhunde, die einzig nur ihrer Aufgabe leben, das Volk zu schützen und zu seinem Besten zu führen.
Für die arbeitenden Klassen, die Bauern und Handwerker, besteht im Staate Plato’s das Privateigenthum fort, ebenso fur die Krämer und Großhändler. Und in der That, die Aufhebung des Privateigenthums für sie widersprach den Bedürfnissen der damaligen Produktionsweise. Denn noch war die Grundlage der Produktion der Kleinbetrieb in Ackerbau und Handwerk. Dieser bedingt aber, wie wir bereits bemerkt haben, mit Naturnothwendigkeit das Privateigenthum an den Produktionsmitteln. Wohl kannte man auch schon größere Betriebe, aber nur mit Sklaven. Die Technik in Ackerbau und Industrie war noch nicht so weit entwickelt, daß sie gesellschaftliche Produktion verlangt hätte. Wo nicht äußerer Zwang die Arbeiter zusammentrieb, wo diese freie Männer waren, da arbeiteten sie jeder für sich. Das Privateigenthum an den Produktionsmitteln für freie Arbeiter abschaffen wollen, wäre zu Plato’s Zeit ein Unding gewesen. Sein Sozialismus war demnach ein von dem modernen grundverschiedener.
Die herrschende Klasse im platonischen Idealstaat produzirt nicht. Sie wird erhalten durch die Beiträge der arbeitenden Klassen. Ihr Kommunismus ist nicht ein Kommunismus der Produktionsmittel, sondern der Genußmittel, dies Wort im weitesten Sinne genommen, ein Kommunismus des Konsums.
Die herrschende Klasse, das sind die Wächter des Staates. Sie werden mit besonderer Sorgfalt ausgewählt aus den Besten und Tüchtigsten. Die Kinder der Wächter haben wohl bessere Aussichten, als die anderen Kinder im Staat, dieser Klasse eingereiht zu werden, weil der Apfel nicht weit vom Stamme fällt. Aber wenn einer der Nachkommen der Wächter seinem Posten nicht gewachsen ist, dann soll er ohne Mitleid aus deren Klasse ausgeschlossen werden; umgekehrt sollen sie, wenn unter den Handwerkern und Ackerbauern einer aufwüchse, in dem sich edle Eigenschaften zeigten, „einen solchen in Ehren halten und unter die Herrscher erheben.“
Die Aristokratie im platonischen Staat beruht also nicht auf einem Geburtsadel.
Der zur Aufnahme in die Klasse der Wächter bestimmte Nachwuchs wird einer besonderen, sorgfältigen Erziehung unterworfen, die Plato ausführlich beschreibt, auf die hier einzugehen jedoch nicht der Ort ist.
„Außer der Erziehung nun,“ fährt Plato fort , „möchte wohl ein Vernünftiger sagen, müßten auch ihre Wohnungen und ihre ganze übrige Habe so eingerichtet sein, daß dadurch die Wächter weder davon abgebracht werden, die Besten zu sein, noch auch gereizt, gegen die anderen Bürger zu freveln.“
„Sehr wahr,“ sagte er (Glaukon).
„Sieh also zu,“ erwiderte ich (Sokrates), „ob sie etwa auf folgende Weise leben und wohnen müssen, wenn sie derartig werden sollen. Vor Allem soll keiner etwas zu Eigen besitzen, wenn es irgend zu vermeiden ist; keine besondere Wohnung soll er haben, noch eine Vorrathskammer, wohin nicht Jeder könnte, der Lust hat. Das Nothwendige aber, dessen ebenso tapfere wie mäßige Krieger bedürfen, sollen sie der Reihe nach von den anderen Bürgern als Lohn für ihren Schutz in solchen Mengen empfangen, daß sie keinen Mangel haben, daß ihnen aber auch nichts für das nächste Jahr übrig bleibt. Gemeinsam sollen sie leben und wie im Felde Stehende gemeinsame Mahlzeiten (Suffitien) abhalten. Gold und Silber aber, muß man ihnen sagen, haben sie von den Göttern als Göttliches immer in der Seele, daher bedürfen sie nicht des Goldes und Silbers der Menschen. Es sei ihnen auch garnicht gestattet, den Besitz des göttlichen Goldes durch den des sterblichen zu verunreinigen, da gar Vieles und Unheiliges mit dieser gemeinen Münze vorgefallen ist, indeß das Gold in ihrer Seele lauter sei. Ihnen allein im Staat sei es verboten, mit Gold und Silber sich abzugeben, es zu berühren, es in der Wohnung zu haben oder an der Kleidung oder daraus zu trinken. Besäßen sie selbst eigenes Land und Wohnungen und Gold so würden sie Hauswirthe und Landwirthe sein und nicht Wächter, harte Gebieter und nicht Genossen der anderen Bürger; sie würden dann hassend und gehaßt, belauernd und belauert ihr ganzes Leben hinbringen, weit mehr den inneren Feind fürchtend als den äußeren, und dem Verderben entgegen reimen, sie und die ganze Stadt.“ (III. Buch, 22. Kap.)
Aber Plato verlangt nicht nur die Gemeinschaft der Güter für seine „Wächter.“ Alles, was Privatinteressen bei ihnen erzeugen, Zank und Zwietracht unter ihnen säen könnte, soll ausgeschlossen sein. Daher verlangt er für sie die Aufhebung der Einzelfamilie, die Gemeinschaft der Weiber und Kinder.
Was unsere heutigen Sozialistenfresser als Beweis für die viehische Verkommenheit der Sozialdemokraten hinstellen, die Forderung der Aufhebung der Familie und Ehe, das können sie bei jenem Philosophen des Alterthums finden, den heute die offiziellen Hüter von Zucht und Sitte, den namentlich unsere Geistlichen am meisten erheben, besonders um seiner „fast christlichen“ Ethik willen.
„Mit dem ganzen Vorhergegangenen,“ läßt Plato Sokrates sagen, „hängt meiner Meinung nach folgende Einrichtung zusammen.“
„Welche?“
„Daß die Weiber alle den Männern gemein seien, keine aber mit irgend einem besonders zusammenlebe. Und auch die Kinder sollen gemein sein, so daß weder ein Vater sein Kind kenne, noch ein Kind seinen Vater.“ (V. Buch, 7. Kapitel)
Damit meint jedoch Plato nicht gänzlich regellosen Geschlechtsverkehr. Aber dieser soll nur von einem Prinzip beherrscht werden: dem der geschlechtlichen Zuchtwahl. Die Frauen dürfen nur vom 20. bis zum 40. Jahre „dem Staate gebären;“ die Männer nur vom 30. bis zum 55. Jahre „dem Staate zeugen.“ Wer vor oder nach diesem Alter Kinder zeugt oder gebärt, macht sich eines Vergehens schuldig. Dergleichen Kinder soll man beseitigen durch eine künstliche Fehlgeburt oder durch Aussetzung. Aufgezogen dürfen sie nicht werden. Die innerhalb dieser Altersgrenzen Stehenden sollen aber von den Regenten möglichst so gepaart werden, daß „die Tüchtigsten den Tüchtigsten am meisten beiwohnen und die Untauglichsten den Untauglichsten; und die Kinder der ersteren sollen aufgezogen werden, die Kinder der letzteren aber nicht, wenn die Heerde tadellos bleiben soll; und dies Alles (die Regelung der Paarung) muß völlig unbekannt bleiben, außer den Obern selbst, damit die Schaar der Wächter stets möglichst von Zwietracht frei bleibe.“
Diejenigen aber, die über das vorgeschriebene Zeugungsalter hinaus sind, mögen sich vermischen nach Herzenslust und Gutdünken innerhalb ihrer Altersschicht.
„Die neugeborenen Kinder nehmen die dazu bestimmten Behörden an sich, die aus Männern oder Frauen oder beiden bestehen, denn die Aemter sind ja Männern und Frauen gleich zugänglich.“
„Gut.“
„Die Kinder der Tüchtigen nun, denke ich, tragen sie in das Säugehaus zu Wärterinnen, die in einem besonderen Theil der Stadt wohnen, die der Untauglichen aber und ebenso die mißgestaltet Geborenen werden sie, wie es sich gehört, zu einem unzugänglichen und unbekannten Orte verbergen.“
„Sicher,“ sagte er, „wenn das Geschlecht der Wächter edel bleiben soll.“
„Diese Behörden werden auch für die Ernährung der Säuglinge sorgen, indem sie die Mütter, wenn sie von Milch strotzen, in das Säugehaus führen, wobei sie jedoch möglichst darauf bedacht sind, daß keine ihr Kind erkenne, und indem sie, wenn jene nicht hinreichen, noch andere Säugende herbeischaffen.“ (V. Buch, 9. Kap.)
Alles das erscheint für Unser Empfinden seltsam, ja abstoßend. Nicht so für die Griechen der Zeit Plato’s. Wohl herrschte unter ihnen die Einehe, aber diese war, wie sie selbst offen erklärten, nur eine Einrichtung zur Erzielung legitimer Kinder, zur Sicherung des Erbrechtes. Die Ehen wurden nicht im Himmel der Liebenden geschlossen, sondern von den Familienhäuptern verabredet, wobei nicht die Neigungen der Betheiligten, sondern ihre Vermögensverhältnisse in Betracht kamen. Ein junger Mann hatte in der Regel gar keine Gelegenheit, ein Mädchen aus gutem Hause vor seiner Verlobung mit ihr kennen zu lernen.
Neben der Sorge um die Vermehrung und Vererbung des Vermögens war bei den Eheschließungen auch die für Erzielung einer kräftigen Nachkommenschaft sehr maßgebend. In Sparta, wo die Vermögensverhältnisse eine geringere Rolle spielten, dagegen die Kriegstüchtigkeit der Spartiaten in erster Linie stand, waren bei den Eheschließungen die Rücksichten der geschlechtlichen Zuchtwahl von großer Bedeutung. So stark wirkte sie, daß unter Umständen ein Gatte seine ehelichen Rechte einem anderen abtrat, weil dieser kräftiger war, bessere Kinder zu zeugen versprach. Plutarch verglich in der That die spartanische Ehe mit einem Gestüt, in dem es sich nur um die Erzeugung einer möglichst edlen Rasse handle.
Angesichts dessen war die Regelung der Paarung durch die Obrigkeit nach den Regeln der Zuchtwahl für die Zeitgenossen Plato’s weder etwas Widersinniges noch etwas Widerliches.
Die Aufhebung der Familie, der geschlechtliche Kommunismus, war aber die logische Konsequenz des Kommunismus der Genüsse. In der That, wo alle Genüsse gemeinsam sein sollen, war es höchst inkonsequent, einen so machtvollen, das gesellschaftliche Leben so tief beeinflussenden Genuß wie den geschlechtlichen dem Bereich der Gemeinsamkeit zu entziehen.
Dagegen steht die Weibergemeinschaft, der geschlechtliche Kommunismus, nicht im geringsten logischen Zusammenhang mit der Forderung des Gemeineigenthum an den Produktionsmitteln, die der moderne Sozialismus erhebt, man müßte denn die Frau zu den Produktionsmitteln rechnen.
In einem anderen Punkte berührt sich jedoch das platonische Ideal mit einer Forderung der heutigen Sozialdemokratie. So wie diese, verlangt Plato die Gleichstellung von Mann und Weib, die Zulassung der letzteren zu allen Aemtern (freilich nur innerhalb der Klasse der Wächter). Sogar in den Krieg sollen die Frauen mitziehen. Sie sollen auch dieselbe Erziehung erhalten wie die männlichen Wächter.
„Von allen Beschäftigungen, durch die der Staat besteht, giebt es keine, die dem Weibe als Weib oder dem Manne als Mann zukommt; die natürlichen Anlagen sind in Beiden auf ähnliche Weise vertheilt und die Frau kann ihrer Natur nach ebenso wie der Mann an allen Beschäftigungen theilnehmen; in Allen aber ist das Weib schwächer als der Mann ... Mögen sich also immer die Frauen unserer Wächter entkleiden (um Leibesübungen vorzunehmen, wie die Männer), da sie ja Tugend statt des Gewandes überwerfen werden, und mögen sie Theil nehmen am Kriege und an der Regierung des Staates und mögen Anderes nicht verrichten. Hiervon aber wollen wir das Leichtere den Weibern zutheilen vor den Männern wegen der Schwäche ihres Geschlechts. (V. Buch, 5. und 6. Kap.)
Die Grundlage der gesellschaftlichen und politischen Gleichstellung der Frau mit dem Manne bildet ihre Befreiung von den Arbeiten des Haushaltes. Im platonischen Staat geschieht dieses dadurch, daß diese Arbeiten den arbeitenden Klassen zugewiesen werden. So lange es nicht möglich war, zum mindesten die schwersten dieser Arbeiten von der Maschine besorgen zu lassen, konnte eine Emanzipation der Frau auf anderer Grundlage nicht erreicht werden.
So kühn alle diese Ideen Plato’s sind, sie sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern haben eine reale Grundlage. Wir haben dies schon bei einer seiner kühnsten Ideen, der Einführung planmäßiger Zuchtwahl in den Geschlechtsverkehr, gesehen. Das Vorbild, das ihn dort leitete, hat seinen ganzen Ideengang beeinflußt. Dieses Vorbild war Sparta, der, wie wir bereits erwähnt haben, aristokratischste Staat Griechenlands, der sich daher stets der besonderen Sympathie der athenischen Aristokratie erfreute. Diese Sympathien waren so stark , daß sie mit beigetragen haben zu der Niederwerfung Athens durch Sparta im peloponnesischen Kriege.
Die spartanischen Sympathien, die Plato als Aristokrat hegte, wurden jedenfalls nicht vermindert durch den Einfluß, den die antidemokratischen Tendenzen des Sokrates auf ihn übten.
Von den Schülern des Sokrates haben mehrere der hervorragendsten und bekanntesten sich spartanerfreundlich gezeigt. Xenophon, der Busenfreund des spartanischen Königs Agesilaos hat in spartanischen Diensten mehrere Feldzüge mitgemacht; er scheute sich sogar nicht, in der Schlacht bei Koronea (394) im Gefolge des spartanischen Feldherrn gegen seine Mitbürger, die Athener, zu fechten. Grund genug, daß er aus seiner Vaterstadt verbannt wurde. Alkibiades hatte es im peloponnesischen Kriege noch besser getrieben. Er ging als athenischer Feldherr zu den Spartanern über, wurde gewissermaßen deren Generalstabschef, theilte ihnen, alle schwachen Seiten Athens mit und führte so eine Reihe großer Niederlagen für dieses herbei, die thatsächlich den Krieg entschieden, wenn derselbe auch noch lange fortgeschleppt wurde. Und als Athen unterlegen war, wurde es eiine Beute der „dreißig Tyrannen,“ einer Bande aristokratischer Gesinnungslumpen, die das siegreiche Sparta dem athenischen Volk als Regenten aufgedrängt hatte. An der Spitze dieser Bande, die durch ein wüstes Schreckensregiment sich bereicherte und das niedergeworfene Athen vollends ruinirte, stand Kritias, ebenfalls ein Schüler des Sokrates.
Man muß das im Auge behalten, wenn man den Prozeß des Sokrates richtig verstehen will.
Angesichts alles Dessen dürfen wir uns nicht wundern, daß der spartanische Staat die Grundlage war, auf die Plato beim Aufbau seines Idealstaates sich stützte. Es läßt sich das in einer Reihe von Punkten nachweisen, doch ist hier nicht der Ort, diesen Nachweis zu führen.
Damit soll jedoch nicht gesagt sein, daß Plato den spartanischen Staat blos abgeschrieben hat. Dazu war er denn doch zu sehr Philosoph und dazu sah er die Schäden zu genan, an denen dieser Staat zu seiner Zeit schon krankte. Die Macht und der Reichthum, die Sparta durch den peloponnesischen Krieg und nach ihm erlangte, korrumpirten es ebenso schnell, wie Athen durch seine Siege in den Perserkriegen und deren Konsequenzen korrumpirt wurde. Die Reste eines urwüchsigen Kommunismus, die sich in Sparta noch erhalten hatten, boten ebensowenig Schutz dagegen, als die Ruinen einer Ritterburg Schutz vor der modernen Artillerie gewähren. Sie sanken zu bloßen Formen herab. Ihre größte Wichtigkeit zu Plato’s Zeit bestand vielleicht in der Anregung, die sie dem Geist des Forschers und Denkers gaben, kommunistische Zustände für möglich und wünschenswerth zu halten und aus den Gedankenkeimen, die sie boten, das konsequent durchgeführte System eines Kommunismus zu entwickeln, der zu seiner Zeit wenigstens ideell möglich war.
Allerdings nur ideell. Plato war Aristokrat, aber seine aristokratische Gesinnung bethätigte sich nur in der Abneigung gegenüber dem niederen Volk, nicht in dem Zutrauen zu seinen Standesgenossen. Er zweifelte an diesen ebenso wie an jenen. Der rohe spartanische Militarismus und die rücksichtslose spartanische Ausbeutungswirthschaft behagten ihm ebensowenig wie die athenische Volksherrschaft.
Darum theilte er in seinem Idealstaate die obere Klasse, die der Wächter, in zwei Unterabtheilungen: die Krieger und die Regenten. Nur die Letzteren sollen den Staat regieren, sie aber sollen Philosophen sein. Die Herrschaft des Kriegsadels war in seinen Augen ebenso verderblich wie die des Volkes, das zu seiner Zeit bereits zum großen Theil aus Lumpenproletariern bestand. Blos dies Herrschaft der Philosophen kann eine vernünftige Staatsleitung verbürgen.
„Ehe nicht das Geschlecht der Philosophen Herr im Staate wird (ἐγϰρατἐς γένηται),wird weder für den Staat noch für die Bürger ein Ende des Unglücks sein, noch wird die Verfassung, die wir ersonnen haben, in Erfüllung gehen.“ (VI. Buch, 13. Kap. Vgl. V. Buch, 15. Kap.)
Wie aber sollen die Philosophen im Staate zur Herrschaft gelangen? Nicht durch Antheilnahme an den politischen Kämpfen des Volkes, sondern dadurch, daß sie einen Alleinherrscher für sich gewinnen. (VI. Buch, 14. Kap.)
Wir wissen bereits, welche Erfahrungen Plato mit seinem Versuch machte, einen Alleinherrscher für seine Ideen zu interessiren.
Sein Schicksal war das Schicksal aller Utopisten nach ihm, das heißt aller derjenigen, die eine Erneuerung von Staat und Gesellschaft anstrebten, ohne in dieser selbst die dazu nöthigen Faktoren zu finden; sie mußten auf einen Akt großmüthiger Willkür eines politischen oder finanziellen Alleinherrschers hoffen, eines philosophischen Königs oder eines philosophischen Millionärs.
Zu Plato’s Zeit gab es in den Staaten, die er kannte, keine Volksschicht mehr, von der er eine Regeneration des Staates hätte erwarten können. Alles war angefault und zerfressen und bereits spukte die Idee einer Alleinherrschaft als letzte Rettung des Staates auch in den Köpfen von Republikanern. Xenophon, der Mitschüler Plato’s, schrieb einen Staatsroman, die Kyropädie, in dem der Segen der Herrschaft eines wohlerzogenen Königs gepriesen wird.
Bald nach Plato fingen die Philosophen an, in der Alleinherrschaft nicht mehr ein Mittel zu sehen, sie zur Herrschaft im Staate zu bringen, sondern nur noch ein Mittel, sie der 1ästigen Sorge um Staatsangelegenheiten zu entheben. Die Auflösung des Staates vollzieht sich auch im allgemeinen Bewußtsein. Es ist nicht mehr das Gemeinwesen, was die Philosophen beschäftigt, sondern das liebe Ich. Nicht nach der besten Staatsverfassung suchen sie mehr, sondern nach der besten Methode für den Einzelnen, auf eigene Faust glückselig zu werden.
Es entwickelt sich allmälig die Atmosphäre, der das Christenthum entspringt.
Zweites Kapitel - Der urchristliche Kommunismus
I. Die Wurzeln des urchristlichen Kommunismus
Wir haben bereits gesagt, daß die Entwickelung, die wir im Eingang des vorigen Kapitels geschildert und durch das Beispiel Athens belegt haben, das Schicksal aller Nationen und Staates im Alterthum gewesen ist.
Auch das weltbeherrschende Rom blieb davon nicht verschont. Es war schon weit in seinem inneren Niedergang fortgeschritten, als es auf der Höhe seiner äußeren Macht anlangte. Sein Reich, welches alle Länder um das Mittelmeer herum umfaßte, bildete ein Gemenge von Staaten, die alle auf derselben Bahn wandelten; die einen, im Osten und Süden des Mittelmeeres gelegen, waren Rom vorausgeeilt, die anderen im Westen und Norden, waren hinter ihm zurückgeblieben; aber sie waren eifrig bestrebt, dieselbe Höhe zu erreichen, wie die Hauptstadt und mit ihr dahin zu gelangen, wo Griechenland und die Länder des Orients bereits standen: bei der völligen sozialen Auflösung.
Wir haben gesehen, wie die athenische Volksfreiheit verfiel und die Republik reif wurde für den Uebergang zur Alleinherrschaft. Ebenso ging es auch in den anderen Demokratien, ebenso auch in Rom. In dieselbe Zeit, in die man die Geburt Christi setzt, fallen die letzten Zuckungen der römischen Republik und die Anfänge des Zäsarismus.
Die Aristokratie und die Demokratie zeigten sich damals in gleicher Weise bankerott. Der Kern des Volkes, die freie Bauernschaft, war im römischen Reich verkümmert, in vielen Gegenden völlig verschwunden, Größe und Ruhm des Staates erwuchsen aus dem Ruin des Bauern. Die ewigen Kriege, durch bäuerliche Milizheere geführt, brachten es dahin, daß die Wirthschaft des Bauern verkam, indeß die Wirthschaft des größeren Grundbesitzers, der mit Sklaven wirthschaftete, nicht litt. Im Gegentheil, gerade die Kriege lieferten ihm ungemein billiges Sklavenmaterial. Kein Wunder, daß die Sklavenwirthschaft rasch überhand nahm und die Wirthschaft der freien Bauern verdrängte. Wie Schnee vor der Sonne schmolz die freie, kräftige Bauernschaft dahin, zum Theil verkrüppelte sie, zum größten Theil aber versank sie ins Proletariat, das heißt ins Lumpenproletariat, denn eine Lohnarbeit, der sie sich hätte zuwenden können, bestand damals nicht in erheblichem Maße. In der Industrie wie in der Landwirthschaft herrschte die Sklavenarbeit. Die besitzlosen Bauern drängten in die Gro9städte, wo sie zusammen mit freigelassenen Sklaven die unterste Schicht der Bevölkerung bildeten.
Aber so lange noch die demokratische Republik bestand, bedeutete die Massenarmuth noch nicht das Massenelend. Die Massen besaßen, wenn nichts Anderes so doch die politische Macht, und sie wußten von dieser sehr wohl zu leben, sie in den mannigfachsten Formen zur Schöpfung der Reichen und der zinspflichtigen unterworfenen Gebiete auszunützen.
Nicht nur Brot und Spiele verschaffte ihnen ihre politische Macht, sondern mitunter auch die Zuwendung von Produktionsmitteln, von Grundeigenthum. Durch die letzten Jahrhunderte der römischen Republik ziehen sich ununterbrochen die Versuche hin, durch Vertheilung von Bauerngütern an Proletarier eine neue Bauernschaft zu gründen. Indessen alle diese Versuche, das Rad der ökonomischen Entwickelung zurückzudrehen, waren vergeblich. Sie scheiterten an der politischen und ökonomischen Uebermacht der Großgrundbesitzer, welche die Durchführung dieser Versuche hinderten, wo sie konnten und welche, wo es trotzdem gelang, freie Bauern zu schaffen, diese rasch wieder erdrückten und auskauften. Sie scheiterten aber auch an der Verkommenheit des Lumpenproletariats, das vielfach nicht mehr arbeiten wollte und es vorzog, sich in der Stadt zu amüsiren, statt auf dem Lande das dürftige, arbeits- und sorgenvolle Dasein eines Kleinbauern zu führen. Die Proletarier hinderten oft die Sozialreformen, die zu ihren Gunsten dienen sollten, dadurch, daß sie die ihnen zugewiesenen Güter ohne Weiteres wieder verschleuderten; sie hinderten sie aber auch oft dadurch, daß sie ihre politische Macht den reichen Großgrundbesitzern verkauften und sie gegen die Sozialreformer wendeten.
Die großartigsten dieser Versuche einer Sozialreform wurden veranlaßt und geleitet von den beiden Gracchen, Tiberius Sempronius Gracchus (geb. 163, von seinen aristokratischen Gegnern erschlagen 133 v. u. Z.) und dem entschiedeneren und weitergehenden Gajus Sempronius Gracchus (geb. 153), der das Werk seines älteren Bruders fortsetzte, aber so wie dieser der Wuth der Latifundienbesitzer erlag (121). Man hat die beiden Gracchen Kommunisten genannt, das waren sie jedoch in keiner Weise. Was sie anstrebten, war nicht eine Aufhebung des Privateigenthums, sondern die Schaffung neuer Eigenthümer, die Wiederherstellung einer kräftigen Bauernschaft, der festesten Grundlage des Privateigenthums.
Sie handelten darin ganz im Sinne der ökonomischen Verhältnisse ihrer Zeit. Wohl verdrängte damals nicht blos der Großgrundbesitz den Kleingrundbesitz, sondern vielfach auch der Großbetrieb den Kleinbetrieb. Aber dies war nicht die Folge der technischen und ökonomischen Ueberlegenheit des ersteren, sondern die Folge der enormen Billigkeit seiner Arbeitskräfte, der Sklaven.
Die ewigen Kriege brachten zahlreiche Kriegsgefangene als Sklaven auf den Markt. Gar mancher Krieg der Römer war blos durch das Bedürfniß der Großgrundbesitzer nach billigen Sklaven hervorgerufen, die reine Sklavenjagd.
Ungeheuere Sklavenmassen kamen zusammen; kein Wunder, daß ihre Preise ungemein sanken. Schon in Athen hatte die Sklaverei in Folge ähnlicher Verhältnisse sich stark entwickelt. Man zählte dort um das Jahr 300 v. u. Z. Neben 21.000 Bürgern 400.000 Sklaven. Von Aeschines wird es als Zeichen seiner besonderen Armuth erzählt, daß er blos sieben Sklaven besessen habe. Im römischen Weltreich wurde das Sklavenunwesen noch ärger. Der römische Feldherr Lucullus verkaufte (in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung) Kriegsgefangene, das Stück zu drei Mark (in unserem Gelde gerechnet), als Sklaven.
Jetzt wurde es rentabel, große Sklavenheerden zusammenzukaufen – reiche Römer besaßen tausende von Sklaven – und zusammen an die Arbeit zu setzen. An Stelle kleiner Betriebe errichtete man große Plantagen und, wie man sich ausdrückte, Fabriken. Diese Bezeichnung für die industriellen Großbetriebe der Griechen und Römer ist jedoch ungenau. Denn sie trugen einen ganz anderen Charakter, als die modernen Manufakturen und Fabriken, sie waren nicht, wie diese, den Kleinbetrieben überlegen. Den industriellen Großbetrieb mit Sklavenarbeit darf man nicht mit Fabriken vergleichen, sondern höchstens, wenn man eine moderne Erscheinung zum Vergleich heranziehen will, mit der Gefängnißarbeit. Niemand wird behaupten wollen, daß diese dem freien Handwerk gegenüber eine höhere Produktionsweise darstellt. Die Sklavenarbeit war, namentlich in der Landwirthschaft, so roh und unökonomisch als nur möglich ; der einzelne Sklave in diesen Großbetrieben leistete viel weniger, als ein freier Arbeiter in einem Kleinbetrieb. Wenn der Sklave im Großbetrieb trotzdem billiger produzirte, so nur deswegen, weil er selbst fast nichts kostete, und wegen der Billigkeit und Massenhaftigkeit des Sklavenmaterials auch nicht geschont und ausreichend genährt und bekleidet zu werden brauchte. Mochten sie verkommen, man fand genug andere an ihrer Stelle.
Man sieht, die Verdrängung des Kleinbetriebes durch den Großbetrieb im römischen Reich beruhte auf ganz anderen Bedingungen, als die heutige gleichartige Erscheinung. Die Vorbedingungen zu einer höheren Produktionsweise, als der Kleinbetrieb (im Ackerbau und auch im Handwerk) bedeutet, zu einer genossenschaftlichen Produktion, waren nicht gegeben. Wenn die Gracchen also als Vertreter der Interessen des Proletariats nichts weniger als Kommunisten waren, so entsprach dies vollständig den ökonomischen Verhältnissen, die sie vorfanden.
Was für die Gracchen gilt, kann auch von Catilina (geb. 108 v. u. Z.) gesagt werden, dem Führer einer Verschwörung gegen das römische Grundbesitzerregiment, der, nachdem alle anderen Versuche seiner Partei, die politische Macht zu erobern, gescheitert waren, mit seinen Genossen zu gewaltsamer Erhebung getrieben wurde und der Uebermacht seiner Gegner in heldenmüthigem Kampfe erlag (62 v. u. Z.). Auch ihn hat man zum Kommunisten gestempelt – Mommsen zum „Anarchisten“ – aber ohne jede Berechtigung. Ebensowenig wie bei den Gracchen handelte es sich bei Catilina um die Aufhebung des Privateigenthums, und die Einführung einer kommunistischen Gesellschaftsordnung. Er strebte die Eroberung der politischen Macht durch die Besitzlosen an, um diese zu Besitzenden zu machen.
Eine andere Richtung erhielt das Denken der Proletarier und ihrer Freunde, als das politische Leben abstarb, als die Besitzlosen moralisch und politisch ebenso verkommen waren wie die Besitzenden, die Demokratie ebenso haltlos wurde wie die Aristokratie und der Boden geebnet war für da Auftreten eines Alleinherrschers, eines Kaisers, des Herrn eines Söldnerheeres und der Anfänge einer Bureaukratie.