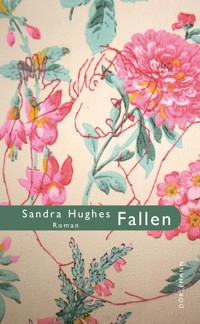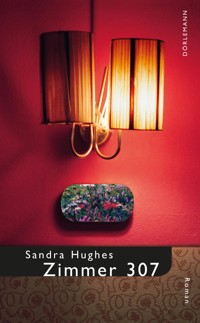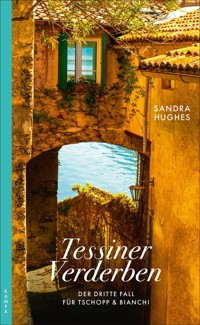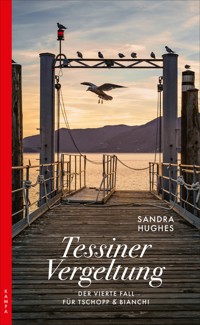Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Tschopp & Bianchi
- Sprache: Deutsch
Das Tessin gilt als Sonnenstube der Schweiz, aber der italienischsprachige Kanton hat mehr zu bieten als dieberühmten Touristendestinationen Lugano, Locarno und Ascona. Die Basler Polizistin Emma Tschopp erkundet mit ihrem Campingbus lieber die abgelegenen Täler. Zeit dafür hat sie: Dreiundzwanzig Urlaubstage muss sie im laufenden Jahr noch nehmen. Warum also nicht das Mendrisiotto besichtigen, das mit seinen sanften Hügeln an die Toskana erinnert. Meride ist das schönste Dorf im Tal, über dem der Monte San Giorgio thront, UNESCO-Weltkulturerbe und bekannt für seine prähistorischen Fossilien. Noch bekannter ist die dort ansässige Pastamanufaktur Savelli, die nicht weniger als die besten Spaghetti produziert und europaweit exportiert. Das Rezept ist streng geheim. Aber nicht nur das, wie sich bald herausstellt: Als der alte Savelli im Kühlraum der Manufaktur eine Leiche findet, kommen dunkle Familiengeheimnisse ans Licht. Emma Tschopp ermittelt, statt ihren Urlaub zu genießen. Ihr südländisches Temperament passt dabei so gar nicht zur Nüchternheit des eigentlich zuständigen Commissario Bianchi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandra Hughes
Tessiner Verwicklungen
Der erste Fall für Tschopp & Bianchi
Roman
Kampa
Teil 1
1
Ihre Finger zitterten nicht mehr, wenn sie die Webseite anklickte. Sie wusste, was kam. Diese fünf Menschen in Arbeitskleidung, deren Gesichter sie schon so viele Male studiert hatte.
»La famiglia di pastai«, stand unter dem Bild. »Antonio, Dante, Luigi, Alessia, Francesco.«
Sie hatte ihn sofort erkannt. Dieselben Furchen im Gesicht wie damals, nur tiefer. Die buschigen Brauen über den dunklen Augen. Sie erinnnerte sich auch wieder an seine Stimme. An den klammernden Griff seiner Hand, als er mit ihr im Auto davongefahren war. Sie fortbrachte an den Ort, wo man sie quälte. Wegen ihm hatte sie ein halb totes Leben geführt, darauf bedacht, die Schmerzen auszublenden und den Kopf über Wasser zu halten. Bis sie auf den Artikel in der Zeitung gestoßen war. Er rief alle Erinnerungen wach. Dazu kamen Wut und der Wunsch, nicht mehr halb tot leben zu müssen. Koste es, was es wolle.
2
Noch war es in Merides Gassen angenehm kühl. Ein paar Bewohnerinnen und Bewohner nutzten den Morgen für einen frühen Spaziergang. Sie humpelten am Stock die enge Hauptstraße entlang, hielten einen Schwatz auf der Piazza Mastri. Andere gingen zielstrebig ihrem Tagwerk nach, auch der alte Savelli. Wie immer war er der Erste, der die kleine Spaghettifabrik an der Via Ercole Doninelli 7 betrat. Sie lag neben seinem Haus am östlichen Ende des Dorfes. Von da an zogen sich Reben am sanften Hang entlang, führte die kunstvoll gepflasterte Straße zur Cappella del Beato Manfredo, die nach einem Adligen aus Mailand benannt war, der vor 800 Jahren hier auf dem Tessiner Berg gelebt hatte. Aber für selige Einsiedler hatte der alte Savelli keinen Blick. Er wollte, wie jeden Tag, »ein wenig nach dem Rechten sehen«, wie er sagte, das Rührwerk mit einem feuchten Lappen reinigen, danach den Teig ansetzen. Er richtete die Säcke mit Hartweizengrieß in einer Linie aus, setzte im engen Büroraum den Ventilator in Gang, damit die Hitze des Julitages gar nicht erst eindringen konnte. Ging die Gestelle im Trockenraum durch, die mit goldenen Spaghettischnüren behangen waren, wedelte sie sanft ein wenig durch. Wechselte in den Kühlraum hinüber. Er öffnete die Tür, betätigte den Lichtschalter, blinzelte, als es neongrell aufblitzte. Dann sah er sie, die Gestalt am Boden. Die Haare büschelweise auf den blanken Fliesen. Antonio schrie, so laut er konnte, mit seinen 82 Jahren und einer Lunge, die von zehn Brissago originale täglich geteert war.
Auch die Tochter des alten Savelli, Alessia Bernasconi-Savelli, war früh unterwegs. Sie keuchte die Via alla Campagna entlang, links plätscherte der Spinirolo vor sich hin. Heute hatte sie die Route im Tal gewählt, um ihre Knie zu schonen. Sie rannte mit glühenden Wangen. Das T-Shirt klebte an ihrem Rücken. Der Schornstein der ehemaligen Ölfabrik schob sich in ihr Blickfeld. Wenn er auftauchte, dauerte es noch fünf Minuten, dann hatte sie ihr morgendliches Laufpensum zur Hälfte hinter sich gebracht. Sie erreichte die Gebäude, die von Zäunen umgeben waren. »Ca.Stella« stand auf grün-weißen Tafeln geschrieben. Niemand in Meride wusste genau, was sich dahinter verbarg. Die einen sprachen von einem »Münchner Club«, der hier ein Aussteigerzentrum gründen wollte, so wie die deutschen Künstler und Esoteriker damals auf dem Monte Verità bei Locarno. Andere hatten eine Limousine mit Comer Kennzeichen beobachtet und hinter dunkel getönten Scheiben George Clooney erkannt, der sich nach einer sicheren Residenz im Mendrisiotto umsah. An diesem Morgen zeigten sich ein Esel und eine Ziege. Auf den Hund war Alessia gefasst, trotzdem erschrak sie jedes Mal, wenn sich das Tier kläffend gegen den Zaun warf. Ihr Herz raste. In fünf Minuten konnte sie zurück zu ihrem Haus rennen, dort die Tür mit Absicht laut zuschlagen, damit Francesco oben in seinem Zimmer aufwachte. Falls er überhaupt zu Hause war.
Sie presste die Zähne zusammen, blies zischend Luft aus. Es gab ihr jedes Mal einen Stich, wenn sie sich das Bild vor Augen rief: Francesco, ihr Ehemann seit zwölf Jahren, der allein in dem Zimmer lag, das einst das Kinderzimmer hätte werden sollen. Sie einsam im großen Ehebett. Drei Meter Korridor und zwei geschlossene Türen zwischen ihnen. Ihr Herz zog sich zusammen. Sie versuchte, tief Luft zu holen. Nicht langsamer werden. Kalorien verbrennen. Die Verzweiflung auspusten, die ihr die Kehle zuschnürte. Bei der Cappella Madonna di Loreto wendete sie und lief zurück Richtung Dorf. Schon von Weitem sah sie ihren Bruder. Er stand vor ihrem Haus und schlug wie ein Besessener mit der Faust gegen die Tür.
»Luigi?«
Er fuhr erst herum, als sie ihn an der Schulter fasste. Sein Gesicht war verzerrt.
»Sie ist tot!«
Sie ist tot. Mamma? Der Satz löste in Alessia eine Frage aus, die völlig absurd war. Ihre Mutter war vor vierzig Jahren gestorben, als sie selbst zwei Jahre alt war. Die Frau, die tot war, war für Alessia mamma. Immer schon. Aber jetzt war jemand anderes gestorben.
3
Ein paar Kilometer von Meride entfernt, auf einer Waldlichtung oberhalb des Dorfs Arzo, öffnete Emma ihre Augen. Sie lag im Dachzelt ihres gelben Campingbusses. Viel frische Luft, dünner Stoff nur, der sie vom Himmel und den Geräuschen des Laubmischwaldes trennte. Ihr Kopf schmerzte ein wenig. Karin hatte am Abend zuvor großzügig nachgeschenkt, während sie bis spät nachts Muster prüften: geometrische Anlagen, in sich verschlungene Ornamente, Motive aus Flora und Fauna. Ein Mosaik sollte künftig den Sitzplatz von Karins Rustico schmücken, und für Emma war klar: Da mussten Fische, Pfauen und Löwen hin, halbnackte Frauen und Männer mit Trauben und Weinkrügen. Karin hingegen verschloss sich allen Argumenten und bestand auf dem Labyrinth in Kreisform. Schwarz-weiß. Langweilig. Emma hatte kurz ihre spontane Entscheidung bereut, Karin zu besuchen, weil sie Mosaike-Legen so sehr liebte. Sich zusammen mit dieser Bekanntschaft aus einem Workshop die Knie wund scheuern, schwitzend Steinchen an Steinchen legen, im Minimum zwei mal zwei Meter groß: Wer wollte heiße Sommertage so verbringen? Sie. Emma Tschopp, einundfünfzig, alleinstehend und kinderlos, Ermittlerin bei der Polizei Basel-Landschaft mit dreiundzwanzig Tagen Ferienguthaben, die sie noch dieses Jahr nehmen musste. Emma seufzte und schloss die Augen. Sie sollte noch ein wenig schlafen, bevor es heiß wurde.
Rubio schlief unten im Bus. Emma richtete ihm jeden Abend das Lager für zwei Personen ein. Ein Mal nur war sie in ihrem Dachzelt in tiefen Schlaf gesunken, ohne für ihn den Rücksitz zum Kingsize-Bett umzubauen. Rubios Rache war Scheiße, anders war es nicht zu nennen. Emma hatte den Bus mit viel Shampoo gereinigt, bis er wieder so gut roch wie damals, als sie ihn gebraucht gekauft hatte.
Der Labrador zog es vor, auf seiner Decke im Arisdorfer Bauernhaus zu schlafen. Die Decke hatte ein paar Löcher, in denen er sich manchmal verhedderte, aber sie roch nach Zuhause. Dort wusste Rubio, was ihn erwartete. Emma, die ihm die Tür öffnete, wenn er von seinem Rundgang durch die benachbarte Hofstatt zurückkehrte oder aus dem Wäldchen weiter oben. Vertraute Wege auch zu zweit, manchmal ein Ausflug nach Basel, wenn Emmas Dienstplan es zuließ. Wartestunden auf der Decke, faul verdöst, und Freude, wenn sich der Schlüssel im Schloss drehte. Alles viel besser als dieser Bus. Ein unstetes Ding, das ihn an Orte führte, die er nicht kannte, und ihm Nächte fern der warmen Küche aufzwang. Elsässische Wildschweine, die ihn aufschreckten. Baselbieter Bauern, die mitten in der Nacht an die Windschutzscheibe klopften, weil Emma es nicht lassen konnte, frei zu campen. Rubio vermochte keinen zu vertreiben. Emma musste jeweils vom Dach klettern und die Situation klären, mit ihrer Stimme, die so lieb klingen konnte und so streng. Von Emma selbst hatte Rubio kein Bild. Er konnte ihre violette Trainingsjacke nicht sehen, die sie seit Jahren begleitete, die braunen Locken mit Silberfäden, nie in Form gebracht, das runde Gesicht mit den vielen Fältchen um die Augen. Ein weicher Körper, der davon erzählte, was Emma gern mochte: Pasta und Rotwein, Entrecôte mit Kräuterbutter, viel französische Sauce am Salat, Pommes Allumettes, Würste weiß oder pikant, Blauschimmelkäse. Alles in edle Fettpölsterchen verwandelt, besonders am Bauch und an den Hüften, etwas unbeholfen mit Kleidung kaschiert. Das kümmerte Rubio nicht. Er umrundete auch gelassen die Bücherberge und schmutzigen Kaffeetassen im Wohnzimmer. Emma roch fein, das reichte. Und zwar überall, von innen her. Alles an ihr war Weide und Wild, in tausend Nuancen stieg sie ihm in die Nase, durch und durch gut.
4
»Zurücktreten!«, rief der junge Polizist und versuchte, das Absperrband vor der Fabrik neu zu spannen. Sein Kollege fuchtelte mit den Armen, zwang die Bewohnerinnen und Bewohner von Meride ein paar Schritte rückwärts. Von Haus zu Haus war die Nachricht gegangen, von der Via Ercole Doninelli in die Via Bernardo Peyer und von da in die verzweigten Gässchen hangauf- und hangabwärts.
»Un morto«, wurde von Mund zu Mund gewispert, »assassinato.«
In der fabbrica, bei der famiglia Savelli. Savelli? Ja, der Alte hatte alles entdeckt. Rote Spaghettischnüre in der Trockenmaschine? Blut in der Pasta? Männer und Frauen rissen die Augen auf, schlugen die Hände vor den Mund. Ja, dazu eine Blutlache, die sich unter der Tür des Trockenraumes hindurch bis zum Rührwerk ausbreiten konnte. Dann wurde die Leiche gar nicht im Büro gefunden, mit zertrümmertem Schädel? No! Und die Leiche war kein Mann, sondern eine Frau?
In der Bottega Bar l’Incontro gingen Gerüchte und Espressi über die Theke. Erste Neugierige brachen in die Via Ercole Doninelli auf. Es folgten alle, die nicht zur Arbeit den Hang des Monte San Giorgio hinunterfahren mussten, nach Riva San Vitale oder weiter in den Süden bis nach Chiasso. Sie bildeten eine nervöse Gruppe vor der Fabrik.
»Eine Hand?«, kreischte Valeria, Kassenfrau im Fossilienmuseum Monte San Giorgio, das erst um neun öffnete.
Ja, eine Hand. Im Rührwerk war sie aufgetaucht. Abgehackt. Schreckgeweitete Blicke, unterdrückte Schreie. Wessen Hand? Della Zücchina?
»Sì, la Zücchina!«
Kreuze wurden geschlagen, Gebete gemurmelt in vielstimmigem Chor:
»Herr über Meride, gib dem alten Savelli die Kraft, dieses teuflische Verbrechen zu überstehen.«
Mit geneigten Köpfen stand die Gruppe da, tonlos stiegen ihre Worte zu dem hoch, den sie da oben vermuteten:
»Herr über Meride, wir danken Dir für die Ereignisse, die Du uns bescherst. Sie machen unsere langweiligen Tage reich und unsere Herzen froh. Denn nichts stärkt uns mehr, als wenn der Nachbar vom Leid getroffen kriecht und wir weiterhin aufrecht gehen können. Und lass, lieber Gott, unsere kleine Fabrik mit der besten Pasta der Welt weiterhin gedeihen, zum Wohle der Bevölkerung von Meride, der guten, Dir treu ergebenen. Grazie tanto. Amen.«
In der Fabrik saß Luigi Savelli, zweiter Sohn des alten Savelli und Geschäftsführer des Familienbetriebs, mit Commissario Bianchi zusammen und deutete auf die Weltkarte an der Wand. Sie war mit roten, grünen und weißen Stecknadeln versehen.
»Die Karte ist der ganze Stolz meines Vaters. Hier startete sein Großvater.« Luigi tippte auf eine rote Nadel. »Meride Paese. Er wurde Hoflieferant vom Wuppertaler Bankier Eduard von der Heydt, der sich ein Hotel auf dem Monte Verità bauen ließ. Hier.« Er tippte die grünen und weißen Nadeln an. »Sein Vater holte das Grand Hotel Villa Castagnola, das Hotel Giardino, das Eden Roc und die Villa Principe Leopoldo hinzu. Jetzt beliefern wir ausgewählte Delikatessläden in Zürich, Basel, Mailand, Rom und München. Ohne die regionale Kundschaft verloren zu haben.«
Sie saßen im Packraum, in dem die Pasta in Tüten zu je einem Kilogramm abgefüllt wurde. Wochentags ab sieben Uhr dreißig – wenn keine Leiche im Kühlraum lag. Die Spurensicherung hatte einen Teil des Raums freigegeben. Für Commissario Bianchi hatte Luigi den speckigen Drehstuhl aus dem winzigen Büro gerollt, für sich eine Kiste platziert.
Er beobachtete den Commissario, während er die Firmengeschichte darlegte. Was für ein Geck dieser Polizist war, mit seinem langen Haar, das ihm glänzend am Kopf klebte. Er hielt das Gesicht meist auf seine Notizen gesenkt, nur seine Hakennase ragte hervor. Schlanke Finger. Ein zerfranstes Band ums Handgelenk, ein Glücksbringer wohl, unpassend. Die Ärmel des weißen Hemdes hochgekrempelt. Bügelfalten in der Anzughose. Das Notizbuch auf den Knien, in Leder gebunden. Dauernd hatte ihn der Commissario unterbrochen, um sich Notizen zu machen, obwohl seine Aussage auch von dem Gerät aufgezeichnet wurde, das zwischen ihnen lag. Luigi musste sich wiederholen. Ja, er hatte einen Schrei gehört, beim Kaffeetrinken. Die genaue Uhrzeit wusste er nicht. Nach 6:15 Uhr, weil Luigi ab dann Kaffee trank, und vor 6:45 Uhr, dann hörte er den Wirtschaftsbericht im Radio. Ob er Familie hatte? Nein, hatte er nicht. Seine Frau war weg. Keine Pasta mehr, die sie in Tüten füllen musste.
»Nicht mit mir!«, hatte sie geschrien und ihn angespuckt, als er sie festhalten wollte.
Aber das sagte Luigi dem Commissario nicht. Er sagte etwas über die einmalige Verbindung von süditalienischer Kochkunst und Schweizer Qualitätsarbeit, die die Savelli-Pasta auszeichnete. Wie ihr Traditions- und Familienbewusstsein bewirkte, dass Savelli-Pasta regional und ohne endlosen Wachstumsanspruch produziert wurde, immer schon, nicht bloß dem aktuellen Nachhaltigkeitshype geschuldet. Er legte dar, wie die gemeinsame Arbeit den Zusammenhalt zwischen ihm und seinen Geschwistern Alessia und Dante stärkte. Aber da unterbrach der Commissario schon wieder.
Nein, die Stimme und Herkunft des Schreis hatte Luigi nicht identifiziert. Er war die Treppe seines kleinen Hauses schräg gegenüber der Fabrik hinuntergerannt, hatte die Tür aufgerissen, gehorcht. Es war wieder still gewesen. Er hatte sich das alles wohl eingebildet. Trotzdem ging er zur Fabrik. Warum? Er wusste es nicht. Ein Gefühl. Das Tor zur Fabrik war nicht verschlossen. Das war jeden Tag so, weil sein Vater frühmorgens schon dort war. Luigi ging durch den Packraum, das Licht war an, der Ventilator im Büro lief bereits. Weiter durch den Korridor Richtung Produktionsraum, er hörte ein unbekanntes Geräusch, wie von einem Tier.
»Papà!«, rief er.
Keine Antwort.
»Papà?«
Wieder das Geräusch, er betrat den Produktionsraum. Dort kauerte der Vater auf den Knien, schlug den Kopf auf den Boden. Luigi rannte zu ihm, wollte ihn aufrichten. Der Vater begann zu schreien, zeigte nach hinten, zum Kühlraum. Er hatte Atemnot. Luigi umfasste ihn, zog ihn hoch, wollte ihn auf einen Stuhl setzen. Aber es gab keinen. Der Vater wollte keine Stühle in der Fabrik.
»Arbeiten, nicht faulenzen«, hatte er immer gesagt, als sie Kinder waren, und selbst als Erwachsene hatte er sie angeherrscht:
»Hier wird nicht rumgesessen.«
Also ließ Luigi den Vater auf dem Boden sitzen, an die Trockenmaschine gelehnt, und ging zum Kühlraum, auf den sein Vater wies.
Hier unterbrach sich Luigi. Der Commissario hatte den Kopf schief gelegt und sah ihn an, ohne zu schreiben. Eine weiße Stecknadel löste sich aus der Karte. Es war so still, dass man das leise Pling hörte, als sie zu Boden fiel.
Luigi hatte die Tür zum Kühlraum geöffnet. Er sah sie erst, als er einen Schritt in den Raum machte. Sie lag links von der Tür, weiter hinten, auf dem Rücken. Die blauen Beine. Ihr grünes Kleid. Haare. Eine Schere.
»Und?«
Die Stimme des Commissario, Luigi zuckte zusammen.
»Was und?«
»Was ging Ihnen durch den Kopf?«
»Nichts. Ich rannte zurück zu meinem Vater. Er kriegte keine Luft mehr.«
Die dunklen Augen von Bianchi fixierten ihn, aber Luigi hielt dem Blick stand.
5
Alessias Kopf schmerzte. Die Augen brannten vom Weinen und den rauen Taschentüchern. Sie sah den Mann gegenüber nicht mehr ganz deutlich. Als Commissario Marco Bianchi vom Commissariato Lugano hatte er sich vorgestellt. Ihr schien, als würde sie seine Fragen schon zum zweiten oder dritten Mal beantworten. Sie versuchte, sich auf seine Worte zu konzentrieren.
»Der Notruf ging um 7:06 Uhr ein, von Ihrem Mobiltelefon, Signora Bernasconi. Um cirka 6:35 Uhr, spätestens 6:40 Uhr waren Sie gemäß Ihren Angaben vom Joggen zurück und trafen auf Ihren Bruder. Zwischen Ihrem Blick in den Kühlraum und der Benachrichtigung der Polizei sind also mindestens 26 Minuten vergangen. Was ist in dieser Zeit passiert?«
Wieder sah sie Luigi vor sich, wie er vor ihrer Haustür gestanden hatte. Er hatte sie am Arm gepackt und geschüttelt.
»Wo seid ihr denn, verdammt?«, hatte er gezischt. »Wo ist Francesco?«
»Er schläft wohl. Was soll das?«
Sie hatte vergeblich versucht, sich zu befreien. Er zwang sie, mit ihm zur Fabrik zu gehen.
»Lüg mich nicht an. Francesco ist nicht da.«
Er hatte sie durch die Tür in den Packraum der fabbrica gestoßen, durch den Korridor zur Produktion geschoben. Papà saß dort am Boden, weiß im Gesicht, auf der Stirn eine Platzwunde. Sie wollte sich zu ihrem Vater beugen, aber Luigi zerrte sie weiter zum Kühlraum hin, riss die Tür auf, schob sie hinein.
»Da. Schau hin.«
Etwas Bitteres kam ihr hoch. Sie schluckte es hinunter. Luigi ließ sie los, sie konnte sich abwenden, zurück in den Produktionsraum wanken.
»Wer tut so etwas?!«
Luigis verzweifelter Schrei hatte in ihren Ohren gedröhnt. Sie versuchte, einen Fuß vor den anderen zu setzen, fort von diesem Kühlraum. Eine Art Krächzen ließ beide zu ihrem Vater schauen. Er war zur Seite gekippt und bewegte die Lippen, ohne dass sie verstanden, was er ihnen sagen wollte.
»Ich rufe jetzt die Polizei«, hatte Luigi gesagt, wieder gefasst.
Da war sie aus ihrer Starre erwacht.
»Warte! Lass mich das machen.«
Sie war gerannt, zurück zu sich nach Hause, direkt nebenan.
»Signora Bernasconi?«
Sie zuckte zusammen.
»Ich habe Sie etwas gefragt.«
Der Commissario sah sie an. Der Schmerz in ihrem Kopf wurde immer stärker.
»Ich … ich kam gerade vom Joggen. Dann war da Luigi und hat sie mir gezeigt … Es … es war ein Schock.«
»Signora Bernasconi. Warum hat ihr Bruder nicht sofort die Polizei gerufen?«
»Ich … Keine Ahnung. Wir waren so durcheinander.«
Sie musste wieder weinen. In ihrem Kopf hämmerte es.
6
Emma wischte sich den Schweiß von der Stirn. Der künftige Sitzplatz von Karins Rustico lag zwar im Schatten von Hopfenbuchen und Eichen, aber heiß war es trotzdem. Sie erhob sich, streckte den schmerzenden Rücken durch. Sah sich um, wieder erstaunt darüber, dass es solch stille Orte fernab von allem noch gab, samt Zufahrt bis zum Haus. Emma war den Schildern bis »La Perfetta« gefolgt, einem Betonklotz, der sich als Schul- und Ferienzentrum erwies, das einem Gefängnis gleich auf einer Anhöhe über Arzo lag, und von da aus über einen halb verwachsenen Waldweg geholpert, im Zweifel darüber, hier je irgendeine Spur menschlichen Lebens zu finden. Aber dann kam sie, die kleine Lichtung.
Karin hatte sie entdeckt, als sie ihren Traum vom Rustico im Tessin verwirklichen wollte. Als Ferienhaus zunächst, aber schon damals mit dem Wunsch, im Sommer und Herbst dort wohnen zu können. Wochenende für Wochenende war sie mit dem Auto auf der Suche gewesen, vor allem im Mendrisiotto, ganz im Süden des Tessin. Die horrenden Preise von Anbietern im Internet überstiegen ihre finanziellen Möglichkeiten. Aber den damals halb verfallenen Stall hatte sie erwerben können. Das war vor fünf Jahren gewesen. Nach und nach hatte Karin ihn in ein bewohnbares Häuschen umgebaut. Ohne weinüberrankte Pergola und Schiefertisch, ohne Blick in die Ferne, dafür mit Waldschatten, offener Feuerstelle und Mosaiken.
»Du fährst in die Sonnenstube der Schweiz?«, hatte Emmas Kollege Alex gespottet, als sie letzte Woche beim Pausenkaffee saßen. »Zu den deutschen Pensionären? Kampierst zwischen ihren fetten Eigentumswohnungen und Villen?«
Er hatte über die dreitausend Deutschen gelästert, die für immer dort lebten, in Ascona nach einem »Eis« statt nach gelato verlangten, »Tschianti« tranken und sich im Paradies breitmachten.
»Die haben es gut«, hatte Emma gesagt. »Du wirst es dir nie leisten können, in einer Villa mit Blick auf den Lago Maggiore zu wohnen. Mit deiner Pension. Nicht mal am Schattenhang über dem Vierwaldstättersee.«
Alex’ wütender Blick befeuerte sie.
»Zudem gibt es im Tessin auch Deutsche, die arbeiten, als Koch oder Yogalehrer. Oder Professorin. Und: Kann man das Paradies nicht einfach teilen? Auch wenn man Alex heißt und dauernd findet, einem werde etwas weggenommen?«
Der Kollege hatte nichts mehr gesagt. Emma musste grinsen, als sie sich an ihr Gespräch erinnerte.
»Sonnenstube der Schweiz«, murmelte sie und schaute sich wieder auf der wilden Waldlichtung um. »So ein Blödsinn.«
Ihr Magen knurrte. Seit dem Frühstück hatten Karin und sie pausenlos gearbeitet. Sie hatten Karins Skizze auf den Untergrund übertragen, und Emma hatte die Flächen markiert. Schwarz und weiß. Viele Variationen gab es nicht bei diesem Motiv. Sie ließen alles gut trocknen. Danach hatte Emma den Einbettungsmörtel vom Zentrum des Bildes her aufgetragen. Immer nur so viel, dass Karin die Mosaiksteine eindrücken konnte, bevor er aushärtete. Fasziniert hatte sie zugesehen, wie schnell und präzis Karin die kubischen Steinchen setzte, wie bestimmt sie anschließend das Brett auf die Fläche presste, um die Teilchen flach auszurichten. Wenn sie selbst an der Reihe war, dauerte das alles länger. Karin hatte die Mörtelflächen verkleinert und Emma zugelächelt. Sie schien sich von der Überraschung, dass Emma sich kurzfristig als Gast angekündigt hatte, erholt zu haben. Das gemeinsame Arbeiten war angenehm. Sie dienten einander zu, ohne viele Worte, wie im Workshop vor einem Jahr, als sie sich kennengelernt hatten. In der Mittagspause damals hatte Karin allein draußen auf dem Rasen gesessen, alle anderen waren gemeinsam ins Restaurant aufgebrochen. Emma hatte zwei Klappstühle aus ihrem Bus geholt, sie hatten beide Salat aus ihren Lunchboxen gegessen, sich über Mosaikkurse und die Pläne, die Karin für ihr Rustico hatte, unterhalten.
»Komm doch vorbei«, hatte Karin gesagt. »Wenn du mal in der Gegend bist!«
Das ließ Emma sich nicht zwei Mal sagen.
»Non è possibile!«, hörte sie nun Karin im Haus rufen.
Offenbar gab es einiges zu besprechen. Karins Handy hatte geklingelt, und nun war sie schon seit Längerem verschwunden. Emma ging zur Liege, die neben einem Tisch und zwei Stühlen halb im Wald stand. Sie trank Wasser, nahm sich eine Tomate aus der Schale, ließ sich auf die Liege fallen. Rubio war schon da. Er erhob sich, legte seinen warmen, schweren Kopf auf ihre Beine. Emma kraulte ihn. Er stupste sie, wenn sie aufhörte, das immer gleiche Spiel. Sie schreckten beide auf, als Karins Stimme über ihnen ertönte.
»Stefanie wurde ermordet!«
Emma sprang so schnell hoch, dass ihr kurz schummrig wurde.
»Stefanie? Die Stefanie von der Führung?«
»Ja, sie.«
»Wer sagt das? Mit wem hast du telefoniert?«
»Mit Valeria. Einer Bekannten aus Meride.«
Karin unterdrückte ein Schluchzen. Emma legte ihr den Arm um die Schultern. Ihre Gedanken rasten. Stefanie Schwendener. Die junge Frau, die sie am Tag zuvor durch die Spaghettifabrik geführt hatte, ermordet?
»Wie ungerecht«, murmelte Emma.
Das war immer ihr erster Gedanke. Schon als Kind fand sie vieles ungerecht. Dabei hätte sie wegschauen können, wie alle anderen. Was musste es sie kümmern, wenn eine Klassenkameradin verprügelt wurde? Die war selbst schuld, hatte ihr loses Maul zu weit aufgerissen, Gift versprüht gegen die Bande von Jungs. Andererseits war sie so ein zartes blondes Wesen. War es gerecht, wenn sich vier brüllende Kerle auf sie stürzten? Nein. Also warf Emma sich dazwischen. Und was hatte sie damit zu tun, dass der Klassenbeste einer mit Brille, abstehenden Ohren und Sommersprossen war? Nichts. War es gerecht, dass niemand mit ihm sprach? Dass sich alle mit einem Schulterzucken abwandten, wenn er das Wort an sie richtete? Emma hörte ihm zu, auch dann noch, wenn sich der Pausenhof längst geleert hatte. Als Emma verkündete, dass sie später einmal Kriminalkommissarin werden wollte, um die Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen, hatte ihr Vater gelacht. So auch Fräulein Huber, die Grundschullehrerin, bei der sie ihre Berufswünsche zeichnen mussten. Emma hatte sich eine Polizeimütze auf die wilden Locken gesetzt, eine Pistole in jeder Hand, von klobigen Fingern umfasst. Sie war bereit, das Böse zur Strecke zu bringen. Sollten die lachen, so viel sie wollten.
Seit einer Weile schon ging Emma hin und her, von Rubio schwanzwedelnd begleitet. In ihrem Hirn ratterten die Gedanken. Es gab nichts, was sie dagegen tun konnte. Einmal Ermittlerin, immer Ermittlerin, auch in den Ferien.
»Warum tötet jemand eine nette, hübsche Kindergärtnerin aus Oberwil, die nebenberuflich als Reiseleiterin im Mendrisiotto arbeitet?«
Karin reagierte nicht. Sie saß mit blassem Gesicht am Tisch und nippte an dem Wasserglas, das Emma ihr gereicht hatte.
»Wo wohnte sie?«, fragte Emma.
»Am Dorfeingang.«
»Bei der Spaghettifabrik?«
»Nein. Am anderen Ende. Dort, wo das Postauto hält. In dem kleinen Eckhaus mit der schönen Steinfassade.«
Emma wusste nicht, welches Eckhaus. Schöne Steinfassaden gab es hier einige, aber die Haltestelle hatte sie gesehen, »Meride Paese«. Eine Gruppe von rotgesichtigen Deutschschweizern hatte auf der Bank gesessen, die karierten Hemden nass geschwitzt, die Sprüche lahm nach einem oder zwei Bier.
»Zur Miete?«
»Ja. Das Haus gehört den Peverellis.«
»Warst du mal bei ihr?«
Karin schüttelte den Kopf.
»Wie gut kanntest du Stefanie?«
»Sie hat mir ein bisschen geholfen«, sagte Karin und deutete auf das Haus. »Auch mit dem Mosaik bei der Tür.«
Sie verbarg das Gesicht in den Händen. Emma setzte sich neben sie, legte einen Arm um sie.
»Wann war das?«
»Im April.«
»Komm, trink mehr Wasser«, sagte Emma, schenkte nach und schob das Glas sanft gegen Karins Arm. Sie drückte Karin erneut und erhob sich.
»Später erzählst du mir alles, was du über Stefanie weißt.«
Emma versuchte, ihre Erinnerung an die Führung in der Fabrik nochmals durchzugehen. Karin hatte den Ausflug vorgeschlagen und sie angemeldet. Montag, elf Uhr, wenn die Tour durch die Spaghettifabrik Savelli in deutscher Sprache angeboten wurde.
»Italienisch geht auch«, hatte Emma gesagt. »Eigentlich lieber auf Italienisch.«