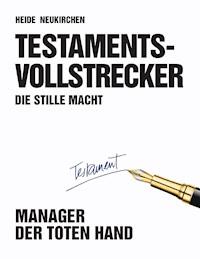
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Es ist die Zeit der Erben. 3,1 Billionen Euro werden im Zehnjahreszeitraum von 2015 bis 2024 in Deutschland vererbt. Circa 210 Milliarden Euro davon gehen jedes Jahr von einer Generation auf die nächste über. Es ist auch die Zeit der Testamentsvollstrecker. Besorgte Eltern, vor allem aber Besitzer umfangreicher Vermögen – vom mittelständischen Unternehmen über einen opulenten Immobilienbesitz bis zur teuren Kunstsammlung – übergeben ihr Erbe einem Nachlassverwalter. Dieser Vertraute über den Tod hinaus kann erheblichen, bisweilen verhängnisvollen Einfluss ausüben. Die Folge sind oft jahrelange Streitigkeiten, die erst vor Gericht enden. Das Buch bringt Licht in das Dunkel dieser im Verborgenen tätigen Vollstrecker. Es soll Erblassern und Erben als Ratgeber bei der Auswahl eines seriösen Vermögens-Sachwalters dienen. Die Autorin schreibt nicht nur über große Mandate oder bekannten Namen wie Hohenzollern, Mast/Jägermeister, Schickedanz und Tönnies. Ihr Anliegen sind auch die Erbfälle, die im familiären Umfeld mit Hilfe eines Testamentsvollstreckers gelöst werden sollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
// INHALT
Vorwort
Roman und Realität
Wo finde ich meinen Testamentsvollstrecker?
Die andere Seite
Im Würgegriff der toten Hand
Nächstenliebe in Klammern
Spiel mir das Lied vom Geld
Stinkstiefel Erben
Das Unternehmertestament
Ein bayerisches Lehrstück
Kunstgriffe
Schärfere Gesetze, ja oder nein?
Schlussbemerkung
Glossar
Literatur- und Sachverzeichnis
// VORWORT
Die Fähigkeit, große und weniger große Nachlässe als Testamentsvollstrecker zu managen, trauen sich viele Menschen zu. Was reizt? „Das Geld“, meinen die Erben, welche die Rechnung bezahlen müssen. Ohne Geld würde den Job keiner machen. „Es ist die Macht“, meint der Münchner Publizist Hans-Kaspar von Schönfels. Freundlicher formuliert: Es ist der Gestaltungswille.
Folgt man der Statistik, sind die Nachlass-Manager eine kleine Minderheit. Jeder dritte volljährige Deutsche errichtet ein Testament. Nur zwei Prozent treffen in ihrem Letzten Willen eine Personalentscheidung für eine Fremdverwaltung des Erbes. Das Resultat sind 10.000 Testamentsvollstreckungen im Jahr.
Solche Angaben werden der großen Bedeutung dieser Dienstleistung nicht gerecht. Bei umfangreichen Vermögen, zumal wenn eine Firma dazugehört, sind Testamentsvollstrecker das Mittel der Wahl. Ihr Einfluss wird weiter steigen. Die größte Erbschaftswelle der Geschichte steht bevor. Nach Schätzungen des Instituts für Altersvorsorge werden in Deutschland 3,1 Billionen Euro in diesem Jahrzehnt an Erben weitergegeben. Das sind unglaubliche 310 Milliarden Euro pro Jahr. Auf den Generationenübergang entfallen 210 Milliarden Euro – so viel Geld wie noch nie. Auch bei der Übergabe von Firmen an die nächste Generation rechnet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag mit Rekordzahlen.
Testamentsvollstreckungen haben viele Facetten. Sind sie nur für eine kurze Periode vorgesehen, heißen sie Abwicklungsvollstreckung oder Abwicklungstestamentsvollstreckung. Das ist die konfliktfreiere Variante. Allerdings können die mustergültigsten Vorkehrungen ein Restrisiko irrational reagierender Menschen nicht ausschließen. In der Abwicklungstestamentsvollstreckung Mast/Jägermeister treten eine Witwe, drei Brüder und eine Testamentsvollstreckerin in rund einem Dutzend Gerichtsverfahren gegeneinander an.
„Dauertestamentsvollstreckungen“ werden für einen Zeitraum bis zu 30 Jahren angeordnet, was häufig einer Entmündigung der Erben gleichkommt. Beispiele sind der Krupp Konzern, das Verlagshaus Axel Springer und das Göttinger Unternehmen Sartorius. Mit geschickten Formulierungen kann sich eine Fremdverwaltung sogar über ein Jahrhundert hinziehen. Dafür steht das Haus Hohenzollern. Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) dauert die Testamentsvollstreckung bis zum Tod eines 1948 geborenen Nachkommen des letzten Kaisers. Die Streitlust der Erben steigt nach allen Erfahrungen analog zu den Jahren. Beim Kammergericht Berlin haben die Juristen des Adelsgeschlechts eine Dauerkarte.
Hohenzollern, Krupp, Mast/Jägermeister, Springer: Das sind große Mandate und bekannte Namen. Die Mehrzahl der anonym bleibenden Testamentsvollstrecker erfüllt die vorgegebenen Aufgaben geräuschlos, friedlich und für alle Beteiligten zufriedenstellend. Häufig übernimmt ein Familienmitglied das Amt, zahlt die Erbschaftsteuer, verkauft die Eigentumswohnung und verteilt den Erlös aus der Immobilie plus Silberbesteck plus Bilder und Bücher an die Erben und Vermächtnisnehmer. Und alle sind mit der Abwicklung zufrieden. Warum schreibe ich kein Buch über diese namenlosen Heldinnen und Helden der Vermächtnis- und Vermögensverteilung? Es ist dieselbe Entscheidung, wie sie Zeitungs- und Fernsehredakteure täglich treffen. Schlagzeilen macht nicht das Gewöhnliche, sondern das Außergewöhnliche. Bad news are good news, weiß der Brite. Der Tatort wäre keine Lieblingssendung der Deutschen, wenn sich die Schauspieler nur für gute Taten und vor Ort auf den Weg machten.
Die folgenden Seiten sind nicht von Juristen für Juristen geschrieben. Es sind Nahaufnahmen von Alphatieren, Durchsetzern, Rationalisten, Arbeitsbienen, Helfern, Beschützern und Betrügern. Es menschelt auf jeder Seite. Ich bin überzeugt von der einprägsamen Wirkung realen Geschehens. Soweit es mir möglich war, habe ich Namen genannt. Leider musste ich bei einigen Beispielen den Ort und die Personendaten weglassen. Die Fälle sind trotzdem spannend.
Die Lektüre von erlebten Geschichten entspricht auch einer Empfehlung des einflussreichen englischen Wirtschaftsmagazins THE ECONOMIST. Der Rat der Redaktion lautet: Entscheider sollten weniger Berichte und Analysen lesen, dafür mehr Romane. Schlechte Zahlen ließen sich leichter korrigieren als falsche Personenentscheidungen. Dieses Buch liefert die Anregungen. Es ist erstaunlich, wie häufig vermeidbare Torheiten bei einer so wichtigen Angelegenheit wie dem Vererben und dem Erben gemacht werden.
Ein Garantieschein für posthumen Frieden, vor allem bei Patchworkfamilien, komplizierten gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen oder Stiftungen, sind Testamentsvollstreckungen nicht. Häufig heilt nur die Zeit. Martine Dornier-Tiefenthaler, die bekannteste deutsche Testamentsvollstreckerin, äußert in einem ausführlichen Gespräch ihre Meinung zu Streit und Versöhnung. Eines fernen Tages, so ihre Erfahrung, werde auch in erbittert verfeindeten Dynastien die Vernunft die Oberhand gewinnen.
Ein Glück für jede Firma und Familie, wenn sie bis zum Friedensschluss nicht kaputt gestritten wurden.
// ROMAN UND REALITÄT
„Das dürfte der letzte Tag sein, und wohl auch die letzte Stunde … Ich bin für das Jenseits bereit. Dort kann es nur besser sein als hier. Mein Vermögen beläuft sich auf mehr als elf Milliarden Dollar. Früher einmal besaß ich alles an Spielzeug, was das Leben schöner macht: Jachten, Privatjets, Blondinen, Wohnsitze in Europa, große Güter in Argentinien, eine Insel im Pazifik, reinrassige Rennpferde, Vollblüter, und sogar eine Eishockeymannschaft. Aber ich bin inzwischen zu alt für Spielzeug … Die Wurzel meines Elends ist das Geld. Meine drei Ehefrauen haben mir sieben Kinder geboren, von denen sechs noch leben und tun, was sie nur können, um mich zu quälen. Sie alle sind heute hier zusammengekommen, weil ich bald sterben werde und es an der Zeit ist, das Geld zu verteilen. Wer kurz vor dem Sterben steht, sollte nicht hassen, aber ich kann es nicht ändern. Sie sind ein elender Haufen, alle miteinander. Die Mütter hassen mich und haben daher ihren Kindern beigebracht, daß sie mich ebenfalls hassen sollen. Sie sind Geier, die mit scharfen Krallen, spitzen Schnäbeln und gierigen Augen über mir kreisen, benommen von der Vorfreude auf unendlich viel Geld … Ein Testament, das ich vor zwei Jahren verfaßt habe, sah als Universalerbin meine letzte Gespielin vor. Sie ist aber später ausgezogen, und das Testament ist in den Reißwolf gewandert. Ich habe meinen eigenen Reißwolf, in den ich all die früheren Testamente gesteckt habe.“
ABGESTRAFT
So eröffnet der lebensmüde Exzentriker Troy Phelan mit einem vor Selbstmitleid triefenden Selbstgespräch (hier gekürzt) den Erbschaftsthriller DAS TESTAMENT des US-amerikanischen Autors und Strafverteidigers John Grisham. Und das ist die Situation: Der Milliardär hat seine Erben zusammengetrommelt, um in ihrer Gegenwart sein definitiv letztes Testament zu unterschreiben. Mehrere Kameras zeichnen die Zeremonie auf. Neben den drei Exfrauen mit ihren sechs Kindern ist ein Dutzend Anwälte im Raum versammelt. Die Juristen wachen darüber, dass ihre Mandantinnen ausreichend bedacht werden. Der 78-jährige Phelan hat zusätzlich eine Handvoll Psychiater eingeladen. Sie sollen ihm vor dieser Öffentlichkeit bescheinigen, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte zu sein. Sein Plan geht auf. Die Experten machen mit ihm einige Tests, um sein Erinnerungsvermögen und seine Schlagfertigkeit zu prüfen. Anschließend bezeugen sie einstimmig Phelans uneingeschränkte Testierfähigkeit.
Danach ist der Milliardär bereit, das ihm vorgelegte Dokument zu unterzeichnen. Die Mühe, zuvor 90 Seiten Text durchzulesen, erspart er sich. Die Zusammenkunft ist beendet.
Wenige Minuten später sind Phelan, sein persönlicher Anwalt und dessen Sozius allein. Der Milliardär kramt in seiner Tasche. Er holt drei Bogen gelbes, beschriebenes Stempelpapier hervor und erklärt: „Das ist meine letztwillige Verfügung. Ein eigenständiges Testament, das ich Wort für Wort erst vor wenigen Stunden verfaßt habe. Es trägt das heutige Datum und wird unter diesem Datum von mir unterzeichnet. Hiermit widerrufe ich alle früheren Testamente, einschließlich dessen, das ich vor weniger als fünf Minuten unterzeichnet habe.“
Troy Phelan schiebt die Bögen über den Tisch seinem Anwalt zu, erhebt sich aus seinem Rollstuhl, läuft mit erstaunlicher Behändigkeit zu einer Schiebetür und stürzt sich aus dem 13. Stock in den Tod.
EIN WEITERES TESTAMENT
Das ultimativ letzte Testament wird eröffnet. Eine uneheliche Tochter mit Namen Rachel Lane, Missionarin im brasilianischen Regenwald, ist die Alleinerbin des Milliardenvermögens. Die anderen Familienmitglieder erhalten nur ihren Pflichtteil und setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um das Testament anzufechten. Sie rekrutieren eine Schar von Anwälten, die für Stundenhonorare ab 600 Dollar und eine prozentuale Beteiligung am Nachlass zu rabiaten Methoden greifen. Ihr Argument lautet: Ein Familienvater, der ein grob pflichtwidriges Testament zulasten der eigenen Familie verfasse, könne nicht bei Verstand gewesen sein. Vergeblich. Ein Erblasser, dem wenige Minuten zuvor bescheinigt wurde, normal zu sein, kann nicht für unzurechnungsfähig erklärt werden. Das Testament ist gültig.
Der Anwalt Nate O’Riley übernimmt die knifflige Aufgabe, die Erbin ausfindig zu machen. Nach erheblichen Schwierigkeiten auf seiner Reise durch Südamerika trifft er Rachel Lane, von Beruf Ärztin. Sie lebt bei einem Indianerstamm und wertschätzt viele Dinge mehr als Geld. Die künftige Milliardärin stirbt kurz nach der Begegnung an Malaria und hinterlässt wie ihr Vater ein gültiges, beglaubigtes Testament. Es enthält die Entscheidung, eine Stiftung zu gründen, deren Erträge der Eingeborenenbevölkerung und der Verbreitung des Christentums zugutekommen sollen. Zum Treuhänder der Stiftung beruft die Erbin „meinen guten Freund Nate O’Riley“ und fährt fort: „Zugleich ernenne ich ihn zum Testamentsvollstrecker.“
Ein spannender, aber realitätsfremder Roman? Keineswegs. Ulrich Falk, Professor für Erbrecht an der Universität Mannheim, sieht Parallelen zwischen Grishams Geschichte und dem Zank um das Testament des reichen Frankfurter Bürgers Johann Friedrich Städel Anfang des 19. Jahrhunderts. Städel verfügte ebenso wie die Romanheldin, dass mit seinem Vermögen eine Stiftung errichtet werden sollte. Die Möglichkeit war umstritten, denn diese Institution existierte zum Zeitpunkt des Todes noch nicht. Der Streit, ob es möglich ist, eine zu gründende Stiftung zur Erbin zu erklären, ging im Fall Städel über drei gerichtliche Instanzen. In der Gutachterschlacht gaben vier deutsche Universitäten ihr Votum ab. Es kam ein Vergleich zustande und die Stadt Frankfurt am Main bekam das bekannte Städel Museum.
HERZ UND SCHMERZ, GIFT UND GALLE
Es gibt noch mehr Parallelen zwischen Roman und Alltagsleben. Die Konstellation reicher alter Mann, mehrere Ehen und Kinder aus verschiedenen Verbindungen bildet seit Jahrhunderten einen gefährlichen Cocktail für jahrelang verdeckt oder offen geführte Erbstreitigkeiten.
Auch der Versuch, den Erblasser für unzurechnungsfähig zu erklären, ist kein Autorengag. Das ist Gerichtsalltag. Bekommen streitlustige Nachkommen weniger vom Nachlass, als sie sich ausgemalt hatten, fechten sie das Testament an. Erste Möglichkeit: Der Erblasser hat seinen Letzten Willen nicht eigenhändig errichtet. Zweite Möglichkeit: Er war testierunfähig. Eine dritte Möglichkeit ist die Irrtumsanfechtung („Wenn er nicht geirrt hätte, wäre ich bedacht worden …“). Alle drei Möglichkeiten hat Troy Phelan durch seine raffinierte Organisation mit Anwälten, Psychiatern und Kameras torpediert. Der Tipp, bei der Abfassung des eigenen Testaments eine gewisse Öffentlichkeit mit Verwandten herzustellen, steht bei Erbrechtlern hoch im Kurs.
Der Milliardär wollte vor allem seinen Exfrauen und ihrem „habgierigen Nachwuchs“ eine Lektion erteilen. Das ist ein Motiv, das viele Testamente prägt: Es ist weniger wichtig, wer das Geld bekommt, Hauptsache X bekommt es nicht bzw. nur den Pflichtteil. Bei der Notarausbildung gehört es zu den Standardfällen, wie geschiedene Ehepartner ihr Testament gestalten können, damit der oder die verhasste Ex bei „unvorhergesehener Versterbensreihenfolge“ kein Geld erhält.
Die Reaktion der Erbin war die große Unbekannte in Phelans Nachlasspoker. Er konnte davon ausgehen, dass sich eine Missionarin nicht sofort mit seinem Geld ins süße Leben von Rio stürzen würde. Rachel Lane bleibt sich selbst treu. Sie legt fest, dass mit dem ererbten Vermögen eine Stiftung für gute Werke gegründet werden soll. Der Roman spielt Ende der 1990er Jahre. Heute liegt Stiften im Trend. „Der Gedanke“, so der Hamburger Testamentsvollstrecker und Rechtsanwalt Andreas Ackermann, „eine Stiftung zu errichten und ihr den eigenen Namen zu geben oder bei kleineren Vermögen eine Zustiftung zu machen, gewinnt immer mehr Freunde. Früher bekamen die christlichen Kirchen das Geld.“
Stiftungen brauchen Vorstände, um handlungsfähig zu sein. Was für eine Person ist dieser „gute Freund“ Nate O’Riley, in den die Erbin ihr Vertrauen setzt? Im Roman ist der ehemalige Staranwalt ein Alkoholiker, der nach einer erfolgreichen Entziehungskur von seinen Exkollegen eine neue Chance bekommt. Er startet eine aufregende Suchaktion nach der Erbin. Er bedrängt sie sanft und erfolgreich, ihre anfängliche Ablehnung in ein positives Votum umzuwandeln und das Erbe anzunehmen. In einem Filmtrailer würde die Kehrtwendung so formuliert: Nate O’Riley vollbrachte das Wunder, der dekadenten Sippe die Milliarden zu entreißen und wohltätigen Zwecken zuzuführen.
Bei meinen Recherchen habe ich keinen Alkoholiker getroffen, aber ich habe gespürt, dass Testamentsvollstrecker Macht ausüben können. Im Guten wie im Bösen.
// WO FINDE ICH MEINEN TESTAMENTSVOLLSTRECKER?
Richard Rachlitz, Assessor an der Bundesnotarkammer in Berlin, kennt die Nöte: „Es ist schwer, einen Testamentsvollstrecker zu finden.“
Knappheit? Das klingt kurios, nachdem Juristen, Steuer- und Bankberater zu Hunderten in die Veranstaltungen für zertifizierte Testamentsvollstrecker drängen. Haben sie die Qualifikation erst einmal in der Tasche, möchten sie umgehend geschäftsmäßig tätig werden. Hinzukommen anderweitig Berufene, die sich für kompetent halten, den Job zu machen, und aktiv auf Mandantenfang gehen.
Auf der Zeitachse sind Knappheit und Fülle kein Widerspruch. Erblasser, die mithilfe der Notarkammer einen Vermögensverwalter für ihren Nachlass suchen, haben in der Regel noch viele Lebensjahre vor sich. Sie benötigen keine Helfer ad hoc. Sie fahnden nach einer Person, zu der sie heute Vertrauen fassen können und die in zehn und mehr Jahren noch kundig, zuverlässig, diplomatisch und gesund ist, um das verantwortungsvolle Amt zu übernehmen.
Diese Kümmerer und Vorsorger könnten ihre Erbangelegenheiten gelassener angehen. Jedermann hat das Recht, seinen designierten Testamentsvollstrecker eines Tages auszuwechseln oder auf einen Sekundanten nach dem Tod völlig zu verzichten. Aber wer tut das schon? Geräuschlos funktioniert ein Tausch oder sogar der Fortfall eines solchen Mandats nicht. Das Thema Testamentsvollstreckung war irgendwann bei Freunden zur Sprache gekommen. Es macht müde, sich wegen einer Änderung ihren fragenden Gesichtern zu stellen. Darum lässt man alles, wie es war.
Je höher die Hausnummer des Vermögens, je kleiner die Stadt, desto größer die Aufmerksamkeit.
Bertelsmann-Eigentümer Reinhard Mohn stellte am 1. Juli 1999 seinen Finanzvorstand Siegfried Luther als Mann seines Vertrauens der Öffentlichkeit vor. Einige Dutzend Journalisten waren zu dieser wichtigen Pressekonferenz in den Keller der Hauptverwaltung in Gütersloh eingeladen worden. Dort, wo die Ahnengalerien der Familien untergebracht sind, sprach der große Mann der Stadt über den weniger großen, aber wichtigen Mann an seiner Seite. Die weitreichende Entscheidung des 78-Jährigen, den Bertelsmann-Finanzchef Luther zu seinem Testamentsvollstrecker zu machen, war lange gereift. Der Unternehmer hatte seinen 23 Jahre jüngeren Manager an den Fragen beteiligt, die ihn besonders bewegten. Wie könnte er sein Erbe sichern? Wie könnte er verhindern, dass die Erbschaftsteuer seine Kinder zwingt, einen Teil zu verkaufen und fremde Gesellschafter aufzunehmen?
Die Vorbereitungen waren wie eine Blaupause für kluges Verhalten eines Erblassers abgelaufen. Wann immer Mohn Überlegungen zur Nachfolgeregelung angestellt hatte, rief er Luther übers Haustelefon an oder schickte ihm eine kurze Notiz. Die beiden Männer tauschten sich oft mehrfach am Tag aus. Der Untergebene empfand es als Herausforderung, seinem Chef schnell zu antworten. Dieser redete häufig und offen über seinen Tod und über die notwendigen Regelungen für die Zeit danach. Es fiel die Entscheidung, eine Stiftung zu gründen. Die steuerrechtlichen Aspekte klärte Luther ebenso wie die juristische Positionierung der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG). Wer ihre Stimmrechte besitzt, kontrolliert das Bertelsmann-Imperium, eines der größten internationalen Medienunternehmen.
Die Sensation folgte im Oktober 2003. Reinhard Mohn entließ zu seinen Lebzeiten den designierten Testamentsvollstrecker im Stil eines Undercover-Ereignisses. Der Vorgang sei reine Privatsache, wehrte die Pressestelle alle Nachfrager ab.
Die ungewöhnliche Entmachtung war in Gütersloh wochenlang das Topstammtischgespräch. Es hieß, Ehefrau Elisabeth („Liz“) Mohn, ehemalige Telefonistin im Unternehmen ihres Mannes, habe die starke Position und die Vertrauensstellung Luthers gezielt unterminiert. Der Finanzstratege hatte sich als Interessenvertreter aller sechs Kinder von Reinhard Mohn definiert, dazu gehörten auch die drei Nachkommen aus dessen erster Ehe. Liz Mohn – so wurde an der Theke getuschelt – sah in Luther einen Konkurrenten ihrer eigenen Pläne, Tochter Brigitte und Sohn Christoph in den Vordergrund zu schieben. Von einer veritablen Stammesfehde im Zusammenhang mit Bertelsmann zu sprechen hätte niemand gewagt. Fakt ist, dass Liz Mohn und ihre beiden Kinder in den wichtigen Gremien der Stiftung und des Unternehmens Sitz und Stimme haben. Sie entscheiden über Organisation und Strategie eines Konzerns mit knapp 17 Milliarden Euro Umsatz. Die drei Kinder aus erster Ehe kommen hier nicht vor.
Der Ex-Bertelsmann-Manager Luther hat nie öffentlich seine Degradierung kommentiert. Er beschwichtigte, sooft er um seine Meinung gebeten wurde: „Die Testamentsvollstreckung ist eine rein persönliche Sache.“ Mit dieser vor Diplomatie triefenden Aussage hatte der entlassene Ratgeber nicht die Klatschmäuler auf seiner Seite. Dafür aber den Bundesgerichtshof.
In einer Grundsatzentscheidung vom 11. November 2004 bestätigte der BGH die Bedeutung der weichen Faktoren. Ein Erblasser mache nicht nur aus rationalen Gründen eine bestimmte Person zum Testamentsvollstrecker. Das Oberlandesgericht Karlsruhe fällte ein vergleichbares Urteil pro persönliche Freiheit und contra das vernünftig Nachvollziehbare. Es sei letztendlich „die höchstpersönliche Auswahlentscheidung bezüglich eines bestimmten Menschen durch seine eigenen Wertvorstellungen“.
VERTRAUTE GESICHTER
Eine Pressekonferenz im Stile Reinhard Mohns einzuberufen, um über testamentarische Regelungen zu sprechen, ist außergewöhnlich. Aber für jeden, der ein Geld- und Immobilienvermögen oder sogar eine Firma zu vererben hat, ist die Wahl eines Testamentsvollstreckers eine außerordentlich wichtige Angelegenheit. Mag das Vermögen viel bescheidener sein als bei Bertelsmann, die bisweilen monate- oft jahrelangen Überlegungen und Beobachtungen sind vergleichbar diffizil.
Eine Sichtung des eigenen Bekanntenkreises ergibt sich zwanglos. Man trifft Freunde in schöner Regelmäßigkeit auf dem Golfplatz, mittwochs bei Rotary oder zweimal im Monat bei der Jagd. Plötzlich hat der Erblasser die pragmatische Idee: Mensch, den könntest du mal fragen, ob …? Die Entscheidung für den Freund oder guten Bekannten liegt nahe, wenn er im eigenen oder einem fremden Beirat/ Aufsichtsrat sitzt. Das weist ihn als Kenner wirtschaftlicher Problemstellungen aus.
Dr. Michael Hoffmann-Becking, der Grandseigneur der Düsseldorfer Kanzlei Hengeler Mueller und mit glänzenden Kontakten zu Konzernen und Unternehmerfamilien, ist designierter Testamentsvollstrecker zweier Freunde. Möchten diese Herren tatsächlich den Industrieanwalt, Jahrgang 1943, als Hüter ihres Nachlasses haben, müssten sie sich mit ihrem Tod beeilen. „Ab 75 Jahren werde ich das Amt ausschlagen“, meint der Anwalt angesichts der eigenen Endlichkeit.
Erblasser sollten stets überlegen, ob neben dem gegenseitigen Vertrauensverhältnis auch das Alter kompatibel ist. Es sei sehr schwierig, so Hoffmann-Becking, bis sich ein älterer Freund bereit erkläre, einen jüngeren Anwalt aus der Kanzlei ins Vertrauen zu ziehen und als möglichen Nachlassverwalter zu akzeptieren.
LADENHÜTER ODER BESTSELLER
Ich bitte die Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge (AGT) um Kontakte für meine Recherchen. Der Hamburger Rechtsanwalt Andreas Ackermann steht für ein Gespräch zur Verfügung.
Die Adresse, Grimm 12, gegenüber der Hauptkirche St. Katharinen, ist eine gute Lage. Ich durchschreite ein Hamburger Barockportal aus dem Jahr 1750 und gehe als Nächstes durch eine kunstvoll geschnitzte schwere Holztür aus Eiche. Das Motiv stellt einen Schiffer dar, der einer bildschönen Meernixe hinterherfährt. Ob das sein Verderben ist, hat der Schnitzer offengelassen.
Das Interieur ist schlicht-funktionell. Eine rote Amaryllis versucht, nette Stimmung zu verbreiten. Es sind wenige Schritte bis zum Besprechungszimmer mit dem großen ovalen Tisch in der Mitte, gefüllten Bücherregalen und einer Kaffeetheke. Ackermann, in Anzug, Hemd und Krawatte, entspricht dem Bild eines korrekten Testamentsvollstreckers. Er hat seine Visitenkarte auf meinen Platz gelegt. Vor ihm liegen mein Brief und meine Vita.
Der Hausherr ist ein Freund klarer Aussagen. Er prophezeit, dass mein Buch wohl kaum von einem Erblasser gekauft und gelesen werde, so nützlich die Lektüre sein möge. Ackermann: „Nahezu alle, die hier sitzen, verdrängen den Tod, fast ohne Ausnahme. Wenn die Erblasser das Thema zulassen, dann nur im persönlichen Gespräch mit Menschen ihres engen Vertrauens“ – wozu ein Buch sicherlich nicht gehört. Im Übrigen, so Ackermann, durchdringe der normale Mandant nicht das Thema Erbe bis hin zur Testamentsvollstreckung. Erbrecht und Nachbargebiete – ein Buch mit sieben Siegeln. Ich entgegne, dass diese Klientel große Erwartungen an das Buch habe, weil es die Chance biete, Testamentsvollstreckung anhand von Beispielen verstehen zu lernen. Death is risk, come on!
EINE SCHICKSALSFRAGE
Weiter berichtet der Anwalt, dass an diesem Tisch gleichwohl genügend Erblasser säßen, um ihn gut zu beschäftigen. Sicherlich sei es für viele eine Überwindung, hierherzukommen. Die Ehefrauen und mitunter die eigenen Kinder oder persönliche Freunde müssten den Zaudernden bedrängen, die Kanzlei aufzusuchen, die auf Erbe – Grundstück – Vermögen spezialisiert ist. Manchmal sei der eigene Wunsch, einen geordneten, wohlüberlegten Nachlass statt eines Chaos zu hinterlassen, größer als der Widerwille, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen.
Die Ehefrauen und Witwen, klassisch in Seidenbluse, gehen mit ihrer eigenen Endlichkeit weniger spröde um. Sie haben ihren 60., 70. oder gar 85. Geburtstag gefeiert. Sie gehen mutig und beherzt durch die geschnitzte Haustür. Sie wollen am Ende ihres Lebens im Umfeld etwas Gutes tun und Frieden zwischen den Kindern stiften oder erhalten. Ackermann: „Die Kinder sollen später einmal ein Loblied auf die kluge Mama singen.“
Alle Klienten bewegt dieselbe Frage: „Finde ich hier den richtigen Testamentsvollstrecker?“
Der Anwalt stellt sich als personifizierte Lösung vor. Ackermann: „Ich verkaufe Erfahrung, Achtsamkeit und Kontinuität.“ Was er sagt, gilt für die ganze Zunft. Viele Erblasser überfordert die immer komplexere Rechtsmaterie. Sie können nur noch Fachleuten vertrauen, um Fehler zu vermeiden. Deshalb müsse ein Testamentsvollstrecker in spe, so Ackermann, „mit dem Gewicht seiner Persönlichkeit überzeugen“. Juristischer Sachverstand und spezielle Erb-, Gesellschafts- und Steuerrechtskenntnisse seien Voraussetzung. Die Mandanten verlangten darüber hinaus wirtschaftliche Urteilskraft und psychologisches Einfühlungsvermögen.
Ackermann nimmt meine Frage vorweg, was ihn zum Testamentsvollstrecker qualifiziere. Die Antwort ist umfangreicher:
Jura, insbesondere Methodenlehre und Rechtsphilosophie studiert („Handwerkszeug“), Studium der Betriebswirtschaftslehre angehängt („von großem Nutzen, um wirtschaftliche Zusammenhänge und das Denken der Klienten zu verstehen“), Intensivkurse bei einer Coaching erfahrenen Diplompsychologin („um die gegenübersitzende Person zu erfassen – das Allerwichtigste für die Kommunikation“). Ackermann ist Mitglied im richtigen Sportverein und hat eine Adresse im richtigen Hamburger Vorort.
Außerdem wichtig und als Ratschlag eins zu eins auf andere Städte übertragbar: Der Anwalt kennt das Personal der Hamburger Nachlassgerichte durch Fachseminare und durch ihre jahrelange Zusammenarbeit. Er kann auf dem kurzen Dienstweg Fristen klären und Bürokratie reduzieren.
EIGNUNGSTEST
Ackermanns Verheißung lautet: Die Kosten einer möglichst streitvermeidenden Testamentsvollstreckung stellten zwar eine hohe Investition dar, aber es lohne sich. Ein wunderbarer Werbespruch für alle selbstbewussten Nachlassverwalter!
Der Jurist verlangt für die Übernahme einer Testamentsvollstreckung zwischen zwei und vier Prozent des Bruttonachlasswertes, also des Vermögenswertes plus Verbindlichkeiten. Beträgt dieser 500.000 Euro schreibt Ackermann eine Rechnung über drei Prozent, das sind 15.000 Euro. Bei einer Summe von zwei Millionen Euro lautet die Vergütungsforderung 2,5 Prozent des Bruttonachlasswertes also 50.000 Euro, stets plus Umsatzsteuer. Ackermann: „Das ist ein hohes, attraktives Honorar. Es deckt selbstverständlich den gesamten Zeitraum der Tätigkeit ab.“
Von den Erben kommt häufig der Einwand: „Was, so viel?“ Ackermann: „Ich erkläre dann, was sie alles dafür bekommen im Rahmen der Konstituierung des Nachlasses. Ich als Testamentsvollstrecker verlange keinen Vorschuss. Die Familie zahlt die Summe zwar nicht gern, aber mit Zähneknirschen: Vater oder Mutter haben es so gewollt.“
Der Hamburger Anwalt nimmt nicht jeden, selbst wenn der Klient einen einfach erscheinenden Sachverhalt mitbringt und die Honorarnote locker bezahlen könnte. Keine streitigen Prozesse sind eine wichtige Voraussetzung, um neue Mandate zu akquirieren und Geld zu verdienen. Die Superreichen scheiden deshalb als Klienten aus. Ackermann legt auf die positive Mundpropaganda und sein Image Wert. Am liebsten berät er Erblasser „in the middle of the road“. Im Idealfall sind dies Eigentümer inhabergeführter Familienunternehmen, auch von größeren Handwerksbetrieben.
Als grobe Linie sollten die Klienten den Wert intakter Generationen nicht verachten. Ackermann: „Kommt zu mir ein autoritärer und selbstgerechter Unternehmer, um mir eine Testamentsvollstreckung anzudienen, hat er kein positives Entrée, sondern schlechte Karten, denn er handelt wahrscheinlich nicht im Interesse der Familie.“ Eine Falle, die der potenzielle Treuhänder unbedingt vermeiden möchte. Aus dieser Falle kommt er nämlich zumeist nur nach erheblichem Ärger mit dem Nachlassgericht und mit der Familie wieder heraus.





























