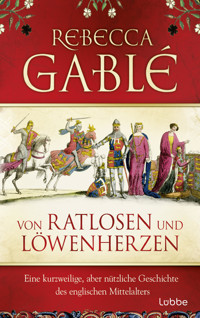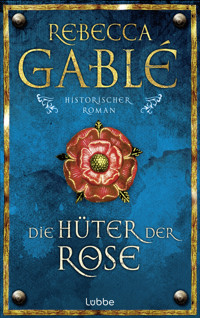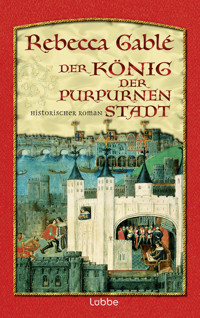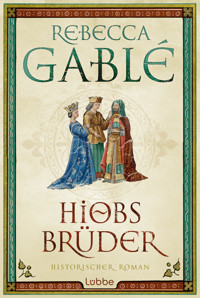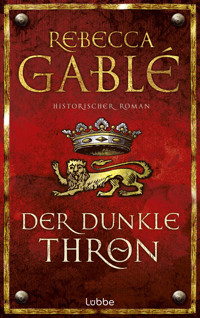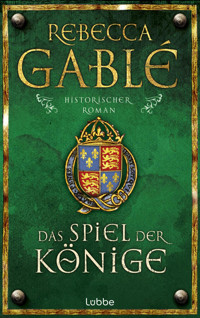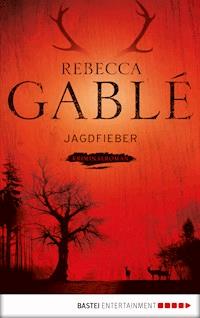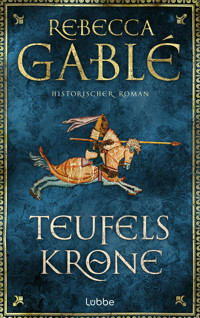
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Waringham Saga
- Sprache: Deutsch
England 1193: Als der junge Yvain of Waringham in den Dienst von John Plantagenet tritt, ahnt er nicht, was sie verbindet: Beide stehen in Schatten ihrer ruhmreichen älteren Brüder. Doch während Yvain und Guillaume of Waringham mehr als die Liebe zur selben Frau gemeinsam haben, stehen die Brüder John Plantagenet und Richard Löwenherz auf verschiedenen Seiten - auch dann noch, als John nach Richards Tod die Krone erbt. Denn Richards Schatten scheint so groß, dass er John schon bald zum Fluch zu werden droht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1383
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Titel
DRAMATIS PERSONAE
Widmung
Zur Aussprache der Namen
Prolog
Erdberg, Dezember 1192
ERSTER TEIL HÖLLENPAKT 1193–1194
Waringham, Januar 1193
Winchester, Januar 1193
Waringham, Februar 1193
Windsor, Februar 1193
Windsor, April 1193
Waringham, Juni 1193
Nottingham, Juli 1193
Waringham, Februar 1194
Westminster, März 1194
Bernay, April 1194
ZWEITER TEIL FREVELTAT 1199–1204
Nantes, März 1199
Châlus-Chabrol, März 1199
Chinon, April 1199
Waringham, Mai 1199
Westminster, Mai 1199
Rouen, Juli 1199
Chinon, September 1199
Le Mans, September 1199
Waringham, Oktober 1199
Lusignan, Juli 1200
Bordeaux, August 1200
Waringham, Januar 1201
Rouen, September 1201
Waringham, September 1201
Caen, Oktober 1201
Maine, Juli 1202
Rouen, April 1203
Waringham, Dezember 1203
Worcester, April 1204
DRITTER TEIL REBELLION 1210–1216
Winchester, November 1210
Westminster, Februar 1211
Corfe Castle, Februar 1211
Windsor, März 1211
Waringham, März 1211
Waringham, September 1211
Waringham, August 1212
Nottingham, August 1212
Waringham, Mai 1213
Winchester, Juli 1213
Waringham, Januar 1214
Portsmouth, Februar 1214
Angers, Juni 1214
Valenciennes, Juli 1214
La Rochelle, August 1214
Waringham, November 1214
London, Mai 1215
Runnymede, Juni 1215
Waringham, Januar 1216
Waringham, Februar 1216
Waringham, Oktober 1216
Newark, Oktober 1216
Gloucester, Oktober 1216
Waringham, November 1216
Nachbemerkung und Dank
Über Rebecca Gablé
Hat es dir gefallen?
Impressum
Über dieses Buch
England 1193: Der Bruderkrieg zwischen König Richard Löwenherz und dem jüngeren Prinzen John spaltet das Land. Während Richard England nur als Geldquelle für seine ehrgeizigen Feldzüge in Frankreich und Palästina ansieht, versucht John, die Macht in seinem Vaterland an sich zu reißen.
An seiner Seite steht der junge Yvain of Waringham, der in den Dienst des berüchtigten Prinzen getreten ist, um der unglücklichen Liebe zur Verlobten seines Bruders zu entfliehen. Als John nach Richards Tod die Krone erbt, lädt er eine schwere Schuld auf sich – und macht Yvain zum Mitwisser einer Tat, die ihrer beider Leben verändern soll …
REBECCA GABLÉ
TEUFELSKRONE
Historischer Roman
DRAMATIS PERSONAE
Es folgt eine Aufstellung der wichtigsten Figuren, wobei die historischen Personen mit einem * gekennzeichnet sind.
Yvain of Waringham
Jocelyn, Earl of Waringham, sein Vater
Maud de l’Aigle of Pevensey, seine Mutter
Guillaume of Waringham, sein Bruder
Cecily of Waringham, seine missratene Schwester
Adelisa of Waringham, seine ewig abwesende Schwester
Amabel of Hetfield, Lord Jocelyns Mündel
Richard »Löwenherz«*, König von England
John »Ohneland«*, König von England
Aliénor von Aquitanien*, Königin von England und vieles mehr, ihre Mutter
Isabella d’Angoulême*, Johns Gemahlin
Henry*, Richard*, Joan*, Isabella* und Eleanor*, die Prinzen und Prinzessinnen
Joan*, Johns uneheliche Tochter
William »Longsword«*, Earl of Salisbury, ein unehelicher Bruder der beiden Könige
Arthur*, Herzog der Bretagne, ein Neffe der beiden Könige
Constance de Bretagne*, seine Mutter
Eleanor*, seine Schwester
Guillaume de Braose*, ein mächtiger Adliger und treuer Anhänger König Johns
Maud de Braose*, seine allseits gefürchtete Gemahlin
William de Braose*, ihr Sohn, Ritter in König Johns Haushalt, Yvains bester Freund
Justin de Béthune, Adam de la Pomeroy und Baldwin Beaumont, ebenfalls junge Ritter in Johns Gefolge, genau wie
Pentecôte FitzHugh, Yvains erbitterter Feind
Fulk de Cantilupe*, König Johns treuer Ritter
Hubert de Burgh*, König Johns Justiciar, Chamberlain und vertrauter Freund
William Marshal*, Earl of Pembroke, der mächtigste Adlige in England und eine Legende
Mercadier*, Söldner, König Richards Lieblingsschlächter
Brandin*, Söldner, König Johns Lieblingsschlächter
Roger Bigod*, Earl of Norfolk, Mitinitiator der Magna Charta
Hugh Bigod*, sein ältester Sohn, ebenfalls Mitinitiator der Magna Charta
Thomas Bigod*, noch ein Sohn, Yvains Knappe und Freund
Hugo de Lusignan*, ein mächtiger aquitanischer Adliger
Beatriz de Lagrave, Königin Isabellas Vertraute
Robert FitzWalter*, Verschwörer, Rebellenführer und Mitinitiator der Magna Charta
Terric »der Teutone«*, Königin Isabellas Leibwächter
Geoffrey FitzStephen*, Meister der Templer in England
Hubert Walter*, Erzbischof von Canterbury
Stephen Langton*, Erzbischof von Canterbury, sein Nachfolger
John de Gray*, König Johns Vertrauter, Bischof von Norwich und beinah Erzbischof von Canterbury
Für meinen Vater Wolfgang Krane in liebevoller Erinnerung
Sterben, das heißt freilich die Zeit verlieren und aus ihr fahren, aber es heißt dafür Ewigkeit gewinnen und Allgegenwart, also erst recht das Leben. Thomas Mann
Zur Aussprache der Namen
Bevor ich mit diesem Roman begann, las ich zur Einstimmung auf die Epoche wieder einmal Chrétien de Troyes’ wundervollen Versroman Yvain, der im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts entstand. Und irgendwie geschah es, dass mein Romanheld den Namen des »Löwenritters« bekam. Die englische Aussprache dieses Namens reimt sich auf »Elaine« oder »Domain«, mit der Betonung auf der zweiten Silbe. (Ein deutsches Reimwort konnte ich leider nicht finden.) Die französische Aussprache ist so ähnlich, aber mit der Betonung auf der ersten Silbe und einem Nasallaut am Ende, also ungefähr so, als hätten Sie einen Schnupfen.
Dieser Roman spielt während der linguistisch verwirrenden Epoche, als nur die bäuerliche Unterschicht in England Englisch sprach, die adlige Oberschicht jedoch Französisch. Deswegen müssten wir uns die Namen der Könige und ihrer Höflinge eigentlich in französischer Aussprache denken, aber als emanzipierte Leserinnen und Leser dürfen wir das halten, wie wir wollen. Das »Æ« in den angelsächsischen Namen entspricht dem deutschen »Ä«.
Prolog
Erdberg, Dezember 1192
»Wir haben die Schlacht von Arsuf überlebt, wir werden auch dies hier überstehen«, sagte Richard grimmig. Todesmutig führte er den Rührlöffel an die Lippen und kostete den zähflüssigen Brei, dessen schlammige Farbe und Beschaffenheit nichts Gutes verhießen. Mit einem gedämpften Protestlaut ließ er den Rest vom Löffel zurück in den Kessel tropfen und rührte in der blubbernden Masse. »Allmächtiger … Das ist wirklich schauderhaft.«
Einer der beiden abgerissenen Pilger, die mit ihm am qualmenden Herdfeuer standen, verschränkte die Arme und seufzte. »Sagtest du nicht kürzlich, du wüsstest zu gerne einmal, was er nicht kann, Guillaume? Ich schätze, wir sind im Begriff, es herauszufinden.«
Guillaume grinste abwesend und sah zum Dachstuhl hinauf, dessen geschwärzte Balken vernehmlich knarrten, weil der eisige Dezemberwind durch die Strohschindeln pfiff. »Wetter hin oder her, wir sollten aufbrechen«, riet er leise, aber eindringlich. »Wir sind schon zu lange hier.«
»Oh, jetzt mach dir nicht ins Hemd«, entgegnete sein Gefährte unbekümmert. »Morgen Abend sind wir in Mähren, und dann hat der ganze Spuk ein Ende.«
»Bis morgen Abend kann noch viel passieren, Maurice. Außerdem sind es mindestens fünfzig Meilen bis zur Grenze, und der Schnee liegt jetzt schon eine Elle hoch. Also …«
»Du hast ja recht«, unterbrach Richard ihn beschwichtigend. »Aber wenn wir jetzt aufbrechen, kommen wir nirgendwohin, Freunde, weil die Pferde erfrieren würden und wir vermutlich auch.« Er schob den Kessel beiseite, der an einem langen, schwenkbaren Eisenhaken über dem Feuer hing, und drehte ungeschickt den Spieß mit dem mageren Huhn gleich daneben, den Blick auf die schwärzlich verbrannte Haut gerichtet. Selbst im Schummerlicht dieses erbärmlichen Gasthauses schienen seine stahlblauen Augen zu leuchten. Vitalität, Klugheit, die unerbittliche Beharrlichkeit eines Visionärs – all das war in diesen Augen zu lesen, aber die Züge verrieten seine tiefe Erschöpfung. Sie waren alle müde nach den Wochen der Flucht, und keiner von ihnen konnte dem Ritt durch die Winternacht wirklich ins Auge sehen, auch Guillaume nicht.
»Soll ich vielleicht?«, fragte er und zeigte auf das Huhn.
»Kommt nicht infrage«, gab Richard kurz angebunden zurück. »Willst du etwa behaupten, ich sei nicht einmal in der Lage, ein Huhn zu braten?«
»Wie oft habt Ihr es denn schon gemacht?«, wollte Maurice wissen.
»Alles hat ein erstes Mal«, gab der Koch leichthin zurück, und seine Gefährten lachten.
Der fette Wirt, der mit einem Mönch und einem halben Dutzend Bauern aus der Gegend an einem der Tische saß, schaute verstohlen zu ihnen herüber, die Augen verengt, den Mund verkniffen. Die drei fremdländischen Pilger waren ihm nicht geheuer. Sie reisten in schäbigen Kleidern und ohne Dienerschaft, sodass sie sogar ihr eigenes Essen kochen mussten, aber sie waren mit den kostbarsten Pferden gekommen, die man in Erdberg seit Menschengedenken gesehen hatte. Auch die einheimischen Zecher betrachteten die sonderbaren Reisenden furchtsam. Erdberg lag kaum mehr als einen Bogenschuss von den Toren Wiens entfernt, aber dennoch waren Fremde hier weder häufig noch gern gesehen.
»Mehr Wein!«, orderte Richard, und während er mit der Rechten weiter den Spieß drehte, fischte er mit zwei Fingern der Linken eine Goldmünze aus der Börse am Gürtel und schnipste sie dem Wirt zu.
Sie beschrieb einen funkelnden Bogen durch den verqualmten Raum, wie ein Komet in einer sternlosen Nacht. Der Wirt hob im letztmöglichen Moment die Hand, fing die Münze auf und starrte einen Moment darauf hinab. »Das kann ich nicht wechseln«, nörgelte er.
Richard verstand die Worte nicht, wohl aber den Sinn, und winkte gleichgültig ab. »Schon gut. Aber mehr Wein, wenn du hast?« Er sprach überdeutlich und mit untypischer Nachsicht, als hätte er ein verängstigtes Kind vor sich.
Der Wirt erhob sich ächzend, ging in die finsteren Regionen am Ende des Schankraums, wo seine Fässer standen, und man hörte das dumpfe Scheppern eines Zinnkrugs.
Der Wind legte noch einmal zu und heulte mit Furienstimmen um das Gasthaus.
»Ich hoffe, diese jämmerliche Spelunke wird nicht einfach umgepustet«, murmelte Maurice. Es sollte verächtlich klingen, aber man hörte sein Unbehagen.
Plötzlich hob Guillaume den Kopf. »Reiter.«
»Oh, komm schon«, protestierte Maurice. »Erzähl mir nicht, du kannst bei dem Geheul Hufschlag im Schnee hören oder …«
»Schsch«, unterbrach Richard knapp. Er schenkte seine volle Aufmerksamkeit wieder dem Brathühnchen und machte scheinbar zufällig eine Vierteldrehung, sodass er den breiten Rücken der Tür zuwandte.
Der alte Wirt kam herübergeschlurft und stellte einen Krug auf das leere Fass, das ihnen als Tisch diente. »Wohl bekomm’s.«
Becher gab es nicht, also setzte Richard den Zinnkrug an die Lippen und trank. Er reichte den Krug an Guillaume weiter, als sich knarrend die Tür öffnete.
In einer gewaltigen Schneewolke drängelten sich vier gerüstete Männer über die Schwelle, zwei die gezückten Schwerter in der Hand, zwei mit Fackeln.
Die Bauern verstummten und starrten die Ankömmlinge an, reglos wie Kaninchen vor der Schlange. Der Wirt versuchte, seine Furcht zu verbergen, und fragte mit aufgesetzter Herzlichkeit: »Was kann ich für Euch tun, edle Herren?«
Sie würdigten ihn keiner Antwort, sondern traten langsam zu Richard und seinen Gefährten.
»Drei Pilger, sieh mal einer an«, sagte der Vordere, dessen schwarzer Bart und Augenbrauen schneeverkrustet waren. Er sprach wenigstens so etwas Ähnliches wie Französisch, sodass sie ihn verstehen konnten. Ein zerfranstes Kreuz zierte seinen Mantel. Wer lange genug im Heiligen Land gewesen war, lernte früher oder später zwangsläufig ein paar Brocken Französisch, denn es war die Sprache des christlichen Königreichs Jerusalem.
»Gott sei mit Euch, Freund«, grüßte Maurice und hielt ihm einladend den Weinkrug hin.
»Was verschlägt Euch in diese abgelegene Gegend so fernab aller Pilgerstraßen?«, beharrte der Bärtige, ohne den Krug anzunehmen.
»Unwägbarkeiten auf der Heimreise«, antwortete Richard.
»Wie bedauerlich. Habt Ihr etwa in Aquileja Schiffbruch erlitten?«
»Aquileja? Wie kommt Ihr denn darauf?«, verwunderte sich der ungeschickte Koch.
Maurice und Guillaume tauschten einen sehr verstohlenen, sehr beunruhigten Blick.
»Wir hörten so ein Gerücht«, erwiderte Schwarzbart leichthin. »Von einem Heimkehrer aus dem Heiligen Krieg, der vor Korfu sein Schiff im Sturm verlor, ein Piratenschiff kaperte, um die Reise fortzusetzen, nur um dann vor Istrien schon wieder Schiffbruch zu erleiden.«
»Das muss ja ein wilder Geselle sein«, spöttelte Guillaume.
Schwarzbart nickte. »Deswegen nennen sie ihn Löwenherz.«
»Nun, wir sind auf dem Landweg aus dem Heiligen Land zurückgekehrt, denn wir sind arme Pilger, wie Ihr seht«, erklärte Maurice. »Wir haben kein Gold, um Schiffe zu bezahlen.«
»Wirklich?«, fragte Schwarzbart amüsiert und wies auf die Hand, mit der Richard den Spieß drehte. »Ich wette, mit dem Klunker hättet Ihr eine ganze Flotte bezahlen können.«
Betreten starrte Richard auf den kostbaren Smaragdring am rechten Zeigefinger, den abzunehmen er irgendwie vergessen hatte.
Der zweite Ankömmling, der die blanke Klinge in der Hand hielt, trat aus dem Halbdunkel nahe der Tür in den zuckenden Fackelschein und streifte mit der freien Hand seine Kapuze zurück. »Gott zum Gruße, edler König. Ihr ahnt nicht, welche Freude es ist, Euch wiederzusehen.«
Richard gab die Verstellung auf. »Herzog Leopold. Ich hoffe, Ihr vergebt, dass meine Freude sich in Grenzen hält.«
Der Herzog von Österreich lächelte, und der Hass, der in seinen dunklen Augen funkelte, konnte einem den Atem verschlagen. »Ich verhafte Euch im Namen des Kaisers.«
»Tatsächlich?« Scheinbar gedankenverloren nahm Richard den geschwärzten eisernen Spieß vom Feuer.
Sie hatten die Waffen abgelegt, um den Bauern die Furcht zu nehmen, und das rächte sich nun. Aber der Bratspieß war lang und spitz. Mit einem eleganten Aufwärtsschwung lehrte der König von England das halb verbrannte, halb rohe Brathühnchen das Fliegen, und es entschwand Richtung Dachgebälk. Gerade als Richard sich Leopold mit seiner sonderbaren Waffe zum Kampf stellen wollte, öffnete die Tür des Gasthauses sich erneut, und fünf weitere bewaffnete und gerüstete Männer stürmten herein.
Guillaume und Maurice hatten ihre Schwerter in den Binsen hinter der Sitzbank fast erreicht, als vier der Neuankömmlinge sich auf sie stürzten und sie an den Armen packten. Hände tasteten unter ihren Pilgermänteln, suchten und fanden die dort verborgenen Dolche und warfen sie auf den Boden.
Herzog Leopold machte noch einen Schritt auf Richard zu. »Ergebt Euch. Selbst Ihr müsst einsehen, dass Ihr keine Chance habt.«
Die unverkennbare Nervosität in seiner Stimme war immerhin ein Trost. Richard Löwenherz, so sagte die Legende, war der größte Feldherr seines Zeitalters, ein unbezwingbarer Schwertkämpfer obendrein, egal wie groß die feindliche Übermacht.
Doch die Legende übertrieb. Nicht einmal Richard Löwenherz konnte mit einem Bratspieß eine feindliche Übermacht von neun zu eins besiegen. Und er dachte nicht daran, sich bei dem Versuch zum Gespött zu machen.
Also warf er Leopold den Spieß vor die Füße. »Das Huhn schenke ich Euch dazu«, sagte er liebenswürdig.
»Das würde ich mir an Eurer Stelle noch einmal überlegen«, entgegnete der Herzog. »Es könnte für lange Zeit das letzte Brathühnchen sein, das Ihr seht.« Er gab seinen Männern ein Zeichen. »Na los, worauf wartet ihr?«
Sie zögerten nur für die Dauer eines Lidschlags. Dann setzte Schwarzbart dem König die Klinge an die Kehle, während zwei weitere auch ihn nach verborgenen Waffen abtasteten. Ein vierter trat hinzu, und ein dumpfes Klirren war zu vernehmen.
»Ich hoffe, Ihr seht mir nach, dass ich keine silbernen Ketten mitgebracht habe, wie Ihr sie für meinen Vetter Isaac von Zypern anfertigen ließet«, höhnte Leopold bitter. Die Schmach seines Cousins war nur ein Punkt auf der langen Rechnung, die er mit Richard von England offen hatte.
»Grämt Euch nicht«, entgegnete dieser tröstend. »Goldene Ketten wären ohnehin angemessener gewesen, meint Ihr nicht?«
Für einen Moment sah es so aus, als würde Leopold die Beherrschung verlieren und mit der Klinge oder den Fäusten auf ihn losgehen. Aber er nahm sich im letzten Moment zusammen. »Schafft ihn hinaus«, befahl er seinen Männern.
»Wo bringt Ihr ihn hin?«, fragte Guillaume. »Wisst Ihr eigentlich, was Ihr tut, Euer Gnaden? Welch furchtbare Sünde Ihr begeht, einen Heiligen Krieger auf der Heimreise zu überfallen?«
Leopold schnaubte belustigt. »Ich werde versuchen, es bei der nächsten Beichte nicht zu vergessen. Und jetzt gib Ruhe, Söhnchen. Wenn du schön artig bist, darfst du noch ein bisschen weiterleben.«
Guillaume sah ihm in die Augen. »Ich bin kein Söhnchen, Euer Gnaden. Mein Name ist Guillaume of Waringham, und ich gehe, wo immer König Richard hingeht.«
»Maurice de Clare«, meldete sein Freund sich zu Wort. »Und das gilt auch für mich.«
Leopold winkte desinteressiert ab. »Ihr täuscht euch beide. Da, wo er hingeht, braucht er keine Gesellschaft. Gerhard, Wilhelm, bindet sie und behaltet sie im Auge. Morgen früh lasst sie meinethalben laufen.«
Schwarzbart und einer seiner Kumpane traten mit erhobenen Waffen auf die beiden jungen Kreuzfahrer zu, die sich gleichzeitig mit einem plötzlichen Ruck aus den nachlässigen Griffen ihrer Wächter befreiten, nach links und rechts wegduckten und dann wieder aufrichteten, der eine mit einem Scheit aus dem Feuerkorb in der Hand, der andere mit einem Holzschemel.
»Halt«, befahl Richard. So viel Autorität lag in der Stimme, dass nicht nur seine beiden Ritter, sondern auch die des Herzogs von Österreich innehielten. »Habt Dank, Freunde.« Er trat unter leisem Kettenklirren zu seinen beiden Gefährten. »Wenn dies hier Gottes Wille ist, dann soll es eben geschehen. Doch ihr habt jetzt Wichtigeres zu tun, als sinnlos euer Leben wegzuwerfen, versteht ihr mich?«
Sie nickten stumm – sprachlos angesichts dieser tückischen Wendung, vor allem angesichts der rostigen Eisenschellen an den Händen und Fußknöcheln ihres Königs. Er sah erst dem einen, dann dem anderen in die Augen, seine Miene ernst, aber ein verräterisches Funkeln in den Augen. »Also geht mit Gott. Wenn ich es recht bedenke, möchte ich lieber nicht mit euch tauschen. Ich gehe lediglich in Festungshaft. Ihr hingegen müsst meiner Mutter erklären, wieso Ihr ohne mich heimkommt.«
ERSTER TEILHÖLLENPAKT1193–1194
Waringham, Januar 1193
»Na los, komm schon, Yvain«, rief Jean FitzEdmond. »Du schläfst mir doch hoffentlich nicht ein?«
Yvain warf ihm einen blitzschnellen Blick zu, ehe er wieder auf Rogers tanzende Klinge schaute, den Schild anhob und zum Konter überging. Klirrend trafen die stumpfen Übungsschwerter aufeinander, zweimal, dreimal, in schneller Folge, und die beiden Kontrahenten entließen gewaltige weiße Atemwolken in die kalte Winterluft.
Yvain stellte ungläubig fest, dass er Roger jetzt ganz allmählich zurückzwang. Fast hatten sie schon die Mitte des Sandplatzes erreicht.
Jean FitzEdmond blieb auf einer Höhe mit ihnen, wenn auch gut fünf Schritte zur Seite, um ihnen nicht ins Gehege zu kommen. »Gut so! Vergiss deine Deckung nicht, Roger. Und du beweg die Füße, Yvain. Wer den anderen entwaffnet, darf morgen mit zur Falkenjagd.«
Die beiden Knappen tauschten einen Blick, und innerhalb eines Wimpernschlages wurde aus Übung bitterer Ernst. Sie beide wollten diese Jagd.
»Auf Leben und Tod, de Lacy«, knurrte Yvain.
»Auf Leben und Tod«, stimmte Roger grimmig zu und ließ ohne jede Vorwarnung das Schwert auf Yvains Schild niedersausen.
Yvain spürte die Erschütterung bis in die Fußspitzen und erkannte voller Schrecken, dass sich doch nichts geändert hatte: Roger war immer noch stärker als er, haushoch überlegen. Wie hatte er sich nur einbilden können, er habe aufgeholt?
Rogers Schwerthiebe fielen wie Hammerschläge auf seinen Schild, und nun war Yvain derjenige, der zurückgedrängt wurde.
Alles wie gehabt, dachte er wütend, biss die Zähne zusammen und stemmte sich dem Ansturm entgegen, lauschte auf den Rhythmus, wich mit einer eleganten Vierteldrehung nach links, sodass Rogers nächster Stoß ins Leere ging, und griff ihn von der Seite an.
Aber Roger de Lacy – dieser gottverfluchte Hurensohn – hatte auf alles eine Antwort. Er parierte Yvains Finte mit beleidigender Mühelosigkeit, rammte ihm den Schild gegen die Schulter, und als Yvain den Schildarm abwinkelte, um das Gleichgewicht zu halten, stürzte Roger sich auf die Lücke in seiner Deckung wie ein Habicht auf eine lahme Ente. Yvain spürte einen Schlag vor die Brust wie den Stoß eines Rammbocks. Er landete auf dem Rücken im schneeverkrusteten Sand, die Arme ausgebreitet wie ein Gekreuzigter und regungslos, weil der Aufprall alle Luft aus seinen Lungen gepresst hatte.
»Gut gemacht, Roger!«, rief ihr Lehrer aufgeräumt, kam mit langen Schritten herüber und drosch dem Sieger auf die Schulter. »Wie beglückend, dass wenigstens einer von euch sich gelegentlich merkt, was ich euch beizubringen versuche.«
Seite an Seite standen sie turmhoch über Yvain und schauten auf ihn hinab, Jean mit verschränkten Armen und einem mitleidigen Lächeln auf den Lippen, Roger außer Atem, den Schild immer noch in Position, als rechne er damit, dass sein gefällter Gegner plötzlich aufspringen und wieder angreifen werde.
Mit verblüffender Plötzlichkeit fühlte Yvain Luft zurückströmen und befand, dass er hier lange genug wie ein hilfloser Käfer auf dem Rücken gelegen hatte. Er richtete sich auf und schlug die behandschuhten Fäuste in den Sand. »Mist!«
Roger und Jean gaben keinen Kommentar ab. Sie warteten.
Der Unterlegene kam mit einer verstohlenen Grimasse auf die Füße und verneigte sich vor seinem Bezwinger. »Wie es aussieht, muss ich noch ein wenig härter trainieren. Die Jagd gehört dir.«
Roger erwiderte die Verbeugung, wandte sich an den Lehrer und bemerkte: »Der Wettkampf war unfair. Ich bin zwei Jahre älter als er.«
»Auf dem Schlachtfeld kümmert das niemanden«, gab Jean verächtlich zurück. »Wer nicht lernt, einen stärkeren Gegner mit überlegener Technik zu besiegen, stirbt als sehr junger Held, schreibt euch das endlich hinter die Ohren. Außerdem seid ihr gleich groß.«
»Aber …«
Yvain legte Roger kopfschüttelnd die Hand auf den Arm. »Halt die Klappe. Ich fühle mich noch besiegter, wenn du Ausflüchte für mich vorbringst.«
Jean FitzEdmond lachte in sich hinein und klopfte auch dem jüngeren seiner Schüler kurz die Schulter. »Deine Schwertkunst mag noch nicht sehr entwaffnend sein, aber deine Aufrichtigkeit ist es allemal.«
»Sie rettet einen auf dem Schlachtfeld aber auch nicht«, gab der Junge düster zurück, bückte sich nach seinem verlorenen Schwert und wischte mit dem Ärmel Sand und Schnee von der matten Klinge.
»Wohl wahr«, räumte Jean augenzwinkernd ein.
Er war einer der jüngeren Ritter im Haushalt des Earl of Waringham. Die meisten seiner Altersgenossen waren mit dem König ins Heilige Land gezogen, aber Jean hatte aus Gründen, die er nicht preisgeben wollte, verzichtet. Yvain hatte manches Mal darüber gerätselt, was einen Ritter veranlassen konnte, sich die Ehre, den Ruhm, die Vergebung seiner Sünden und nicht zuletzt die Stundung seiner Schulden entgehen zu lassen, die ein Kreuzzug mit sich brachte, aber er war alles in allem froh, dass Jean zu Hause geblieben war. Denn er war ein guter Fechtlehrer, der seine Zöglinge mit dem Beispiel seiner eigenen vortrefflichen Waffenkunst inspirierte.
Er entließ sie mit einem nachlässigen Wink. »Das war alles für heute. Bringt die Ausrüstung in die Waffenkammer, und dann rauf in die Halle mit euch ans Feuer, eh ihr mir zu Eiszapfen werdet.«
Seit Neujahr vor gut einer Woche war kein Schnee mehr gefallen, aber der weite Himmel über Kent zeigte eine unheilschwangere, bleigraue Farbe, die nichts Gutes verhieß.
Yvain ging den Burghügel hinab und sah einen Bussard vorüberziehen und im Wald verschwinden. Unwillkürlich dachte er an die Beizjagd am folgenden Tag, die er versäumen würde. Sein Vater würde nicht begeistert sein. Jocelyn of Waringham war kein reicher Mann. Selbst wenn er einen Grafentitel besaß, war die Baronie doch viel zu klein, um Wohlstand einzubringen. Im Gegenteil, manchmal war es schwierig genug, Pferde, Rüstung, Waffen und Unterhalt für den Earl selbst und sein Gefolge zu bestreiten. Trotzdem hatte Jocelyn das teure Jagdrecht für die Wälder rund um Waringham von der Krone erworben, und Yvain vermutete, er hatte sich diese untypische Extravaganz geleistet, um seinen Söhnen eine höfische Erziehung bieten zu können, zu der eben auch die Jagd gehörte. Also würde er heute vermutlich die Stirn über den jüngeren seiner Söhne runzeln. Aber das machte nichts. Yvain war daran gewöhnt.
Der überfrorene Schnee knirschte unter seinen guten, wenn auch abgetragenen Stiefeln, als er den Mönchskopf überquerte. Oben auf der kahlen Kalksteinkuppe, welcher der Hügel seinen Namen verdankte, wehte es eisig. Mit der freien Hand schlang Yvain ungeschickt den Mantel fester um sich. In diesem Mantel konnte einem nicht einmal der bitterste Wind etwas anhaben, denn die dicht gewalkte Wolle war mit Kaninchenfell gefüttert. Nur seine Finger nahmen allmählich einen bedenklichen Purpurton an, vor allem an der Linken, die den vollen Wassereimer trug, und von seinen Zehen spürte er auch nicht mehr sonderlich viel, als er sein Ziel erreichte. Rechterhand des Mönchskopfes und ungefähr gleich weit von Dorf und Burg entfernt lag Waringham Heath, eine unberührte Heide, die sich in sachten Wellen bis zum Waldrand erstreckte. Niemand wusste so recht, warum der Wald dieses Land nicht erobert hatte. Lord Waringham sprach gelegentlich davon, dass er es unter den Pflug bringen wolle, aber der Boden war karg, erinnerte seine Gemahlin ihn dann regelmäßig, das Heidekraut und der Ginster, die dort wuchsen, störrisch und wehrhaft, wenn man sie auszumachen versuchte.
Waringham Heath war ungezähmt und für Yvain der schönste Flecken Erde auf der großen weiten Welt, selbst wenn er zugeben musste, dass er noch nicht viel von der großen weiten Welt gesehen hatte. Ein einzelner Baum erhob sich inmitten der Heide, eine knorrige Erle, die nie besonders anmutig gewesen war. Sie hatte sich im Wachstum vom Wind weggeduckt und in sich selbst verdreht und verschlungen. Natürlich nannten die alten Weiber sie einen Feenbaum, und das ganze Dorf war erschüttert gewesen, als letzten Sommer der Blitz hineingefahren war und den Feenbaum in schwarz verkohltes Totholz verwandelt hatte. Ein schlechtes Zeichen, hatte die alte Wilona gemunkelt, ein schlechtes Zeichen für ganz Waringham, für Dorf und Burg, für Mann und Maus.
Also hatte Yvain beschlossen, den toten Baum wieder zum Leben zu erwecken, um das böse Omen zu bannen, und zur allgemeinen Belustigung kam er jeden Tag her und kippte einen Eimer Wasser an die Erle. Heute war nicht das erste Mal gewesen, dass er das Eis auf dem Brunnen der Burg hatte zertrümmern müssen, um sein Wasser zu schöpfen, und die Belehrung der Burgwache, dass man Pflanzen im Winter nicht gießen müsse – tote erst recht nicht –, hatte er auch schon ein paarmal gehört. Das war ihm gleich.
Er leerte seinen Eimer am geschwärzten Stamm und bekam wie meistens ein paar Spritzer auf die Stiefelspitzen. Mit der Rechten strich er über die verkohlte, raue Borke. »Trink«, murmelte er. »Ich weiß, es schlummert noch Leben in dir, also trink und wach auf. Sag deinen Feen, sie sollen sich mal ein bisschen anstrengen. Ein einziger kleiner Trieb im Frühling, wie wär’s?«
Helles, zweistimmiges Gelächter hinter ihm ließ ihn zusammenfahren, und er wirbelte so hastig herum, dass ihm der Eimer aus der Hand fiel.
»Immer mit der Ruhe, wir sind’s nur«, sagte seine Schwester mit nachsichtigem Spott.
»Hast du gedacht, die Feen kämen dich holen?«, fügte Amabel lächelnd hinzu.
Yvain las den Ledereimer auf. Das war ein guter Vorwand, den Kopf abzuwenden, damit er ihr Lächeln nicht länger sehen musste. »Vielleicht ist es ja so, und ihr seid Feen, die sich unter die Sterblichen gemischt haben, um Schabernack zu treiben oder Unheil zu stiften«, argwöhnte er. »Was sonst könnten zwei junge Ladys hier in der Heide zu suchen haben?«
Sie hakten sich links und rechts bei ihm ein, und Amabel nahm ihm den Eimer ab. »Wir waren im Dorf bei Vater Cyneheard«, klärte sie ihn auf. »Die Frauen haben heute den Weihnachtsschmuck in der Kirche abgenommen, und eure Mutter hat uns geschickt, ihnen ein paar Früchtebrote zu bringen und zu helfen.«
»Der Berg aus verwelkter Stechpalme und Rosmarin, den wir in der Kirche zusammengekehrt haben, war höher als der Mönchskopf, das kannst du mir glauben«, behauptete Cecily.
»Ich fürchte, das kann ich nicht glauben«, widersprach er trocken und drückte ihr einen schnellen Kuss auf den rotblonden Schopf. Cecily war elf – vier Jahre jünger als er – und seit jeher Yvains Objekt zur Erprobung seiner ritterlichen Beschützerqualitäten gewesen. »Was gibt es Neues im Dorf?«
»Matthew der Schmied hat sich die Hand gebrochen.«
»Wie kann man sich während der Feiertagsruhe die Hand brechen?«, fragte Yvain erstaunt.
»Mit ein wenig Hilfe aus der Nachbarschaft«, antwortete Amabel. »Von Elfhelm, zum Beispiel.«
»Haben sie sich schon wieder geprügelt?«
Matthew der Schmied und sein Vetter Elfhelm stritten um den Besitz eines Ochsen, der vor zwei Jahren bei einem bierseligen Würfelspiel gesetzt worden war, und aus der anfänglichen Meinungsverschiedenheit war im Laufe der Zeit eine bittere Feindschaft geworden.
Amabel nickte. »Vater Cyneheard sagt, seine Lordschaft müsse ihnen ins Gewissen reden, ehe einer den anderen umbringt.«
Yvain gab keinen Kommentar ab, aber er dachte, dass es vermutlich nicht viel nützen würde. Die Bauern und Handwerker von Waringham hatten Respekt vor ihrem Lord, weil dessen Mutter eine angelsächsische Lady gewesen war und weil er mehr von der Landwirtschaft verstand als die meisten anderen Männer seiner Klasse. Sie nahmen die Mützen vom Kopf und lauschten andächtig, wenn er ihnen etwas zu sagen hatte. Aber sobald er den Rücken kehrte, machten sie doch wieder nur das, was sie für richtig befanden.
Cecilys Gedanken schienen in die gleiche Richtung zu gehen. »Mutter sollte sie sich vornehmen. Wenn überhaupt, werden sie eher auf sie hören.«
»Du hast recht«, stimmte Amabel zu. »Sogar in Hetfield fressen ihr die Bauern aus der Hand, und jedes Kind weiß, wie stur die Leute dort sind.«
Amabel stammte aus Hetfield, einem ansehnlichen Landgut, das südwestlich an Waringham grenzte. Ihr Vater hatte mit eiserner Hand über Gut und Bauern und auch über seine Tochter geherrscht, bis er mit dem alten König in den Krieg gezogen und gefallen war. Seine Frau war schon zwei Jahre zuvor gestorben, und Amabel – sein einziges Kind und somit seine Erbin – hatte der König als Mündel in die Obhut des Earl of Waringham gegeben, auf dass der sie mit seinem Sohn vermählen und die Landsitze zusammenführen konnte. Ein übliches und vollkommen vernünftiges Arrangement, wusste Yvain. Nur leider war nicht er derjenige, der Amabel heiraten würde. Das Mädchen aus Schnee und Ebenholz, wie seine Mutter sie wegen der schwarzen Haare und der makellos weißen Damenhaut nannte, war die Braut seines Bruders. Und ganz gleich, wie viele Nächte Yvain wachliegen und sich sehnlich wünschen mochte, es wäre anders – er konnte sie niemals bekommen.
Die beiden Mädchen berichteten ihm abwechselnd, was sie sonst noch an Neuigkeiten im Dorf gehört hatten. Wie meistens war nichts übermäßig Aufregendes dabei, aber das machte nichts. Yvain war vollauf damit zufrieden, dem Klang ihrer hellen Stimmen in der kalten, klaren Winterluft zu lauschen und dabei verstohlen in Amabels Nähe zu schwelgen. Er spürte ihre Hand ganz deutlich in seiner Armbeuge, obwohl die Berührung federleicht war.
Cecily machte sich von ihm los. »Es fängt an zu schneien!« Sie breitete die Arme aus, legte den Kopf in den Nacken und streckte die Zunge heraus, um eine Flocke zu erhaschen.
»Sehr damenhaft«, lobte der große Bruder.
Cecily zog die niedliche Stupsnase kraus. »Und wenn schon«, sagte sie, während sie wieder neben ihm einherstapfte. »Was soll ich im Kloster mit höfischen Manieren?«
»Äbtissin werden?«, schlug er vor.
»Oh ja. Das ist mir förmlich auf den Leib geschnitten«, gab sie lachend zurück.
Yvain sah seine kleine Schwester von der Seite an und versuchte zu ergründen, ob ihre Unbeschwertheit aufgesetzt war, aber er konnte keinerlei Anzeichen dafür entdecken. Am Tag ihrer Geburt hatte ihr Vater Cecily der Kirche versprochen – sie hatte also reichlich Zeit gehabt, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Bislang immer eine ferne Zukunftsaussicht, war ihr Eintritt ins Kloster indes mit einem unerwarteten Ruck nähergekommen, als ihr Vater ihnen an Weihnachten eröffnet hatte, dass er Cecily nach Wiltshire in die Abtei von Amesbury bringen werde, sobald der Schnee geschmolzen war.
Möge der Frühling dieses Jahr spät kommen, fuhr es Yvain durch den Kopf.
Die Halle von Waringham Castle war ein wundervoller Saal, der fast das gesamte erste Obergeschoss des mächtigen Bergfrieds einnahm. In den beiden mannshohen Kaminen in der Nord- und Südwand prasselten Feuer, aber nur wenig Rauch drang in den Raum – der Blick zur hohen Decke und der Galerie entlang der Ostseite, wo bei Festen die Spielleute musizierten, war ungetrübt.
Ein paar dienstfreie Wachen saßen am unteren Ende des linken Seitentischs über dampfende Bierbecher gebeugt, ein Stück weiter hockte die alte Edith mit ihrem unvermeidlichen Nähzeug und erzählte eine Geschichte. Ein halbes Dutzend Kinder saß links und rechts von ihr auf der Bank und lauschte gebannt, während drei andere Knaben lautstark mit zwei zotteligen Hunden im Bodenstroh balgten. Auf der gegenüberliegenden Seite saß Jean FitzEdmonds Frau, ein dickes Buch vor sich aufgeschlagen auf dem Tisch, und erteilte ihren beiden Töchtern und drei weiteren Kindern Leseunterricht, wobei sie in regelmäßigen Abständen finstere Blicke zu den lärmenden Bengeln mit den Hunden hinüberwarf. Zwei von Lord Waringhams Rittern brüteten über einem Schachbrett. Die hohe Tafel an der Stirnwand, die dem Earl und seiner Familie vorbehalten war, stand verwaist.
Dorthin führte Yvain seine beiden Begleiterinnen, und im Vorbeigehen rief er die Hunde mit einem Pfiff zur Ordnung. »Loki, Baldur, Schluss mit dem Getöse. Das gilt auch für euch Rabauken«, fügte er an die drei Knirpse hinzu. »Setzt euch zu Edith oder verschwindet nach draußen.«
Scheinbar geläutert trollten sie sich zur Tür, aber der Sohn des Stallknechts streckte hinter Yvains Rücken die Zunge heraus, ehe er auf der Treppe verschwand.
»Das hab ich gesehen, Tom«, rief Yvain ihm hinterher und folgte Amabel und seiner Schwester grinsend zur hohen Tafel. Kaum hatte er sich in seinen Sessel mit den verschlissenen Damastkissen gesetzt, kam Baldur zu ihm getrottet und legte die Schnauze auf seinen Oberschenkel.
»Wo stecken Vater und Mutter denn überhaupt?«, fragte Yvain.
Lady Waringham verbrachte einen Großteil ihrer Tage in der Halle, denn ihr oblag die Führung des Haushaltes, und hier kamen all jene zusammen, mit denen sie Dinge zu besprechen und zu regeln hatte. Der Earl war bei halbwegs erträglichem Wetter hingegen meist von früh bis spät auf seinen Besitzungen unterwegs, aber nicht an eisigen Wintertagen wie heute.
»Keine Ahnung«, gab Cecily zurück und sah sich um, als erwarte sie, dass ihre Eltern plötzlich hinter dem großen Wandteppich zwischen den Fenstern hervorkommen müssten. »Mutter ist wahrscheinlich in der Küche und macht Rowena die Hölle heiß, weil wir zu viel Räucherfisch verbrauchen.«
Yvain nickte und kraulte seinen Hund hinter den langen Schlappohren. Baldur kniff vor Wonne die Augen zu. »Eins ist sicher, wenn du nach Amesbury gehst, wirst du fürstlicher schmausen als hier und nicht den ganzen Winter geräucherten Hering vorgesetzt bekommen. Es heißt, es sei eins der reichsten Klöster in England.«
Cecily nickte und atmete tief durch. »Ich schätze, das ist ein Vorzug«, räumte sie ein. »Wie kommt es, dass die Abtei so reich ist?«
»Keine Ahnung«, musste ihr Bruder bekennen.
»Weil sie der königlichen Familie nahesteht«, erklärte Amabel. Sie ergriff einen runzeligen Apfel aus der Tonschale auf dem Tisch. »Das Kloster von Amesbury ist ein Ableger der Abtei von Fontevrault im Anjou, wo der alte König begraben liegt. Er hat die Niederlassung hier in England gegründet, darum hat die Abtei natürlich die besten Beziehungen und bekommt großzügige Erbschaften und so weiter.«
»Woher weißt du das?«, fragte Yvain verblüfft.
»Mein Vater brachte meine Mutter hin, ein paar Monate bevor sie starb«, erklärte Amabel. Sie legte den Apfel vor sich auf die Tischplatte und strich mit beiden Daumen über die raue Schale. »Die Äbtissin gilt als große Heilerin, die schon viele Schwindsüchtige kuriert hat. Aber Mutter nicht. Jedenfalls haben sie mir von Amesbury Abbey erzählt, als sie heimkamen. Es sei ein wundervolles Kloster, sagte Mutter.«
Amabel sprach nicht oft von ihren Eltern und ihrem Leben in Hetfield. Sie war zehn gewesen, als sie vor vier Jahren nach Waringham gekommen war, und sie hatte sich schnell eingelebt und war Teil der Familie geworden. Yvain hätte gerne gewusst, ob sie noch oft an ihre Eltern dachte. Ob sie sie vermisste. Aber irgendetwas warnte ihn, danach zu fragen.
»Vielleicht besuchst du mich dort einmal«, schlug Cecily vor.
»Das werde ich ganz bestimmt«, versprach Amabel. »Ich komme im Sommer, und dann können wir …« Sie brach ab, als der alte Hugh de Martigny an die hohe Tafel trat, der schon Yvains Großvater gedient hatte. »Dein Vater wünscht dich zu sehen, Junge«, richtete er aus.
Yvain blickte unwillkürlich zur Tür, aber keine Spur von Lord Waringham.
»Oben«, fügte der alte Ritter ominös hinzu.
Yvain tauschte einen Blick mit seiner Schwester.
»Hast du etwas ausgefressen?«, fragte Cecily.
»Bestimmt.« Er stand auf. »Ich weiß nur nicht, was.«
Das Gemach seiner Eltern war der schönste Raum der ganzen Burg. Auf der Südseite im Obergeschoss des Bergfrieds gelegen, bot es einen Blick auf den Garten, wo Lady Waringham die Heilkräuter für die Versorgung des Haushaltes züchtete. Im Frühjahr und im Sommer waren die Beete mit kleinen Blüten in allen nur erdenklichen Farben betupft, und der Wind trug manchmal die herrlichsten Kräuterdüfte herein.
Yvain klopfte an die massive Eichentür und trat ein. »Du hast nach mir geschickt, Vater?«
Zwischen dem Fenster und dem ausladenden Bett mit den geschlossenen Vorhängen stand ein klobiger Tisch, und dort saßen seine Eltern Seite an Seite. Das Bild erschien Yvain sonderbar. Sein Vater war ein rastloser, ungeduldiger Mann, für den Stillsitzen eine Strafe war. Seine Mutter war von früh bis spät auf den Beinen und meist in Eile, weil der Tag immer mehr Pflichten als Stunden für sie hatte. Yvain konnte sich nicht erinnern, seine Eltern an einem Werktag außerhalb der Mahlzeiten je so untätig gesehen zu haben. »Was ist das hier?«, fragte er argwöhnisch.
»Setz dich zu uns, mein Junge«, lud Lady Maud ihn ein, und die Geste, mit der sie ihm einen Schemel am Tisch anwies, wirkte seltsam abwesend. »Es ist gut, Anna, du kannst gehen«, sagte sie zu der Dienstmagd, die den Ipogras gebracht hatte. Der Krug stand unberührt auf dem Tisch und verströmte aromatischen Dampf.
Das Mädchen knickste und schlüpfte hinaus. Yvain hörte in seinem Rücken das verhaltene Poltern, mit dem die schwere Tür sich schloss. Er sah seinem Vater ins Gesicht. »Was ist passiert?« Er spürte sein Herz in der Kehle flattern, aber er achtete darauf, sich seine Furcht nicht anmerken zu lassen. »Ist es Guillaume?«
»Wie hast du das nur erraten, Bruder?«, kam eine vertraute Stimme hinter dem Bettvorhang hervor. Dann teilte sich der grüne Wollstoff, und zwei rissige Stiefel kamen zum Vorschein, ehe Guillaume vom hohen Bett ihrer Eltern stieg und mit ausgebreiteten Armen auf ihn zutrat. »Da bin ich.«
Erleichterung und Freude durchzuckten Yvain, doch ein Instinkt warnte ihn, seinen Jubellaut zu dämpfen. Er schloss die Lücke zwischen ihnen mit zwei Schritten und umarmte seinen lang entbehrten Bruder. »Oh, der Herr sei gepriesen! Du bist nach Hause gekommen …«
Guillaume legte ihm die Hände auf die Schultern. »Sieh dich nur an. Wie du gewachsen bist, Yvain! Du warst ein Knäblein, als ich fortging, und auf einmal bist du ein Kerl geworden.«
Yvain registrierte flüchtig, dass er tatsächlich nur noch einen halben Kopf kleiner war als sein Bruder, aber das war ihm im Moment völlig gleich. »Seit wann bist du zurück? Wie ist es dir ergangen? Wie geht es dem König? Wie war …«
»Ich fürchte, du wirst deine Neugier noch ein Weilchen zügeln müssen, Yvain«, unterbrach sein Vater. »Schenk uns ein. Und setzt euch hin, alle beide.«
Sie nahmen nebeneinander auf den beiden Schemeln ihren Eltern gegenüber Platz. Yvain füllte vier der Zinnbecher, die auf dem Tisch bereitstanden, aber er verschüttete ein paar Tropfen, weil er die Augen nicht von seinem Bruder nehmen konnte.
Guillaume war ein großgewachsener Mann von beinah sechs Fuß. Das gewellte, kinnlange Haar und der kurze Bart waren weizenblond, die bestürzend blauen Augen hatten ihr übermütiges Funkeln nicht verloren. Aber er wirkte hagerer, als Yvain ihn in Erinnerung hatte. Das Gesicht war gebräunt, und wenngleich Guillaume erst fünfundzwanzig war, hatte das gleißende Sonnenlicht im Heiligen Land sichtbare Krähenfüße in seine Augenwinkel gegraben. Das änderte indessen nichts daran, dass Guillaume ein auffallend gutaussehender Mann war. Der etwas zu breite Mund war von Natur aus zu einem Lächeln geformt und hatte schon so manche Frau schwach gemacht. Yvain vermutete, dass einige Väter und Ehemänner in Waringham erleichtert gewesen waren, als der junge Lord mit dem König ins Heilige Land zog.
Doch nun war er zurück.
»Guillaume ist letzte Nacht in aller Heimlichkeit nach Hause gekommen«, berichtete Jocelyn of Waringham seinem jüngeren Sohn, die sonst so volltönende Stimme gesenkt. »Über die Mauer, sodass nicht einmal die Nachtwache am Tor ihn gesehen hat.« Wie eh und je konnte er den Stolz auf die Tollkühnheit seines Ältesten nicht ganz verhehlen.
»Höchste Zeit, dass wir die Mauer erhöhen«, warf der ein.
Ihr Vater ließ sich nicht ablenken. »Er hat schlechte Neuigkeiten mitgebracht, Yvain: Der König ist auf der Heimreise einem seiner schlimmsten Feinde in die Hände gefallen, dem Herzog von Österreich.«
Yvain spürte einen heißen Stich in der Magengegend. Er stellte den unberührten, dampfenden Becher zurück und wandte sich an seinen Bruder. »Oh, Jesus. Wie konnte das passieren?«
»Alles ging schief«, antwortete Guillaume und zuckte die breiten Schultern. »Wir waren schon fast in Marseille, als ein entgegenkommendes Schiff uns warnte, Raymond de Toulouse liege auf der Lauer, um den König gefangenzunehmen und an Philippe von Frankreich auszuliefern. Also drehten wir nach Süden ab und versuchten, durch die Straße von Gibraltar zu segeln, aber der Wind blies uns die ganze Zeit ins Gesicht. Vermutlich eine göttliche Fügung, meinte Vater Jerome, denn es wäre gefährlich gewesen, an Philippes Küste entlangzusegeln und …«
»Augenblick«, unterbrach Yvain verständnislos. »Sind nicht König Richard und Philippe von Frankreich als die dicksten Freunde zusammen auf den Kreuzzug gegangen?«
Guillaume trank einen Schluck. Es war, als versuche er, Zeit zu gewinnen, um seine Worte mit Bedacht zu wählen – was ihm nicht ähnlich sah. »Die Freundschaft hielt bis Sizilien«, sagte er schließlich. »Dort verlobte Richard sich mit Berengaria von Navarra, statt sich für Philippes Schwester Alix aufzusparen, wie eigentlich versprochen. Als Philippe ihn an das Versprechen erinnerte, sagte Richard, Alix sei die Geliebte seines Vaters gewesen – was ja auch stimmt. Dafür gebe es Zeugen, sagte er, und wenn Philippe ihn nicht aus dem Versprechen entließe, werde er den Skandal öffentlich machen.«
»Er hat ihn erpresst und ohne Not gedemütigt«, warf ihr Vater stirnrunzelnd ein. »Wie er es ja so gerne tut.«
Guillaume strich sich ein wenig ratlos mit dem Handrücken über den Bart. »Vielleicht. Jedenfalls … war es von da an vorbei mit der innigen Freundschaft. Philippes Zorn ist unversöhnlich. Deshalb blieb uns der direkte Seeweg nach England versperrt. Also beschloss Richard, um Italien herumzusegeln und auf dem Landweg heimzukehren. Aber vor Aquileja soffen wir ab. Die meisten schafften es an Land, doch weil wir in feindlichem Gebiet gestrandet waren, beschloss Richard, als Pilger verkleidet mit nur zwei Gefährten weiterzureisen. Das waren Maurice de Clare und ich. In der Nähe von Wien erwischte uns Leopold von Österreich, legte den König in Ketten und ließ Maurice und mich laufen. Das war kurz vor Weihnachten. Wohin sie ihn gebracht haben, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was Leopold mit ihm tun wird, aber auf Seidenkissen betten wird er ihn nicht, denn seit der Belagerung von Akkon hegt der Herzog einen bitteren Groll gegen ihn.«
»König Richard hat ein bemerkenswertes Talent, sich Feinde zu schaffen«, warf ihre Mutter ein.
»Wie jeder König, der sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt, oder?«, konterte Guillaume. »Jedenfalls steckt er jetzt so richtig in der Klemme: Leopold wird ihn an den Meistbietenden verhökern. Richards Feinde werden Schlange stehen, um ihn in die Finger zu bekommen. Und nach dem, was du mir berichtest, Vater, dürfen wir Prinz John wohl getrost zu Richards Feinden zählen«, schloss er und stieß hörbar die Luft durch die Nase aus.
»Und was jetzt?«, fragte Yvain in die kurze Stille hinein.
»Jetzt muss Guillaume so schnell wie möglich an den Hof, um der Königinmutter zu berichten, was passiert ist«, antwortete Jocelyn. »Und zwar inkognito. Niemand außer ihr darf ihn sehen oder von der Gefangennahme des Königs erfahren, vor allem Prinz John nicht.«
»Was ist mit diesem Maurice de Clare?«, wollte Yvain wissen. »Wird er dichthalten?«
Guillaume nickte. »Normalerweise würde ich nicht unbedingt mein letztes Hemd auf seine Diskretion verwetten, aber sein Gaul ist kurz vor Gent auf vereister Straße gestürzt, und beide haben sich ein Bein gebrochen. Ich musste ihn in einem Kloster zurücklassen. Er wird wieder, sagen die Mönche, aber es kann ein paar Wochen dauern.«
»Und das Pferd?«
Guillaume schüttelte den Kopf. Dann streckte er die Rechte aus und fuhr Yvain ruppig über den Schopf. »Immer noch der Pferdejunge, was?«
Yvain zog mit einem kleinen Ruck den Kopf weg. Er erinnerte sich plötzlich daran, dass Guillaumes Gönnerhaftigkeit ihm früher manchmal auf die Nerven gegangen war. Das hatte er in den zweieinhalb Jahren, die sein Bruder fortgewesen war, doch tatsächlich vollkommen vergessen. Und es beschämte ihn ein wenig, dass es keine Viertelstunde gedauert hatte, ehe sein Unwillen sich wieder eingestellt hatte, der vermutlich nur aus Neid geboren war. Denn Guillaume war ein Held. Ein Kreuzfahrer von solchem Ruhm, dass der König unter all seinem Gefolge ausgerechnet ihn ausgesucht hatte, um die gefährliche Heimreise mit ihm anzutreten. Yvain hätte nicht gewusst, was er anfangen sollte, wenn sein Begleiter bei Schnee und Eis mitten in der Fremde einen Reitunfall erlitt und sich das Bein brach. Er argwöhnte, dass er sich an den Wegesrand gesetzt hätte und beim Warten auf einen guten Samariter erfroren wäre …
»Wir haben einen Plan gefasst, bei dem wir deine Hilfe brauchen«, eröffnete Lady Maud ihm.
»Was für ein Plan?«
»Wir haben gute Neuigkeiten für dich, Yvain«, sagte Lord Waringham, aber er sah irgendwie nicht besonders glücklich aus. »Hast du je von der ›Armen Ritterschaft Christi und des salomonischen Tempels zu Jerusalem‹ gehört?«
Yvain starrte seinen Vater ungläubig an. »Ich soll ein Templer werden?«
»Schsch, nicht so laut«, warnte Jocelyn. »Es ist der berühmteste Ritterorden der ganzen Christenheit, eine Aufnahme zu erlangen daher ein Privileg, das nur wenigen zuteil wird. Aber Robert de l’Aigle, der Bruder deiner Mutter, gehört dem Orden an und ist bereit, sich für dich zu verwenden. Was sagst du dazu?«
Yvain sagte erst einmal gar nichts. Ihm war plötzlich ziemlich warm geworden, wenngleich die kleine Kohlenpfanne unter dem Tisch der eisigen Kälte im Raum nicht viel entgegenzusetzen hatte. Er saß mit gesenktem Kopf auf seinem Schemel, die Hände lose auf den Knien, und dachte nach. Er hatte immer davon geträumt, eines Tages ein gefeierter Ritter wie Guillaume zu werden und an König Richards Seite in den heiligen oder irgendeinen anderen Krieg zu ziehen. Darum stellte er sich jeden Tag auf den Sandplatz unten im Hof, egal ob Schneesturm oder Sonnenschein, und trainierte immer mit den größeren und älteren Knappen im Haushalt seines Vaters: Weil er so schnell wie möglich so gut werden wollte, wie er konnte. Aber ein Ritterorden?
»Es ist eine große Ehre, die dir zuteilwird«, sagte sein Vater. Es klang barsch.
»Ich weiß. Aber hab ich sie auch verdient? Ich hatte nie das Gefühl, berufen zu sein.«
Jocelyn winkte ab. »Was spielt das für eine Rolle? Du weißt, ich kann dir kein Land vererben. Also wenn du nicht eines Tages als landloser Ritter von der Mildtätigkeit deines Bruders leben möchtest, solltest du nicht lange überlegen.«
»Doch«, kam Guillaume seinem Bruder zu Hilfe. »Er sollte überlegen. Lange und vor allem gründlich.« Sein Ausdruck war mit einem Mal untypisch grimmig. »So groß die Ehre auch sein mag, bedeutet es ein Gelübde, das man nicht leichtfertig ablegen sollte: Armut. Gehorsam. Und Keuschheit.« Er schnitt eine Grimasse, die so urkomisch war, dass Yvain lachen musste.
»Der Schutz der Pilger mag ein hehres Ziel sein«, fuhr Guillaume fort, »aber die Templer verlangen große Opfer von den Ihren. Und wenn ich euch die ungeschminkte Wahrheit sagen soll: Der ganze Kreuzzugsgedanke ist eitel. Schlimmer, er ist Wahnsinn.«
»Was König Richard bedauerlicherweise nicht davon abgehalten hat, England zu schröpfen, um dieses Abenteuer zu finanzieren, nur um dann auf dem Heimweg verloren zu gehen«, entgegnete Lord Waringham. »Im Übrigen wirst du ketzerische Reden in meinem Haus gütigst unterlassen.«
Guillaume schlug die Beine übereinander und nahm einen ordentlichen Zug aus seinem Becher, um zu bekunden, dass er nicht sonderlich beeindruckt war. »Ich will nicht respektlos sein, Mylord, aber ich war zwei Jahre im Heiligen Land und habe gesehen, wie Christen und Heiden sich gegenseitig abgeschlachtet haben, um einen verdorrten Sandhügel zu erobern oder zu verteidigen, und am Ende hatten wir außer einem Leichenberg nichts vorzuweisen. Der König ist anderer Meinung, und wenn er je wieder auf freien Fuß kommt, wird er ins Heilige Land zurückkehren, so schnell er nur kann. Aber mal ehrlich: Er hat jede Belagerung und jede Schlacht auf diesem Kreuzzug gewonnen und den verdammten Krieg trotzdem verloren. Wenn nicht einmal er Jerusalem zurückerobern konnte, wer soll es dann bewerkstelligen? Er hat einen Friedensvertrag mit Saladin geschlossen, der christlichen Pilgern freien Zugang zu den heiligen Stätten garantiert, und auch wenn sein Zorn über diesen schmählichen Frieden ihn fast umgebracht hat, war es doch eigentlich das, was wir alle wollten, oder?«
Lord Waringham bedachte ihn mit einem Stirnrunzeln väterlicher Missbilligung. Er war kein Mann, dem man sich leicht widersetzte: Ende vierzig, höchstens zwei Zoll kleiner als sein Erstgeborener, mit grauen Schläfen und Silberfäden im dunkelblonden Bart. Vom linken Augenwinkel verlief eine schmale Narbe abwärts über die Wange, bis sie sich im Bart verlor, und erinnerte an die Zeiten, da Jocelyn of Waringham zusammen mit dem berühmten William Marshal dem Jungen König gedient hatte, Richards älterem Bruder, der ihrem Vater auf den Thron gefolgt wäre, hätte ihn nicht die Ruhr geholt. Jocelyn of Waringham hatte in Schlachten und Turnieren gekämpft, solange er musste, aber keinen Tag länger. Yvain wusste nicht, warum genau sein Vater der Welt des Hofes und der Mächtigen den Rücken gekehrt hatte, doch bald nach dem Tod des Jungen Königs war er nach Hause gegangen, um sich seinen Besitzungen und seiner Familie zu widmen. Waringham, wusste Yvain, kam für seinen Vater immer an erster Stelle, und von seinen Kindern erwartete der Earl deshalb die Bereitschaft, ihre persönlichen Wünsche den Belangen ihres Hauses unterzuordnen.
Er tippte auf eine versiegelte Pergamentrolle, die vor ihm auf dem Tisch lag. »Hör zu, Yvain. Dies ist ein Empfehlungsschreiben deines Onkels Robert an Geoffroy FitzStephen, den Meister der englischen Templer. Wie der Zufall es will, ist FitzStephen gerade als Gast der Königinmutter bei Hofe. Du wirst mit Guillaume zusammen aufbrechen, sobald es völlig dunkel ist, damit niemand in Waringham deinen Bruder sieht. Du reitest nach Winchester, überbringst dem Meister der Templer das Schreiben und bittest höflich um Aufnahme. Guillaume wird dein unauffälliger Begleiter sein, dein Diener vielleicht, ungerüstet und in einfachen Kleidern. Es ist seine beste Chance, unerkannt zur Königinmutter zu gelangen, verstehst du?«
Yvain nickte. »Soll ich … Soll ich um sofortige Aufnahme ersuchen?«, fragte er, und er war einigermaßen zufrieden mit sich, weil es gelassen geklungen hatte. In Wirklichkeit jagte die Vorstellung ihm eine Heidenangst ein, dass dieser Tag das Ende all dessen sein könnte, was ihm lieb und vertraut war.
»Nein, nein«, beruhigte sein Vater ihn. »FitzStephen wird dich wissen lassen, wann du dich wo einzufinden hast. Bis es so weit ist, kommst du wieder nach Hause.«
Danke, Jesus, dachte Yvain und atmete verstohlen auf. Er wandte sich an seinen Bruder. »Lass uns bis zwei Stunden vor Mitternacht warten. Dann können wir sicher sein, dass ganz Waringham schläft – alle bis auf die Torwache zumindest –, und gehen über die Mauer, so wie du gekommen bist.«
Guillaumes Augen funkelten. »Das nenn ich einen Löwenritter!«, lobte er und drosch seinem Bruder auf die Schulter, dass Yvain beinah vom Schemel gekippt wäre.
Der Jüngere verdrehte die Augen. In den Geschichten um König Artus war Yvain der Ritter, der den Löwen vor der Schlange gerettet und anschließend gezähmt hatte. Selbst unter den ruhmreichen Männern der Tafelrunde war er ein gefeierter Held. Und solange Yvain of Waringham denken konnte, hatte man ihn mit diesem Namensvetter angespornt oder gemessen oder aufgezogen, je nachdem. Er fand, es reichte eigentlich, einen Bruder wie Guillaume zu haben, aus dessen Schatten zu treten er kaum je erhoffen konnte. Ein zweiter, obendrein arthurischer Schatten wäre wirklich nicht nötig gewesen …
»Es tut mir leid, dass wir dich so plötzlich damit überfallen, Yvain«, sagte Lady Maud. »Dein Vater und ich sind schon letztes Frühjahr nach Pevensey geritten, als mein Bruder gerade aus dem Heiligen Land zurück war, und haben ihn um seine Empfehlung für dich gebeten. Er hat sie bereitwillig gewährt, und wenn du ihm begegnest, wirst du feststellen, dass du einen klugen und wohlwollenden Mentor hast. Von humorvoll ganz zu schweigen.«
Ein Lächeln huschte bei der Erinnerung an diesen Bruder über ihr Gesicht und strahlte einen Moment in ihren Augen. Auch mit vierzig Jahren und nach sechs Schwangerschaften war seine Mutter immer noch eine schöne Frau, fand Yvain. Das Gebende unter dem hüftlangen Schleier, das ihr Kinn und den Ansatz der rotblonden Haare bedeckte, verlieh ihr einen Anstrich von Strenge, aber die freche Stupsnase mit der Prise unverwüstlicher Sommersprossen links und rechts war näher an der Wahrheit. War Lady Waringham auch eine stolze Dame aus altem normannischen Adel, hatte sie das nie davon abgehalten, mit ihren Kindern im Heu zu toben oder zum Fischen zu gehen. Sie konnte in Fragen von Ehre und Anstand ebenso unerbittlich sein wie Lord Waringham, aber für ihre Kinder ebenso wie für Gesinde und Hörige des Gutes war sie oft Vermittlerin und Fürsprecherin. Sie vergötterte ihren Gemahl – liebte ihn vermutlich mehr als jedes ihrer Kinder –, aber sie war wohl der einzige Mensch in Waringham, der keine Ehrfurcht vor ihm empfand.
»Wenn du zurück bist, werden wir dir in Ruhe erklären, warum wir glauben, dass dieser Weg der richtige für dich ist.«
»Schon gut«, versicherte Yvain verlegen.
Sein Vater hatte ihm die wahren Gründe ja bereits genannt. Für ihn gab es kein Land. Auf eine reiche Erbin konnte er auch nicht hoffen, denn ihr Geschlecht war zu unbedeutend, um einen Vater oder Vormund zu ködern. Seine Eltern hätten ebenso gut beschließen können, ihn ins Kloster zu stecken. Also dann doch lieber ein Ritterorden, befand Yvain.
Winchester, Januar 1193
»Mein Name ist Yvain of Waringham, ich bringe eine Nachricht für Geoffroy FitzStephen, den Meister der Templer.«
Eine der Wachen löste sich aus dem Windschatten am Tor, trat näher und warf einen Blick auf das Siegel, das Yvain ihm hinhielt.
Er winkte ihn durch. »Sein Quartier ist im Ostturm, aber wahrscheinlich findet Ihr ihn um diese Zeit in der Halle«, sagte er hilfsbereit. »Euer Bursche kann versuchen, im Stall dort drüben noch Platz für Eure Tiere zu finden. Es ist allerdings ziemlich voll hier im Moment, also wenn Ihr nicht lange bleibt, bindet sie gleich vor der Halle an. Aber dann lasst Euren Burschen Wache stehen – Ihr glaubt ja nicht, wie viele Gäule hier verschwinden. Auf Nimmerwiedersehen.«
»Danke.« Yvain drückte Guillaumes herrlichem Fuchs, der ihn vortrefflich nach Winchester getragen hatte, sacht die Fersen in die Seiten und ritt durchs Tor.
Sein »Bursche« folgte auf einem Maultier. »Wurd auch Zeit«, knurrte er gedämpft. »Man kann seine Tarnung auch übertreiben, scheint mir. Ich dachte, ein Schiff sei die grauenvollste Art zu reisen, aber der Rücken eines Mulis steht dem in nichts nach.«
Yvain biss sich grinsend auf die Unterlippe. »Komm schon, du beleidigst die arme Pansy. Sie ist ein wackeres altes Mädchen. Und mutiger als jedes Pferd. Letzten Herbst hat sie Cecily gegen einen wilden Hund verteidigt, ob du’s glaubst oder nicht.«
»Da sie dir so teuer ist, hast du ja sicher keine Einwände, wenn wir für den Heimweg wieder tauschen«, konterte Guillaume gallig.
Ein Knecht kam aus dem gedrungenen Stallgebäude geschlurft, sodass Yvain eine Antwort erspart blieb.
Wegen der winterlichen Straßen hatten sie drei Tage für die Reise nach Hampshire gebraucht, aber das Wetter war ihnen einigermaßen hold gewesen. Bis auf ein paar Schauer hatte es nicht geschneit, nur der scharfe, eisige Wind hatte sie stetig begleitet. Die erste Nacht hatten sie in einer Scheune unweit von Tonbridge verbracht und jämmerlich gefroren, die zweite komfortabler in einem Gasthaus in Guildford, und an den Abenden ebenso wie während der langen Stunden im Sattel hatten die Brüder Gelegenheit gefunden, zu reden und wieder vertraut miteinander zu werden.
Guillaume hatte alles wissen wollen, was während seiner Abwesenheit in Waringham passiert war, woran der alte Gaston de Falaise und die Müllerin gestorben waren, wie die Ernten verlaufen waren und natürlich alles über seine Verlobte. Yvain wusste, dass es kindisch war, aber er war seltsam unwillig gewesen, Guillaume von Amabel zu berichten.
Als weitaus unwilliger erwies sich indes Guillaume, wann immer Yvain ihn drängte, vom Kreuzzug zu erzählen. Als der jüngere Bruder das stichhaltige Argument vorbrachte, dass er doch nun selber ein Kreuzritter werden solle und nicht ahnungslos vor Geoffrey FitzStephen erscheinen wolle wie das Lamm an der Schlachtbank, gab Guillaume nach, aber er beschränkte sich auf die Heldentaten des Königs: seine fast beiläufigen Eroberungen von Sizilien und Zypern auf dem Weg nach Palästina. Die Belagerung von Akkon, die jahrelang auf der Stelle getreten hatte, aber kaum führte Richard sie an, fiel die mächtige Hafenstadt nach nur einem Monat. Dann die Schlacht von Arsuf – um die sich schon etliche Legenden rankten, wenngleich sie erst eineinhalb Jahre zurücklag –, bei der Richard seinem geliebten Feind Saladin eine erdrückende Niederlage beigebracht und die gesamte Küstenregion bis hinunter nach Jaffa gesichert hatte.
Yvain hatte der Aufzählung königlicher Ruhmestaten ein wenig ratlos gelauscht, denn so sehr er sich auch bemühte, stellten sich keine Bilder ein, kein Eindruck davon, wie es im Heiligen Land wirklich gewesen war. Dabei war Guillaume früher immer so ein großartiger Geschichtenerzähler gewesen, den ihre Mutter regelmäßig mit einem Räuspern zur Ordnung rufen musste, wenn er sich in Fahrt redete und die Tatsachen zu sehr mit den Gebilden seiner Phantasie ausschmückte. Doch das Heilige Land, so schien es, hatte den Quell dieser Phantasie ausgetrocknet.
Guillaume wies mit dem ausgestreckten Arm auf die andere Seite des großzügigen Innenhofs. »Dort drüben. Lass uns gehen, eh wir hier festfrieren.«
Er zog sich die Kapuze seines fadenscheinigen Mantels tief ins Gesicht und folgte Yvain zu der großen, aber altmodischen Fachwerkhalle auf der Westseite der Anlage. Im Hof regte sich so gut wie nichts, nur ein paar Mägde und Knechte begegneten ihnen, die Köpfe gegen den schneidenden Wind gesenkt.
Am Eingang der großen Halle wurde Yvain wieder anstandslos vorgelassen, sobald er das Siegel seines Onkels präsentierte. Im Innern des dämmrigen Saals standen fein gekleidete Höflinge und Geistliche in kleinen Gruppen um das muntere Feuer in der Mitte herum, während die Diener die Tafeln für das Nachtmahl aufbockten und lange weiße Tischtücher darauf ausbreiteten. Die wenigen Fenster waren mit Holzläden verschlossen. Hohe schmiedeeiserne Kerzenleuchter standen in kurzen Abständen entlang der Wände und ließen die Goldfäden in den kostbaren Tapisserien funkeln.
Yvain brauchte den gewisperten Hinweis seines Bruders nicht, um die Königinmutter zu erkennen. Aliénor von Aquitanien stand ein wenig abseits der Höflinge vor dem verwaisten Marmorthron am Ostende der Halle, die Hände auf einem Gehstock verschränkt, dessen Knauf ein goldener Löwenkopf war. Sie war eine uralte Dame von siebzig Jahren, hatte Yvain gehört, aber ihre Haltung war kerzengerade und königlich. Sie schien den Ausführungen eines Bischofs zu lauschen, der respektvoll, vielleicht sogar eine Spur nervös vor ihr stand, aber ihr Blick glitt dabei geruhsam durch den Saal. Als er auf Yvain verharrte, fühlte der Junge die Kraft ihrer Persönlichkeit, so wie man die Hitze eines Feuers spürt, dem man sich nähert. Nie zuvor war er einem Menschen mit solch einer Ausstrahlung begegnet, aber sie machte ihn mutig statt scheu.
Er trat unaufgefordert näher, sank vor der Königinmutter auf ein Knie und fiel dem Bischof rüde ins Wort: »Vergebt mir, meine Königin, aber meine Nachrichten dulden keinen Aufschub«, sagte er auf Französisch. »Mein Name ist Yvain of Waringham, und ich bringe Neuigkeiten aus Hodierna.«
Es funktionierte, genau wie Guillaume vorhergesagt hatte. Hodierna war nämlich keineswegs ein Ort, sondern der Name von König Richards Amme gewesen, und die alte Königin erkannte ihn sofort. Nichts rührte sich indes in ihrem runzligen Gesicht, in welchem die strahlend blauen Augen wirkten wie Seen in einer Felslandschaft. Tiefe Seen, womöglich gefüllt mit eisigem Wasser, still an der Oberfläche, unergründlich darunter.
»Ich fürchte, wir müssen unsere Unterhaltung später fortsetzen, mein lieber FitzStephen«, entschuldigte sie sich bei ihrem Gesprächspartner. »Aber dies hier ist wichtig.«
Yvain erkannte mit sinkendem Herzen, dass es keineswegs ein Bischof, sondern sein künftiger Dienstherr war, den er so unhöflich unterbrochen hatte. Der Meister der englischen Templer streifte den knienden Jüngling mit einem angemessen frostigen Blick, verneigte sich vor der Königinmutter und ging mit langen Schritten davon.
Fabelhaft, dachte Yvain und spürte einen feinen Schweißfilm auf der Stirn.
»Folgt mir, Waringham«, sagte Aliénor, und während sie sich abwandte, streifte sie Guillaume mit einem flüchtigen Blick. »Bringt Euren Diener mit.«
Sie nahm den Stock in die Rechte, während sie zu einer diskreten Seitentür ging, aber weder hinkte sie, noch konnte man ausmachen, dass sie einer Stütze bedurfte. Sie führte die Brüder einen zugigen Korridor entlang zu einer Treppe, die in die über der Halle gelegenen Privatgemächer führte. Der Wachsoldat vor der ersten Tür verneigte sich vor Aliénor und öffnete ihr. Sie gelangten in eine kleine, behagliche Halle, wo ein lustiges Feuer seine tröstende Wärme an leere Brokatsessel verschwendete, und weiter durch die nächste Tür in einen ebenso großen und kostbar eingerichteten Raum mit einem Bett, dessen geschlossene purpurne Vorhänge mit Greifen und Drachen und noch absonderlicheren Fabelwesen bestickt waren, deren Namen Yvain nicht kannte. Das ausladende Kohlebecken auf dem Fußboden verströmte nicht nur angenehme Wärme, sondern ebenso einen dezenten, betörenden Duft, weil irgendwelche Essenzen auf die Holzkohle geträufelt worden waren.
Die alte Königin setzte sich auf den mit kostbaren Pelzen gepolsterten Fenstersitz, verschränkte die Hände auf dem Goldknauf und sah unverwandt zu Guillaume. »Zeigt mir Euer Gesicht.«
Er hob beide Hände, langsam, als graue ihm vor diesem Moment der Wahrheit, und schob die Kapuze zurück.
»Guillaume of Waringham«, sagte sie. Es war eine nüchterne Feststellung, klang weder überrascht, erfreut noch besorgt.
»So ist es, Madame.« Er schluckte sichtlich. »Euer Sohn lebt und ist unversehrt. Aber in Gefangenschaft.«