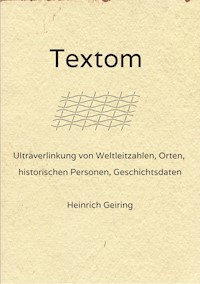
9,99 €
Mehr erfahren.
Das Buch beschreibt, wie Sie mit Tabletcomputer und zugehörigem digitalen Material Lerngewohnheiten von täglich wenigen Minuten entwickeln, die nach und nach Ihr Wissen spielerisch stabilisieren und erweitern. Beim Lernen durch Selbstabfrage wird Ihr Gehirn nicht durch ständigen Input verstopft, sondern Sie werden wesentlich schneller im Abruf von Wissen. Sie erfahren, warum Sie so schnell vergessen, was Sie gelesen oder gehört haben. Mit dem Textom können Sie meist mit einem Klick Ihr Wissen überprüfen oder auffrischen; aufwändiges Suchen von Fakten entfällt. Mit Textom werden Sie beim Lernen nicht gegängelt: Sie haben an jeder Stelle eine Vielzahl von Möglichkeiten, einen anderen Lernpfad einzuschlagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Textom:
Ultraverlinkung von Weltleitzahlen, Orten,
historischen Personen, Geschichtsdaten
Textom
Ultraverlinkung von
Weltleitzahlen, Orten,
historischen Personen,
Geschichtsdaten
Heinrich Geiring
Wie im angelsächsischen Raum seit langem üblich, wird hier häufig das generische Maskulinum verwendet, denn die Gleichheit der Geschlechter kann nur durch gleiche Benennung gefördert werden, nicht durch permanente Nennung der geschlechtlichen Unterschiede. Eine Schauspielerin ist jenseits des Ärmelkanals selbstverständlich "actor" und nicht "actress". Ziel kann deshalb nur sein, die Bedeutung des generischen Maskulinums zu ändern und nicht die Schreibweise durch Sonderzeichen zu verhunzen. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat 2021 "die Aufnahme von Asterisk ("Gender-Stern"), Unterstrich ("Gender-Gap"), Doppelpunkt oder anderen verkürzenden Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinneren" nicht empfohlen. Dem Rat gehören Sprachexperten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol, Liechtenstein und Belgien an.
Impressum
© 2022 Heinrich Geiring, D-88316 Isny im Allgäu, [email protected]
Typoskript: erstellt mit OpenOffice Writer, zuletzt geändert 04.05.2022
Covergestaltung: H. Geiring mit Tool von
Abbildungen: H. Geiring mit ASCIIMathML.js von Peter Jipsen, chapman.edu
Haftungsausschluss: Buch und zugehöriges digitales Material machen nur Vorschläge, wie Aussagen über die Welt in leichter lernbarer Form digital verknüpft und dargestellt werden könnten. Auf die Richtigkeit dieser mehr als 5000 Vermutungen über die Welt wurde aus Mangel an enzyklopädischer, biografischer, geografischer und historischer Kompetenz wenig geachtet. Eine Haftung des Autors für jegliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die sich aus der fälschlichen Annahme der Richtigkeit des Materials (der Aussagen über die Welt) und aus den Änderungsvorschlägen ergeben, ist daher ausgeschlossen.
Druck und Distribution im Auftrag von H. Geiring: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
ISBN
978-3-347-61033-0
978-3-347-61035-4
Softcover
E-Book
„Und in der Tat hat ja alles, was manerkennen kann, eine Zahl.
Denn ohne sie lässt sich nichts erfassenoder erkennen.“
Der Pythagoreer Philolaos (u-470: u-398)
nach Hermann Diels:
'Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch',
Band 1, Berlin 1903, S. 250
Dieses Buch bezieht sich häufig auf die
installationsfreie HTML-Datei
geiring.de/nb
(genauer: http://www.geiring.de/nb/Index.html, ca. 8 MB),
die hier → Notizbuch oder → Textom genannt wird,
und die mit Browser Chrome auf
Tabletcomputer und Desktop getestet wurde.
Inhaltsverzeichnis
1 Merken und Vergessen
2 Kompression und Expansion
3 Textoperatoren: Handelnde Worte
4 Netzwerk Gehirn
5 Selbstabfrage, nicht ohne Major-System
6 Relative Lage (ohne Major-System)
7 Der PC: Webstuhl für menschliches Wissen
8 Textom als Ultraverlinkung
9 Lernen im digitalen Zeitalter
10 Paradigmen und Vorschläge
Glossar
Der Pfeil → verweist auf eine Erläuterung im Glossar ab S. 140.
1
Merken und Vergessen
Im Zeitalter des Internets scheint das Merken von Fakten völlig überflüssig geworden zu sein, weil es so einfach ist, Fakten mit ein paar Klicks aus dem Datenhimmel zu holen.
Dennoch ist in vielen Situationen und Umgebungen der Griff nach dem Smartphone nicht möglich oder nicht erwünscht, oder das Internet kann in digitalen Entwicklungsregionen nicht erreicht werden.
Um Gesprächen inhaltlich folgen zu können, Nachrichten oder Vorträge zu verstehen, ist es oft schon rein zeitlich nicht möglich, Informationen im Internet zu suchen, weil der Vortrag oder die Nachrichten bereits weitergegangen sind, die Eingabe auf Smartphone oder Tablet aber doch zeitaufwändiger ist.
Meine Gesprächspartner merken sehr schnell, ob ich souverän bin, oder ob ich alles zuerst nachschlagen (oder bei Google nachfragen) muss.
Je mehr unbekannte Wörter, Variable, ein Satz enthält, umso weniger verstehe ich.
Im folgenden gehen wir davon aus, dass Faktenwissen über Orte, Personen und Geschichte sehr nützlich sein kann und wir hinterfragen dieses Ziel nicht weiter, wohl wissend, dass Lehrpläne und Bildungsstandards das Ziel Auswendiglernen, Faktenwissen als mittelalterlich vermeiden bzw. tabuisieren.
Wir legen eine Methode dar, stressfrei mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele grundlegende Fakten zu lernen.
In der bekannten sechsstufigen Taxonomie der kognitiven Lernziele der Psychologengruppe um Benjamin Bloom kümmern wir uns nur um die unterste Stufe assoziatives "Wissen" und überlassen den Bildungsinstitutionen die fünf höheren Ziele.
Assoziatives Wissen ist zweiteilig: Frage und Antwort, F&A:
Frage: 3. Monat im Jahr?
Antwort: März
Frage: Vorname von Einstein?
Antwort: Albert
Frage: Einwohnerzahl USA?
Antwort: ca. 332 Millionen
Die Antwort ist der Frage zugeordnet, assoziiert, deshalb einfaches, assoziatives Wissen.
Assoziatives Wissen ist die Grundlage für das Verständnis von Zigtausenden höherer Konzepte wie Variable, relative Adresse, Excel-Funktion, Personalisierte Verhältniswahl, Axiomatik, Regulärer Ausdruck, forensische Medizin, Virusgenom, Impfstoffherstellung, Quantenphysik, Neuronales Netz und, und, und.
Für die Wissensaneignung auf dem untersten Level genügen Maschinen, für die fünf höheren Ziele sind Lehrkräfte zur Vermittlung meist unverzichtbar.
Unser Ziel ist nicht, die Erde untertan1 zu machen, sondern Computer untertan zu halten, dass sie nicht über uns bestimmen, sondern wir über sie.
Insbesondere, was Geschehnisse an entfernten Orten auf dem Globus betrifft, sollte man eine grobe Vorstellung haben, wo sich ein Ort befindet, dessen Name man hört oder liest; das ist reines Wissen, ohne Verstehen.
Wenn ich "Bamako" höre, ist es schon mal gut zu wissen, dass dieser Ort in Afrika liegt.
Afrika ist jedoch größer als 30 Millionen Quadratkilometer; selbst das Wissen "Bamako liegt in Mali" lässt noch viele Möglichkeiten der Lokalisation offen, wenn ich nicht weiß, wo der Staat Mali (oder Malawi?) in Afrika liegt.
Zum Kontinent Afrika mit umgebenden Inseln gehören mehr als 50 Staaten.
Nachrichten über Geschehnisse an einem Ort werden schnell vergessen, wenn sie nicht mit einer lokalen Vorstellung, etwa mit einer Position auf einer Landkarte, verbunden werden können.
Ob es sich um gewaltsame Ausschreitungen in Minneapolis handelt oder um Umweltverschmutzungen in Potosí, es wäre einfach gut, diese Orte rasch aus dem Gedächtnis ungefähr lokalisieren zu können, ohne vorher Google Earth zu öffnen, ohne einen Ortsnamen einzutippen, ohne auf das Internet zu warten und auf geeignete Maßstäbe zu zoomen, um den Ort in der eigenen, inneren Landkarte zu positionieren.
Wobei ein Ortsname oft nicht genügt; es gibt in den USA 42 Springfield und 57 Lincoln, davon 13 Orte Lincoln allein in Wisconsin.
Ein fremder Ortsname wie Hyderabad (Indien oder Pakistan?), den man nicht einer Weltgegend zuordnen kann, ist sinnfreies Wissen, das sehr bald vergessen wird, weil es nirgendwo eingeordnet, zugeordnet werden kann.
Wenn ich den Namen "Los Angeles" höre, mache ich – ohne zu wollen – blitzschnell auf einer gedachten, vor mir liegenden Weltkarte mit Nullmeridian in der Mitte einen Flug nach Westen und lande im Geiste auf einem Punkt, den ich für Los Angeles halte.
"Los Angeles" löst Begleitvorstellungen aus, wie Stadt in den USA, Stadtlandschaft mit 100 km Durchmesser, Stadt nahe am Pazifik, Strand, "It never rains in Southern California" und vieles mehr.
Beim Hören des Wortes "Atlantis" wüsste ich keinen Ort, an dem ich Atlantis fixieren könnte; um alle behaupteten Orte darzustellen braucht es eine Weltkarte.
Der Psychologe Hermann Ebbinghaus, Pionier der kognitiv-psychologischen Forschung, hat in monatelangen Selbstversuchen sinnlose Silben auswendig gelernt und in Zeitabständen abgefragt.
Er entwickelte ein Maß für das Vergessen von sinnfreiem Wissen, das man sich angeeignet hat und behalten möchte.
Bei der Einarbeitung in ein neues Gebiet machen die Begriffe zunächst wenig Sinn; die Sinnhaftigkeit entsteht erst, wenn man genügend viele Festlegungen kennt, also zunächst mehr oder weniger Sinnloses auswendig gelernt hat.
Ein gutes Fachbuch baut den Stoff aus Grundbegriffen so auf, dass man möglichst leicht auf größere Höhen des Verständnisses von Konzepten kommt.
Die Ergebnisse der Versuche von Ebbinghaus sind fundamental für das Verständnis des menschlichen Gedächtnisses.
Isoliertes Wissen wird schnell vergessen.
Um Wissen besser behalten zu können, sollte es sinnhaft sein und mit anderem Wissen verknüpft sein.
Wissen, das nicht mit Bildern, Gerüchen, Emotionen, Episoden, Personen oder Orten verknüpft ist, wird leicht vergessen.
Bei verknüpftem Wissen ist die Behaltenskurve (S. 58) viel weniger steil abfallend.
Bücher über das Lernen enthalten viele Ratschläge, wie man Wissen verknüpfen und mit Sinn versehen soll.
Dem ist ohne Einschränkung beizupflichten; Verknüpfen bedeutet aber viel Arbeit für die Lernperson, Arbeit, die wegen Zeitdruck bis zur Prüfung meist unterlassen wird.
Dann kommt das Büffeln, das Immer-Wieder-Lesen, das so frustrierend ist, weil das Wissen auf diese Weise nicht länger haften bleibt.
Hier haben wir keinen Prüfungsdruck; wir wollen herausarbeiten, wie man optimal Massendaten (Hunderte2 von Orten, Hunderte von Personen) lernen kann; und Spaß dabei haben kann, weil wir es nicht müssen.
Indem wir es als Spiel auffassen wie Mau-Mau, Mühle oder Schach, entfällt jeglicher Zwang, und wir vermehren schleichend unser Wissen.
Wir belasten uns nicht mit wissenschaftlichen Begriffs-Systemen, sondern verwenden einfache Modelle wie verdunstendes Wasser für verdunstendes Wissen.
Dazu müssen wir nicht wissen, dass der Winkel H-O-H von H2O 104.45 Grad ist, uns hilft mehr der Vergleich, dass ein dünner Wasserfilm extrem schnell verdunstet, genauso wie dünnes Wissen.
Wir achten dabei darauf, unser Gedächtnis nicht zu überlasten, uns eher eine Lerngewohnheit anzueignen als schnell viel zu lernen.
Wichtiger als das Merken von Zahlen ist das Kennenlernen von Ortsnamen und Namen bedeutender Personen, die uns zuvor nicht geläufig waren, die jetzt unseren Wortschatz vermehren.
Wir wollen einfach unsere Allgemeinbildung anheben, um globaler und historischer, in größeren Zeiträumen als ein Menschenleben, denken zu lernen.
Das Hauptziel ist, spielerisch eine Lerngewohnheit auszubilden, ganz gleich, um welchen Lernstoff es sich handelt, denn Stillstand ist Rückschritt.
Das zum Buch gehörende digitale Material – eine installationsfreie HTML-Datei3 – leistet diese Verknüpfungsarbeit für mehr als 3300 historische Personen, 1700 Orte und 550 geschichtliche Ereignisse.
Diese Datei – www.geiring.de/nb – nennen wir hier durchgehend "das → Notizbuch"; ein professionell hergestellter digitaler Informationszugang dieser Art könnte passender → Textom (S. 101) genannt werden.
Mit der täglichen Nutzung des Notizbuches, beispielsweise mit dem Browser Chrome auf einem Tabletcomputer, bekommt man eine klarere Vorstellung der Lage bedeutender Orte auf dem Globus.
Auch wird man mit den Leistungen auf vielen Gebieten von historischen Personen bekannt, ohne die unsere heutige Welt viel ärmer wäre und wir viel mehr arbeiten müssten oder viel früher sterben4 müssten.
Über Zahlen werden diese Wissensarten (Orte, Personen, Geschichte) miteinander verknüpft und so "haltbarer" im Gedächtnis gemacht.
Die Leserichtung ist nicht linear wie in einem Buch, sondern an jedem Punkt gibt es viele Möglichkeiten, per Klick oder Tastatureingabe beim Erkunden an ganz anderer Stelle fortzufahren.
Sie sind der Steuermann oder die Kapitänin bei den Reisen durch die Geschichte und über den Globus, nicht nur auf der zweidimensionalen Oberfläche, sondern in mehreren Dimensionen des Wissens.
Sie haben von der "Schlacht bei Kadesch" gehört als einer Aktion von Ramses II. – doch wo liegt (oder lag) Kadesch?
Die Eingabe von "Kade" (ohne Enter-Taste) in das → Notizbuch bewirkt bereits die Anzeige dieser Liste:
Damit ist angegeben, dass Kadesch eine historische Stadt ("hist") ist, die heute nicht mehr oder nicht mehr unter diesem Namen existiert.
"Kadesch < Syrien" bedeutet, dass Kadesch im heutigen Syrien liegt/lag.
"Syrien < Asien" bedeutet, dass sich Kadesch und (mindestens dieser Teil von) Syrien in Asien befinden.
"ooo" am Ende bedeutet, dass es sich um einen der Hauptorte des Notizbuches handelt.
Klick auf "ooo" oder Tastatureingabe "ooo" zeigt alle 1700 Hauptorte in einer Liste an, geordnet von 179° West nach 180° Ost.
Klick auf [u] hinter Kadesch zeigt eine gerasterte Landkarte mit Kadesch im Zentrum (Abbildung nächste Seite).
Die Zahlen "35 037" vor Kadesch sind die → Weltleitzahlen von Kadesch:
Kadesch liegt dem 35. Breitengrad am nächsten und dem 37. Längengrad ebenfalls.
Genauer: Kadesch liegt auf dem Breitenstreifen zwischen 34.5° Nord (einschließlich) und 35.5° Nord (ausschließlich).
Da aber auch Homs im gleichen → Plantrapez liegt wie Kadesch, steht im Zentrum der Anfangsbuchstabe "H" von Homs (statt "K" von Kadesch), in violetter Farbe.
[u] wurde gewählt, weil "u" der Anfangsbuchstabe von "Umgebung" ist, wobei jede Eingabe in Großschrift gleichwertig zu Kleinschrift ist.
"Umgebung" ist im globalen Maßstab, in dem die Rasterkarten angelegt sind, nicht nur ein Umkreis von ein paar Kilometer, sondern ein Winkel-Viereck von 15° × 15°, also rund 1666 km × 1400 km um Kadesch.
Unterhalb der Rasterkarte stehen die Orte, die im gleichen Plantrapez liegen wie Kadesch, in diesem Fall nur ein weiterer Ort: Homs.
Bedeutend an Kadesch ist der älteste bekannte Friedensvertrag der Welt, der nach dieser Schlacht -1274 (= 1274 v. Chr.) zwischen Ramses II. und Hattusili III. ausgehandelt worden war.
Der nächste Buchstabe in der Rasterkarte südwestlich vom zentralen "H" ist "D".
Klick auf dieses "D" färbt "D" orange und zeigt unterhalb der Rasterkarte:
Hinter Syrien erscheint jetzt "(Hs)", was Hauptstadt bedeutet.
ist zu lesen als: Damaskus ist Syriens Hauptstadt.
Durch diese knappe Notation von Hauptstädten kann man auf "Hs" klicken und bekommt eine Liste aller Hauptstädte der Erde, geordnet von Nord nach Süd.
Grundsätzlich kann man alle schwarzen Wörter in Listen des → Notizbuchs anklicken, wodurch sie in das große Eingabefeld am Bildschirm oben katapultiert werden und eine neue Liste anzeigen.
Jeder Anfangsbuchstabe in der Rasterkarte kann geklickt werden, um zu sehen, welcher Ort sich da verbirgt.
Das sind in der obigen Rasterkarte 54 Klickmöglichkeiten.
Das Zentrum "H" der Karte wird dadurch nicht verändert, aber es kommt ein neues [u] hinter Damaskus zum Vorschein, das geklickt werden kann und Damaskus zum neuen Zentrum der Rasterkarte macht.
Es wird klar, dass mit der Rasterkarte der Nahe Osten dargestellt ist mit 54 Orten, markiert durch ihren Anfangsbuchstaben.
Die schwarzen Punkte sind Landpunkte, denen keine Stadt zugewiesen ist, weil da keine Stadt ist oder weil die Rasterkarte übersichtlich gehalten werden soll.
Jeder Punkt auf der Rasterkarte ist das Zentrum eines → Plantrapezes, also ein Ort mit ganzzahligen Koordinaten.
Um die Landmasse gegen das Meer und die größeren Gewässer (hellblaue Punkte) besser abzugrenzen, kann man am oberen Rand der Rasterkarte auf [fett] klicken, wodurch die Landpunkte fetter werden.
Nun ist Zypern als Insel mit der Stadt "N" wie Nikosia besser zu erkennen.
Beim → Notizbuch handelt es sich nicht um enzyklopädisches Wissen über die Welt, sondern nur um die Orte, die mir im letzten Jahrzehnt beim Lesen begegnet sind und die ich schnell wiederfinden möchte.
Das Durchklicken bis zur gewünschten Seite in Wikipedia verschafft mir keine haltbare Vorstellung, wo sich der Ort auf dem Globus befindet.
In der deutschen Tablet-Version von Wikipedia werden mir von vielen Orten nicht die Koordinaten angegeben, während ich in meinem Notizbuch sofort den Vergleich zu anderen Orten habe, was mir die Zuordnung zu einer Weltgegend ermöglicht.
In 193 Ländern sind mehr als 400 Koordinatensysteme, Koordinatenreferenzsysteme, Kartennetzentwürfe, Kartenprojektionen der ungefähr kugelförmigen Erdoberfläche in Gebrauch.
Jedes dieser Systeme ist für bestimmte Zwecke oder Regionen besonders gut geeignet.
So ist die Karte der Londoner U-Bahn für Einwohner und Besucher von London [52 000] besonders praktisch, obwohl sie alles Geografische verzerrt wiedergibt und auch sonst von vielen Dingen abstrahiert.
Von Projektion kann man beim schematischen U-Bahn-Plan nicht reden.
Die Schweizer Landeskoordinaten – im System CH1903 – sind besonders gut geeignet für Vermessung und Bauwirtschaft, weil aus Koordinaten in Grundstücken unmittelbar Abstände in Meter ohne Umrechnung mit Winkelfunktionen abgelesen werden können; alle Koordinaten von Orten in der Schweiz sind positiv, da der Koordinatenursprung bei Bordeaux [45 -001] liegt.
Die London-Touristin hat keinen Nutzen vom CH1903, und der Schweizer, der in Appenzell [47 009] bauen will, findet die U-Bahn-Karte von London nicht zielführend.
Mit unserer Rasterkarte, die auf den Koordinaten von WGS845 beruht und nur rund alle 100 Kilometer einen Punkt setzt, bedienen wir das Interesse von Menschen, die sich die ungefähre, gegenseitige Lage von Weltstädten und vielen anderen interessanten Orten auf dem Globus einprägen möchten.
An einem solchen Rasterpunkt, der ein → Plantrapez repräsentiert, kann es dann mehrere Städte geben, wie z. B. im Plantrapez [39 -077]:
Mit dem → Zauberwort AlArBaWa, das entfernt wie Abrakadabra klingt, können wir die Städtenamen expandieren.
Das digitale → Notizbuch ist ein Prototyp, kein professionelles Fertigprodukt.
Das digitale Notizbuch enthält viele nützliche Neuerungen, die es von buchähnlichen Fließtexten im Internet unterscheiden.
Die Rasterkarte ist nur auf rund 100 km in jeder Richtung genau; steht "Kadesch" im großen Eingabefeld, ist der erste Datensatz in der Liste
Im Datensatz versteckt6 sind die Koordinaten auf vier Dezimalstellen genau, und ein Klick auf Button "K" (wie Karte) führt ins Internet, zeigt eine
OpenStreet-Karte mit rotem Marker im Zentrum, der auf den genauen vermuteten Ort von Kadesch am Orontes zeigt, in einer "normalen" Landkarte.
Für eine schnelle Orientierung ist es nicht notwendig, Button "K" zu klicken; wer jedoch die Lage auf einer üblichen Karte sehen will, klickt Button "K" neben dem großen Eingabefeld.
Bei geeigneter Zoomstufe erscheint dann am roten Marker in der OpenStreet-Karte eine Amphore, die auf eine historische Stätte hinweist: Kadesch.
Mir persönlich reicht es jedoch zu wissen, dass Kadesch bei Homs und Damaskus zu suchen ist, was ich im Notizbuch mit wenigen Klicks oder Tastatureingaben ohne langwieriges Suchen und Zoomen erhalte.
Je länger eine Suche im Internet voraussichtlich dauert, umso häufiger wird die Suche unterlassen; schon deshalb nimmt mit Computer das Wissen in den Köpfen nicht einfach zu.
Ein Ziel des → Notizbuches ist ohne Internet auszukommen, nachdem die Datei aus dem Internet in den Browser geladen ist, ebenso werden die Eingabe(n) zur Suche extrem verringert.
Wir alle haben ein Gefühl dafür, was 35 °C bedeutet: Sehr heiße Luft, Schwitzen ist angesagt, Schatten wird gesucht.
Nach häufigem Gebrauch der Rasterkarten weiß man einige Orte, die auch im 35-Grad-Nord-Streifen von Homs liegen: Memphis (Tennessee), Heraklion auf Kreta, Kabul in Afghanistan, die alte Hauptstadt Kaifeng in China oder die Metropolregion Keihanshin (Kyoto, Osaka, Kobe) in Japan.
Keine Wettervorhersage begnügt sich mit: "Heute wird es sehr heiß".
In jeder Wetterkarte sind an einigen Orten Temperaturen in Grad angegeben, keine umgangssprachlichen Hinweise wie "kalt", "kühl", "warm", "heiß".
Bei Nennung von entfernten Orten sind begleitende Weltleitzahlen noch nicht üblich, aber mit wachsender europäischer und globaler Kooperation macht das ebenso Sinn wie die Temperaturangaben in der Wetterkarte.
Mit der Rasterkarte reisen wir im Geiste blitzschnell um die Welt, mehrmals am Tag: Wir denken globaler.
Je mehr Orte mit Weltleitzahlen man kennt, umso leichter fällt die automatische Einordnung "liegt südlicher als", "liegt östlicher als", "liegt auf der Südhalbkugel", "liegt in der östlichen Hemisphäre", "liegt knapp über dem Äquator", usw.
Die vier Punkte "::" im Datensatz
bedeuten, dass Kadesch über die beiden Zahlen 35 und 37 mit drei weiteren Orten (oder Personen) verbunden ist.
Wir finden diese Verknüpfungen, indem wir 35'37 anklicken:
Bei der Stadt Tarsus sind die beiden Zahlen vorn vertauscht, also wird Nord zu Ost und Ost zu Nord.
Gedächtnismäßig sind die beiden Weltleitzahlenpaare [35 037] und [37 035] so ähnlich, dass sie besser zusammen erinnert werden.
Bei der Stadt Nagoya kommt eine Eins hinzu:
Aus [35 037] wird [35 137], d. h., von Homs 100 Grad nach Osten geflogen landet man im → Plantrapez von Nagoya.
Auch sind 037 und 137 so ähnlich, obwohl so weit voneinander entfernt, dass sie besser zusammen erinnert werden.





























