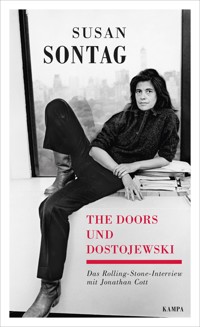
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
Susan Sontag und Jonathan Cott treffen sich 1978 zum Interview. Erst in Sontags Pariser Wohnung, dann in ihrem Loft in New York. Entstanden ist ein vielseitiges Porträt, das Susan Sontag als große und sehr agile Denkerin zeigt, vor der kaum ein Thema sicher war - Feminismus, Faschismus, Ästhetik, Ideo- logie, Chuck Berry oder Friedrich Nietzsche - und die sich keinen Deut um die Trennung von Hoch- und Popkultur scherte: »Rock 'n' Roll hat mein Leben verändert.« Auch in ihr Privatleben gewährt Sontag Einblick und erzählt von ihrer Rolle als Mutter, ihrer Ehe und ihrer Krebserkrankung, die sie zu einer ihrer wichtigsten Publikationen, Krankheit als Metapher, veranlasste. Zur Sprache kommen außerdem ihre bedeutenden Essays Kunst und Antikunst und Über Fotografie. Und selbst der Humor, eigentlich nicht Susan Sontags Markenzeichen, kommt in diesem Buch nicht zu kurz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susan Sontag
Jonathan Cott
The Doors und Dostojewski
Das Rolling-Stone-Interview mit Jonathan Cott
Aus dem Englischen von Georg Deggerich
Kampa
Er wird zum Störer des intellektuellen Friedens, um den Preis, ein Wanderer im intellektuellen Niemandsland zu werden, auf der Suche nach einem festen Platz, ein Stück weiter des Wegs, irgendwo hinter dem Horizont.
Sie sind weder gefällige noch zufriedene Zeitgenossen, diese Fremden auf unsicheren Füßen.
Thorstein Veblen
Wenn ein Mensch stirbt, verschwindet eine ganze Bibliothek.
Sprichwort der Kikuyu
Vorwort
»Die einzige denkbare Metapher für das Leben des Geistes«, schrieb die Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt, »ist die Empfindung des Lebendigseins. Ohne den Lebenshauch ist der menschliche Körper ein Leichnam; ohne das Denken ist der menschliche Geist tot.« Susan Sontag stimmte dem zu. Im zweiten Band ihrer Notizen und Tagebücher (Ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke) erklärte sie: »Intelligent zu sein heißt für mich nicht, etwas ›besser‹ zu machen. Es ist die einzige Form, in der ich existiere. […] Ich weiß, dass ich Angst davor habe, passiv (und abhängig) zu sein. Wenn ich meinen Verstand einsetze, fühle ich mich aktiv (autonom). Das ist gut.«
Sontag, die 1933 geboren wurde und 2004 starb, war als Essayistin, Schriftstellerin, Dramatikerin, Filmemacherin und politische Aktivistin ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie ein Leben, das dem Geist gewidmet ist, und das Nachdenken über das eigene Leben einander ergänzen und bereichern können. Seit der Veröffentlichung von Kunst und Antikunst im Jahr 1966 – ihrer ersten Sammlung von Essays, die auf ebenso lustvolle wie vorurteilsfreie Art von den Supremes bis Simone Weil und Filmen wie Die unglaubliche Geschichte des Mister C. bis Muriel oder Die Zeit der Wiederkehr reichten – ist Sontag ihrer Wertschätzung von Hochkultur und Populärkultur stets treu geblieben. So schrieb sie im Vorwort anlässlich der Wiederveröffentlichung ihres Buches nach dreißig Jahren: »Wenn ich zwischen den Doors und Dostojewski wählen müsste, dann würde ich – selbstverständlich – Dostojewski wählen. Aber muss ich denn wirklich wählen?«
Als Verfechterin einer »Erotik der Kunst« teilte sie mit dem französischen Autor Roland Barthes nicht nur dessen »Lust am Text«, sondern auch, was sie seine »Vision des Geisteslebens als eines Lebens des Begehrens, der umfassenden Intelligenz und der Lust« nannte. In dieser Hinsicht folgt sie William Wordsworth, der in seinem Vorwort zu den Lyrical Ballads die Aufgabe des Dichters darin sah, »einem Menschen unmittelbares Vergnügen zu bereiten« – als »Anerkennung der Schönheit des Universums« und »Huldigung der angeborenen und nackten Würde des Menschen« –, und mit Nachdruck betonte, die Umsetzung dieses Ziels sei »eine leichte und einfache Aufgabe für den, der die Welt im Geiste der Liebe betrachtet«.
»Wann fühle ich mich stark?«, fragt Sontag sich in einem Tagebucheintrag und gibt als Antwort: »Wenn ich verliebt bin und wenn ich arbeite«, verbunden mit dem Bekenntnis zu »den heißen Höhenflügen des Geistes«. Zweifellos waren Lieben, Begehren und Denken für Sontag ihrem Ursprung nach eng miteinander verwandt. In ihrem faszinierenden Buch Eros the Bittersweet spricht die Lyrikerin und Altphilologin Anne Carson – eine Autorin, die Sontag sehr bewunderte – von »einer ähnlichen Erscheinungsweise des Eros im Geist eines Liebenden und des Wissens im Geist eines Denkers« und fügt hinzu: »Wenn der Geist sich nach dem Wissen ausstreckt, öffnet sich der Raum des Begehrens.« – Ein Gedanke, der auch in Sontags Essay über Roland Barthes anklingt: »Schreiben ist eine Umarmung, ein Umarmtwerden, jeder Gedanke ist ein Gedanke, der die Hand ausstreckt.«
In einem 1987 vom amerikanischen PEN-Zentrum veranstalteten Symposium zum Werk von Henry James widmete sich Sontag erneut der unlösbaren Verknüpfung von Begehren und Wissen. Der häufig geäußerten Kritik an James’ kargem und abstraktem Stil hält Sontag entgegen: »Tatsächlich ist seine Sprache eine des Reichtums, der Fülle, der Lebensfreude, des Überschwangs, der Ekstase. In James’ Welt gibt es von allem mehr – mehr Text, mehr Bewusstsein, mehr Raum, mehr räumliche Komplexität, mehr Stoff, an dem das Bewusstsein sich abarbeiten kann. Er führt ein Prinzip des Begehrens in den Roman ein, das mir neu erscheint. Und zwar ein epistemologisches Begehren nach Wissen, das dem körperlichen Begehren gleicht und es oft nachahmt oder spiegelt.« In ihren Tagebüchern beschreibt Sontag das »geistige Leben« mit den Worten: »Begierde, Appetit, Gelüste, Verlangen, Sehnsucht, Unersättlichkeit, Verzückung, Neigung.« Sie hat sich wohl in den Worten von Anne Carson wiedergefunden, die bekannte, »mich zu verlieben und Wissen zu erlangen geben mir das Gefühl, wirklich lebendig zu sein«.
In all ihren Unternehmungen versuchte Sontag stereotype Einteilungen wie männlich/weiblich oder jung/alt, die den Menschen ein enges und furchtsames Leben bescheren, auszuhebeln und auf den Kopf zu stellen; und stets befragte und prüfte sie ihre Vorstellung, dass allgemein anerkannte Gegensätze wie Denken und Fühlen, Form und Inhalt, Moral und Ästhetik oder Bewusstsein und Sinnlichkeit sich auch einfach nur als wechselseitige Aspekte betrachten ließen – gerade so, wie Samt, je nachdem, in welche Richtung man darüberstreicht, sich anders anfühlt und eine unterschiedliche Schattierung aufweist.
In ihrem Essay ›Über den Stil‹ von 1965 etwa schrieb Sontag: »Nennt man Leni Riefenstahls Triumph des Willens und Olympia Meisterwerke, so heißt das nicht, Nazipropaganda mit ästhetischer Nachsicht glossieren. Die Nazipropaganda lässt sich nicht leugnen. Daneben aber ist noch etwas anderes … die komplexen Bewegungen des Geistes, der Anmut und der Sinnlichkeit.«
Zehn Jahre später, in ihrem Essay ›Faszinierender Faschismus‹, kehrte sie die Argumentationsrichtung um und bezeichnete Triumph des Willens als »rein propagandistischen Film, der schon allein von der Anlage her die Möglichkeit ausschließt, die Regisseurin habe über eine von der Propaganda unabhängige ästhetische Konzeption verfügt«. Während sie sich zuvor auf die »formalen Implikationen des Inhalts« konzentriert habe, erklärte Sontag, wolle sie nun untersuchen, wie »der Inhalt auf einer bestimmten Idee der Form beruht«.
Sontag, die sich selbst als »streitbare Ästhetin« und »kaum verhohlene Moralistin« bezeichnete, dürfte Wordsworth auch darin zugestimmt haben, dass »wir kein Mitgefühl haben, ohne dass es durch Vergnügen übertragen wird«, und dass »überall, wo wir dem Schmerz Mitgefühl erweisen, man finden wird, dass Mitgefühl durch subtile Verbindungen mit Vergnügen hervorgerufen und weitergetragen wird«. Insofern ist es nicht überraschend, dass, obwohl Sontag entschieden die Vorteile dessen bejahte, was sie »eine pluralistische, polymorphe Kultur« nannte, sie dennoch nie davon abließ, »das Leiden anderer zu betrachten« – wie es im Titel ihres letzten Buches vor ihrem Tod heißt –, und gleichzeitig versuchte, es zu lindern.
1968 reiste sie auf Einladung der nordvietnamesischen Regierung zusammen mit anderen amerikanischen Antikriegsaktivisten nach Hanoi, eine Erfahrung, die »zu einer Neubewertung meiner Identität, der verschiedenen Formen meines Bewusstseins, der psychischen Formen meiner Kultur, der Bedeutung von ›Aufrichtigkeit‹, Sprache, moralischer Entschiedenheit, psychologischer Ausdrucksfähigkeit« führte. Zwei Jahrzehnte später, zu Beginn der neunziger Jahre, fuhr sie ganze neun Mal ins zerstörte Sarajevo und verschaffte sich einen Eindruck von den Leiden der 380000 Einwohner, die unter permanenter Belagerung lebten. Bei ihrem zweiten Besuch, im Juli 1993, lernte sie einen in Sarajevo geborenen Theaterproduzenten kennen, der sie einlud, mit einigen der besten Schauspieler der Stadt Samuel Becketts Warten auf Godot auf die Bühne zu bringen. Scharfschützenfeuer und das Krachen der Mörsergranaten bildeten die Kulisse bei den Proben und den Aufführungen, die von Regierungsvertretern, Ärzten aus dem Zentralkrankenhaus, Soldaten von der Front sowie zahlreichen verwundeten und trauernden Bürgern besucht wurden. »Wer sich ständig davon überraschen lässt, dass es Verderbtheit gibt«, schrieb sie in Das Leiden anderer betrachten, »wer immer wieder mit Enttäuschung (oder gar Unglauben) reagiert, wenn ihm vor Augen geführt wird, welche Grausamkeiten Menschen einander antun können, dem fehlt es an moralischer oder psychischer Reife.« Und an anderer Stelle erklärte sie einmal: »Wahre Kultur ist ohne Altruismus nicht möglich.«
Ich begegnete Sontag zum ersten Mal Anfang der 1960er Jahre an der Columbia University in New York, an der sie unterrichtete und ich studierte. Drei Jahre lang schrieb ich Beiträge und war Mitherausgeber der Literaturbeilage des Columbia Spectator, der Tageszeitung des Columbia College, für die sie 1961 einen Essay über Norman O. Browns Zukunft im Zeichen des Eros geschrieben hatte, der später in Kunst und Antikunst Eingang fand. Eines Nachmittags fasste ich mir ein Herz und ging zu ihrem Büro, um ihr zu sagen, wie sehr ich den Aufsatz bewunderte. Nach dieser ersten Begegnung trafen wir uns mehrere Male zum Kaffee.
Nach meinem Abschluss am Columbia College 1964 ging ich nach Berkeley, um an der University of California Englische Literatur zu studieren, und fand mich wieder inmitten eines großen sozialen, kulturellen und politischen Aufbruchs. »Welch Glück, in diesem Dämmern am Leben zu sein«, hatte William Wordsworth zwei Jahrhunderte zuvor bei Ausbruch der Französischen Revolution geschrieben. Jetzt erlebten die Menschen erneut eine dramatische Umgestaltung des Lebens. Wohin man auch kam, »there was music in the cafés at night and revolution in the air«, wie Bob Dylan in »Tangled Up in Blue« sang.
Dreißig Jahre später schrieb Sontag im Vorwort zur Neuauflage von Kunst und Antikunst: »Wie wundervoll das alles im Rückblick erscheint. Wie sehr man sich wünschte, dass ein wenig von der Kühnheit, dem Optimismus, der Verachtung für den Kommerz überlebt hätte. Die beiden Pole eines ausgeprägt modernen Empfindens sind Nostalgie und Utopie. Das vielleicht interessanteste Merkmal der Zeit, die heute als die sechziger Jahre etikettiert wird, war die Tatsache, dass es so wenig Nostalgie gab. In dem Sinne handelte es sich tatsächlich um einen utopischen Moment.«
An einem Nachmittag im Jahr 1966 begegnete ich Susan zufällig auf dem Campus von Berkeley. Sie war von der Universität zu einem Vortrag eingeladen worden, und ich erzählte ihr, dass ich gerade damit begonnen hatte, für den Sender KPFA ein freies Nachtprogramm zu produzieren und zu moderieren; ich erwähnte auch, dass ich mit meinem Freund Tom Luddy – der wenig später Kurator des Pacific Film Archive wurde – an diesem Abend ein Interview mit dem Regisseur Kenneth Anger über seinen Film Scorpio Rising führen würde, und fragte sie, ob sie nicht daran teilnehmen wolle, was sie dann auch tat. (In ihren Tagebüchern nahm Susan später Angers Inauguration of the Pleasure Dome in ihre Liste der »Besten Filme« auf.)
1967 entsandte mich der Rolling Stone, für den ich auch nach meiner Rückkehr nach New York 1970 weiter arbeiten sollte, als ersten Europa-Korrespondenten nach London. Susan und ich hatten einige gemeinsame Freunde, und in den kommenden Jahren begegneten wir uns gelegentlich, sowohl in New York als auch in Europa, bei Empfängen, Filmvorführungen, Konzerten (Rock und Klassik) und Veranstaltungen im Kampf für die Menschenrechte. Ich hatte Susan immer schon für den Rolling Stone interviewen wollen, mich aber nie getraut, sie darauf anzusprechen. Im Februar 1978 hielt ich den Zeitpunkt für gekommen. Ihr vielbeachtetes Buch Über Fotografie war im Vorjahr erschienen, und zwei weitere Bücher sollten in Kürze folgen: Ich, etc. – eine Sammlung von acht Kurzgeschichten, die sie einmal als »eine Serie von Abenteuern in der ersten Person« beschrieb – und Krankheit als Metapher. Susan war zwischen 1974 und 1977 wegen einer Brustkrebserkrankung operiert und behandelt worden, und ihre Erfahrungen als Krebspatientin waren Anlass für dieses Buch gewesen. Als ich mich also endlich dazu durchgerungen hatte, sie zu fragen, ob sie zu einem Interview bereit wäre, und diese drei Bücher als Ausgangspunkt für unsere Unterhaltung vorschlug, sagte sie, ohne zu zögern, zu.
Für einige Schriftsteller ist die Teilnahme an einem Interview in etwa vergleichbar mit der Erfahrung, »seine Zunge vor dem Essen an ein Stromkabel zu halten«, wie der Dichter Kenneth Rexroth einmal nach einer besonders üblen Cocktailparty bemerkte. Italo Calvino sah das ähnlich. In seinem kleinen Text ›Gedanken vor einem Interview‹ klagt er: »Jeden Morgen sage ich mir: Heute muss ein produktiver Tag sein, und dann kommt irgendetwas dazwischen und hält mich vom Schreiben ab. Was ist es denn heute? Ach ja, es kommen Leute für ein Interview. Gott steh mir bei!« Noch unwilliger war der Nobelpreisträger J.M. Coetzee, der mitten in einem Interview mit David Attwell erklärte: »Wenn ich nur ein Funken Voraussicht hätte, würde ich mich erst gar nicht mit Journalisten einlassen. Ein Interview ist in neun von zehn Fällen ein Austausch mit einem wildfremden Menschen, dem es gleichwohl aufgrund von Konventionen gestattet ist, die Grenzen des Anstands zu überschreiten, die in einem Gespräch zwischen Fremden normalerweise gelten. […] Für mich aber ist Wahrheit verbunden mit Stille, Nachdenken und dem Schreiben selbst. Das Sprechen ist kein Quell der Wahrheit, sondern nur eine blasse und provisorische Form des Schreibens. Und das vom Richter oder Interviewer geschwungene Florett der Überrumpelung ist kein Instrument der Wahrheitsfindung, sondern ganz im Gegenteil eine Waffe, ein Zeichen für den grundsätzlich konfrontativen Charakter einer solchen Begegnung.«
Susan Sontag war anderer Meinung. »Ich mag Interviews«, sagte sie mir einmal, »und zwar deshalb, weil ich die Unterhaltung, den Dialog, mag und weiß, dass viele meiner Gedanken im Gespräch entstehen. Das Schwerste beim Schreiben ist in gewisser Weise, dass man allein ist und eine Unterhaltung mit sich selbst führen muss, was eine dem Wesen nach unnatürliche Tätigkeit ist. Ich mag es, mit Leuten zu reden – deshalb bin ich auch keine Einsiedlerin –, und Gespräche geben mir die Gelegenheit, herauszufinden, was ich denke. Was die Leserschaft denkt, interessiert mich nicht, denn sie ist eine abstrakte Größe, aber mich interessiert sehr wohl, was der Einzelne denkt, und dazu bedarf es der Begegnung von Angesicht zu Angesicht.«
In einem Tagebucheintrag von 1965 gelobt Sontag: »Keine Interviews geben, bis ich so klar + autoritativ + direkt klinge wie Lillian Hellman in der Paris Review.« Dreizehn Jahre später, an einem sonnigen Nachmittag Mitte Juni, stand ich vor der Tür von Susans Pariser Appartement im 16. Arrondissement. Sie setzte sich auf die eine Couch im Wohnzimmer, ich auf die andere und stellte meinen Kassettenrekorder auf den Tisch in der Mitte. Und während ich ihren klaren, bestimmten und direkten Antworten auf meine Fragen zuhörte, wurde offenbar, dass sie das viele Jahre zuvor gesetzte Ziel erreicht hatte.
Anders als die meisten anderen Menschen, die ich interviewt habe – der Pianist Glenn Gould ist die einzige weitere Ausnahme –, redete Susan nicht in Sätzen, sondern in wohlüberlegten langen Absätzen. Am meisten aber verblüfften mich die Genauigkeit und »moralische und sprachliche Feinabstimmung« – wie sie einmal den Stil von Henry James beschrieb –, mit der sie ihre Gedanken formulierte und entwickelte, das präzise Kalibrieren ihrer Aussagen durch Parenthesen und Einschränkungen (»manchmal«, »gelegentlich«, »normalerweise«, »größtenteils«, »in fast allen Fällen«), der Reichtum und die Geschmeidigkeit ihrer Rede, ein Ausdruck dessen, was die Franzosen ivresse du discours nennen – ein Sich-Berauschen am gesprochenen Wort. »Ich bin süchtig nach dem kreativen Dialog«, bemerkte sie einmal in ihren Tagebüchern und fügte hinzu: »Für mich ist es das Medium meiner Rettung.«
Nachdem wir drei Stunden geredet hatten, sagte Susan, sie sei am Abend zum Essen verabredet und müsse sich noch etwas ausruhen. Ich wusste, dass ich ausreichend Material für mein Interview auf Band hatte. Umso überraschter war ich, als sie erklärte, sie würde in Kürze für sechs Monate zurück in ihr New Yorker Apartment ziehen. Es gäbe noch einige Themen, über die sie mit mir reden wolle, ob wir unsere Unterhaltung in New York fortsetzen und zum Abschluss bringen könnten.
Fünf Monate später, an einem kalten Novembernachmittag, besuchte ich sie in ihrem geräumigen Penthouse-Apartment mit Blick über den Hudson River am Riverside Drive, wo sie, umgeben von ihrer achttausend Bücher umfassenden Bibliothek, lebte, die sie »mein persönliches Abfragesystem« und »mein Sehnsuchtsarchiv« nannte. Und an diesem weihevollen Ort saßen wir und redeten bis spät am Abend.
Im Oktober 1979 veröffentlichte der Rolling Stone ein Drittel meines Interviews mit Susan Sontag. Hier kann ich erstmals das gesamte Gespräch präsentieren, das ich vor fünfunddreißig Jahren in Paris und New York mit dieser bemerkenswerten und inspirierenden Person führen durfte, deren intellektuelles Credo – als solches habe ich es stets verstanden – mir am bewegendsten in einem kurzen Text von 1996 mit dem Titel »Ein Brief an Borges« ausgedrückt scheint:
Das Rolling-Stone-Interview
Als Sie vor vier Jahren erfuhren, dass Sie Krebs hatten, haben Sie sofort begonnen, über Ihre Krankheit nachzudenken. Das erinnert mich an Nietzsche, der einmal gesagt hat: »Ein Psychologe kennt wenig so anziehende Fragen wie die nach dem Verhältnis von Gesundheit und Philosophie, und für den Fall, dass er selber krank wird, bringt er seine ganze wissenschaftliche Neugierde mit in seine Krankheit.«
Nun, es trifft sicherlich zu, dass mein Kranksein mich dazu gebracht hat, über Krankheit nachzudenken. Ich denke über alles nach, was mir widerfährt. Nachdenken gehört zu den Dingen, mit denen ich mich beschäftige. Wäre ich bei einem Flugzeugabsturz dabei gewesen und die einzige Überlebende, hätte ich vielleicht ein Interesse an der Geschichte der Luftfahrt entwickelt. Ich bin sicher, dass die Erfahrungen der vergangenen zweieinhalb Jahre in meiner schriftstellerischen Arbeit auftauchen werden, wenn auch in verwandelter Form. Aber für den Teil von mir, der Essays schreibt, lautet die Frage nicht: Was erlebe ich?, sondern eher: Wie sieht die Welt kranker Menschen aus? Welche Überzeugungen haben sie? Ich habe meine eigenen Vorstellungen untersucht, weil ich selbst zahlreiche fixe Ideen hatte, ganz besonders über den Krebs. Ich hatte mich nie ernsthaft mit dem Thema Krankheit auseinandergesetzt. Und wenn man über bestimmte Dinge nicht nachdenkt, ist es sehr wahrscheinlich, dass man Klischees aufsitzt, selbst wenn es gelehrte Klischees sind.
Ich habe mir aber nicht eine Aufgabe gestellt und gesagt: »Also, jetzt bist du krank und wirst darüber nachdenken« – die Gedanken kamen ganz von selbst. Du liegst im Krankenhausbett, und die Ärzte kommen zu dir, und sie haben diese besondere Art zu reden … und du hörst ihnen zu und fängst an, darüber nachzudenken, was sie dir sagen und was es bedeutet, welche Art von Information du bekommst und wie du sie bewerten sollst. Aber dann denkst du auch: Wie merkwürdig, dass Leute so reden, und dir wird bewusst, dass es an all den festen Vorstellungen liegt, die die Welt der Kranken ausmachen. Man kann also sagen, dass ich darüber »philosophiert« habe, obwohl mir der Ausdruck zu hochgestochen erscheint, weil ich große Achtung vor der Philosophie habe. Aber in einem allgemeineren Sinn kann man über alles philosophieren. Ich meine, wenn man sich verliebt, beginnt man ja auch darüber nachzudenken, was Liebe ist, vorausgesetzt natürlich, man neigt zum Nachdenken.
Ein Freund von mir, ein Proust-Spezialist, fand heraus, dass seine Frau eine Affäre hatte. Er war furchtbar eifersüchtig und verletzt, und er erzählte mir, dass er die Passagen bei Proust über die Eifersucht danach mit anderen Augen gelesen und begonnen habe, über das Wesen der Eifersucht nachzudenken und diese Gedanken voranzutreiben. Zuletzt sei er dadurch zu einem völlig neuen Verständnis von Prousts Text und seiner eigenen Erfahrung gelangt. Er litt tatsächlich – sein Leiden hatte nichts Aufgesetztes, und er floh auch ganz gewiss nicht vor der Erfahrung, indem er auf diese Weise über Eifersucht nachzudenken begann. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er echte sexuelle Eifersucht nicht gekannt. Wenn er vorher davon bei Proust gelesen hatte, dann in der Art, wie man etwas liest, das nicht zum eigenen Erfahrungsschatz gehört – erst nachher weiß man, was es bedeutet.
Ich weiß wirklich nicht, ob ich über Eifersucht lesen möchte, wenn ich selbst rasend eifersüchtig bin. Und krank zu sein und darüber in der Weise nachzudenken, wie Sie es getan haben, muss doch eine enorme Anstrengung gekostet haben und Ihnen ein hohes Maß an innerer Distanz abverlangt haben.
Ganz im Gegenteil, es hätte mich enorme Anstrengung gekostet, nicht darüber nachzudenken. Es ist die einfachste Sache der Welt, über das nachzudenken, was einem selbst widerfährt. Du liegst im Krankenhaus und denkst darüber nach zu sterben – da hätte es großer Selbstüberwindung bedurft, nicht darüber nachzudenken. Viel mehr Kraft hat es gekostet, die Phase zu überstehen, in der ich so krank war, dass ich überhaupt nicht arbeiten und mein Buch Über Fotografie fertigstellen konnte. Das hat mich rasend gemacht. Als ich endlich wieder arbeiten konnte, also sechs oder sieben Monate nach der Krebsdiagnose, hatte ich die Essays über Fotografie immer noch nicht abgeschlossen, obwohl ich das ganze Buch in meinem Kopf hatte und mich nur hätte hinsetzen müssen, um es sorgfältig und in einem ansprechenden, lebendigen Stil niederzuschreiben. Aber es machte mich wahnsinnig, über etwas zu schreiben, zu dem ich in diesem Moment keinen Bezug hatte. Ich wollte ausschließlich Krankheit als Metapher schreiben, weil die Ideen zu diesem Buch schon im ersten oder zweiten Monat nach meiner Erkrankung alle da waren. Ich musste mich wirklich zwingen zur Arbeit an dem Fotografie-Buch.





























