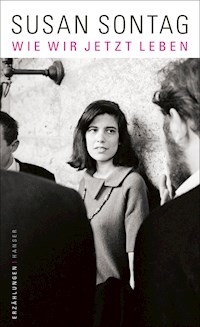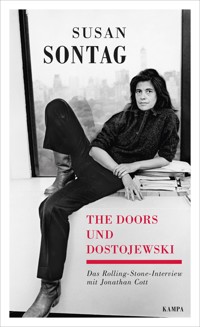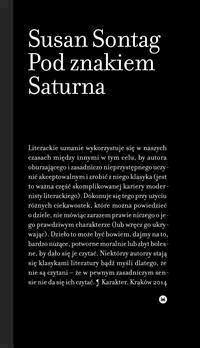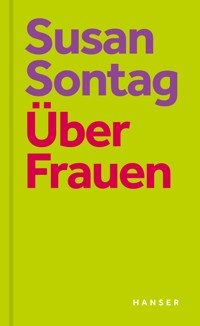
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die intellektuelle Ikone Susan Sontag über Gleichheit, weibliches Altern, Schönheit und Sexualität – „Eine brillante, schillernde Intelligenz“ (The Times) Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Der neue Essayband von Susan Sontag stellt genau diese Frage. Erstmals versammelt ein Buch ihre wichtigsten Texte zu ästhetischen, politischen und ökonomischen Aspekten des Frauseins. Und „beim heutigen Lesen kann man nur staunen über deren ihrer Zeit vorauseilendes Genie“ (The New Yorker). Sontag schreibt über Gleichheit, weibliches Altern, Schönheit, Sexualität und Macht und zeigt sich als Vordenkerin und Visionärin im Kampf um echte Gleichberechtigung. „Solange sich nicht ändert, wer Macht hat und was Macht ist, gibt es keine Befreiung, sondern nur Beschwichtigung“, konstatiert sie. „Über Frauen“ wehrt sich gegen jede Form von Beschwichtigung und ist in seinen Beobachtungen und Forderungen aktueller denn je für jeden feministischen Diskurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Die intellektuelle Ikone Susan Sontag über Gleichheit, weibliches Altern, Schönheit und Sexualität — »Eine brillante, schillernde Intelligenz« (The Times)Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Der neue Essayband von Susan Sontag stellt genau diese Frage. Erstmals versammelt ein Buch ihre wichtigsten Texte zu ästhetischen, politischen und ökonomischen Aspekten des Frauseins. Und »beim heutigen Lesen kann man nur staunen über deren ihrer Zeit vorauseilendes Genie« (The New Yorker). Sontag schreibt über Gleichheit, weibliches Altern, Schönheit, Sexualität und Macht und zeigt sich als Vordenkerin und Visionärin im Kampf um echte Gleichberechtigung. »Solange sich nicht ändert, wer Macht hat und was Macht ist, gibt es keine Befreiung, sondern nur Beschwichtigung«, konstatiert sie. »Über Frauen« wehrt sich gegen jede Form von Beschwichtigung und ist in seinen Beobachtungen und Forderungen aktueller denn je für jeden feministischen Diskurs.
Susan Sontag
Über Frauen
Herausgegeben von David Rieff
Aus dem Englischen von Kathrin Razum
Hanser
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Fußnoten
Über Susan Sontag
Impressum
Inhalt
Zweierlei Maß — Altern ist nicht gleich Altern
Die Dritte Welt der Frauen
Die Schönheit einer Frau — Herabsetzung oder Machtquelle?
Schönheit — Wie wird sie sich als Nächstes wandeln?
Faszinierender Faschismus
Feminismus und Faschismus — Ein Austausch zwischen Adrienne Rich und Susan Sontag
Das Salmagundi-Interview
Zweierlei Maß
Altern ist nicht gleich Altern
»Wie alt sind Sie?« Die Frage wird von einer beliebigen Person gestellt. Gerichtet ist sie an eine Frau, eine Frau »eines gewissen Alters«, wie man es in Frankreich diskret formuliert. Dieses Alter kann irgendwo zwischen Anfang zwanzig und Ende fünfzig liegen. Handelt es sich um eine offizielle Frage — um das routinemäßige Einholen einer Auskunft, wenn sie einen Führerschein, eine Kreditkarte, einen Pass beantragt —, wird sich die Frau vermutlich zwingen, aufrichtig zu antworten. Füllt sie einen Antrag auf Heiratserlaubnis aus und ihr künftiger Mann ist auch nur unwesentlich jünger als sie, wird sie vielleicht versucht sein, ein paar Jahre von ihrem Alter abzuziehen, es aber wahrscheinlich nicht tun. Bei der Bewerbung um eine Stelle hängen ihre Chancen oft nicht zuletzt davon ab, ob sie das »richtige Alter« hat — ist das nicht der Fall und sie glaubt, damit durchzukommen, wird sie lügen. Geht sie das erste Mal zu einem neuen Arzt und wird — in einem Moment, in dem sie sich vielleicht besonders verwundbar fühlt — nach ihrem Alter gefragt, wird sie wahrscheinlich hastig die korrekte Antwort geben. Bekommt sie dieselbe Frage jedoch im sogenannten privaten Rahmen gestellt — von einer neuen Freundin, einer flüchtigen Bekanntschaft, einem Nachbarskind, einem Arbeitskollegen in Büro, Laden, Fabrik —, ist ihre Reaktion schwieriger vorherzusagen. Vielleicht weicht sie der Frage mit einem Scherz aus oder verweigert mit neckischer Empörung die Antwort. »Du weißt doch, dass man eine Frau nicht nach ihrem Alter fragt!« Möglicherweise zögert sie aber auch kurz und sagt dann, verlegen, aber trotzig, die Wahrheit. Oder sie lügt. Aber weder Wahrheit noch Ausweichen noch Lüge ändern etwas daran, dass ihr die Frage unangenehm ist. Ihr Alter nennen zu müssen ist für Frauen ab einem »gewissen Alter« immer eine kleine Nervenprobe.
Kommt die Frage von einer Frau, wird sich die Angesprochene weniger bedroht fühlen, als wenn sie von einem Mann kommt. Andere Frauen sind schließlich Leidensgenossinnen, was das Demütigungspotenzial betrifft. Sie wird weniger schelmisch, weniger kokett auf die Frage reagieren. Trotzdem wird sie nicht gerne antworten und womöglich nicht die Wahrheit sagen. Von der bürokratisch-formalen Ebene einmal abgesehen, gilt: Wer einer Frau — ab einem »gewissen Alter« — diese Frage stellt, missachtet ein Tabu und ist möglicherweise unhöflich oder gar offen feindselig. Es wird weithin anerkannt, dass das genaue Alter einer Frau, sobald sie ein bestimmtes, nicht einmal sonderlich fortgeschrittenes Lebensalter erreicht hat, kein legitimes Ziel der Neugier mehr ist. Nach der Kindheit wird das Geburtsjahr einer Frau zu ihrem Geheimnis, ihrem Privatbesitz. Es ist eine Art schmutziges Geheimnis. Aufrichtig zu antworten ist immer indiskret.
Das Unbehagen, das eine Frau empfindet, wenn sie sagt, wie alt sie ist, besteht unabhängig vom bangen Bewusstsein der menschlichen Sterblichkeit, das uns alle gelegentlich ereilt. In einem gewissen Sinne ist es normal, nicht gern älter zu werden, für Männer wie für Frauen. Nach dem fünfunddreißigsten Lebensjahr schwingt in jeder Erwähnung des eigenen Alters die Ahnung mit, dass man dem Ende seines Lebens wohl näher ist als dessen Anfang. Dieses bange Gefühl ist keineswegs irrational. Und es ist auch nichts Anormales an der Pein und der Wut, die wirklich alte Leute — Menschen in ihren Siebzigern und Achtzigern — angesichts des unerbittlichen Schwindens ihrer körperlichen und geistigen Kräfte empfinden. Das fortgeschrittene Alter ist zweifellos eine Prüfung, so stoisch man es auch ertragen mag. Es ist ein Schiffbruch, so tapfer manche älteren Leute auch darauf bestehen mögen, ihre Fahrt fortzusetzen. Aber der objektive, ehrwürdige Schmerz des Alters ist etwas anderes als der subjektive, profane Schmerz des Älterwerdens. Das hohe Alter ist eine echte Qual, der Männer und Frauen gleichermaßen ausgesetzt sind. Das Älterwerden hingegen ist in erster Linie eine eingebildete Qual — ein moralisches Leiden, eine soziale Pathologie —, die sich nicht zuletzt dadurch auszeichnet, dass weit mehr Frauen als Männer sie erleben. Besonders Frauen erfüllt das Älterwerden (also alles, was vor dem wahren Alter kommt) mit Abscheu, ja sogar Scham.
Angesichts der emotionalen Privilegien, die unsere Gesellschaft der Jugend zubilligt, ist das Älterwerden für uns alle mit gewissen Ängsten verbunden. Sämtliche modernen urbanisierten Gesellschaften — im Gegensatz zu ländlichen Stammesgesellschaften — blicken auf die Vorzüge der Reife herab und heben die Freuden der Jugend in den Himmel. Diese Neubewertung des menschlichen Lebenszyklus zugunsten der Jugend spielt einer säkularen Gesellschaft in die Hände, deren Götzen die stetige Steigerung der industriellen Produktivität sowie die unbegrenzte Ausbeutung der Natur sind. Eine solche Gesellschaft muss eine neue Auffassung von den Rhythmen des Lebens erzeugen, um die Menschen dazu zu bringen, mehr zu kaufen, schneller zu konsumieren und schneller wegzuwerfen. Statt sich von ihrem unmittelbaren Gefühl dafür leiten zu lassen, was sie brauchen und was ihnen wirklich Freude bereitet, halten sie sich an kommerzialisierte Bilder vom Glück und persönlichen Wohlbefinden, und in dieser Bilderwelt, deren Sinn und Zweck es ist, den Konsum immer weiter anzuheizen, ist die gängigste Metapher für das Glück »Jugend«. (Ich bin davon überzeugt, dass der Begriff metaphorisch und nicht wörtlich zu verstehen ist. Jugend ist eine Metapher für Energie, rastlose Mobilität, Appetit: für den Zustand des »Wollens«.) Diese Gleichsetzung von Wohlbefinden und Jugend führt dazu, dass uns sowohl das eigene Alter als auch das der anderen stets quälend genau bewusst ist. In vormodernen Gesellschaften misst man Daten viel weniger Bedeutung bei. Wenn das Leben in lange Phasen stabiler Verantwortlichkeiten und gleichbleibender Ideale (und Heucheleien) unterteilt ist, wird die genaue Anzahl von Jahren, die jemand schon gelebt hat, zu einer Belanglosigkeit — es gibt kaum einen Grund, das eigene Geburtsjahr zu erwähnen oder auch nur zu kennen. In nicht-industriellen Gesellschaften können die meisten Leute nicht sicher sagen, wie alt sie sind. In den industriellen Gesellschaften hingegen sind die Menschen von Zahlen besessen. Sie verfolgen mit geradezu zwanghaftem Interesse, wie sich die Lebensjahre summieren, überzeugt, dass alles, was über eine bestimmte Gesamtsumme hinausgeht, nur schlecht sein kann. Da die Lebenserwartung stetig steigt, sind inzwischen die letzten zwei Drittel des Lebens von der schmerzlichen Empfindung fortdauernder Einbußen überschattet.
Das Prestige der Jugend wirkt sich bis zu einem gewissen Grad auf alle Menschen in unserer Gesellschaft aus. Auch Männer geraten wegen ihres Älterwerdens immer mal wieder in depressive Zustände — etwa wenn sie sich unsicher oder unausgefüllt oder in ihrem Beruf nicht hinlänglich gewürdigt fühlen. Anders als viele Frauen reagieren Männer jedoch nur selten panisch aufs Älterwerden. Es ist für sie keine so tiefe Kränkung wie für die Frauen, denn die Propaganda für die Jugend drängt Männer und Frauen fortschreitenden Alters zwar gleichermaßen in die Defensive, doch bei der Bewertung des Älterwerdens wird mit unterschiedlichem Maß gemessen, und Frauen kommen deutlich schlechter weg. Bei Männern wird das Altern gesellschaftlich eher toleriert — genau wie eheliche Untreue. Männer »dürfen« in mehrfacher Hinsicht altern, ohne Nachteile befürchten zu müssen, ganz im Gegensatz zu den Frauen.
Unsere Gesellschaft honoriert das Altern bei Frauen noch weniger als bei Männern. Körperlich attraktiv zu sein zählt im Leben einer Frau weit mehr als in dem eines Mannes, aber Schönheit, die bei Frauen nun mal mit Jugendlichkeit gleichgesetzt wird, hält dem Altern nicht gut stand. Außergewöhnliche Geisteskräfte können mit dem Alter noch zunehmen, aber Frauen werden nur selten ermuntert, ihren Intellekt über bloßes Dilettantentum hinaus zu entwickeln. Da die Art von Klugheit, die als spezifisch weiblich gilt, »ewig« ist — ein uraltes, intuitives Wissen über die Gefühle, zu dem ein Repertoire an Fakten, lebensweltliche Erfahrung und rationale Analyse nichts beitragen können —, verheißt ein langes Leben Frauen keinen Zuwachs an Klugheit. Die privaten Fähigkeiten, die man von Frauen erwartet, werden schon früh ausgeübt und gehören — den Bereich der körperlichen Liebe ausgenommen — nicht zu den Gaben, die mit zunehmendem Alter größer werden. »Männlichkeit« wird mit Kompetenz, Autonomie und Selbstbeherrschung gleichgesetzt, Eigenschaften, die durch das Schwinden der Jugend nicht gefährdet sind. Bei allen Aktivitäten, die von Männern erwartet werden, sportliche Leistungen einmal beiseitegelassen, nimmt die Kompetenz mit fortschreitendem Alter zu. »Weiblichkeit« hingegen wird mit Inkompetenz, Hilflosigkeit, Passivität, mangelndem Konkurrenzwillen und Nettigkeit gleichgesetzt. Nichts, was durch das Älterwerden gewinnen würde.
Männer aus der Mittelschicht empfinden das Älterwerden — unter Umständen schon recht früh — als Herabsetzung, sofern sie sich noch nicht in ihrem Beruf ausgezeichnet oder viel Geld verdient haben. (Und falls sie zur Hypochondrie neigen, verstärkt sich diese im mittleren Alter noch, mit ängstlicher Fixierung auf die Schreckgespenster Herzinfarkt und Impotenz.) Bei ihnen ist die durchs Älterwerden verursachte Krise eine Begleiterscheinung des furchtbaren Drucks, »erfolgreich« zu sein, dem sie als Männer ausgesetzt sind — und der eben ihre Zugehörigkeit zur Mittelschicht markiert. Frauen fühlen sich nur selten deshalb durch ihr Alter verunsichert, weil sie keine Erfolge vorzuweisen haben. Die Arbeit, die Frauen außerhalb des Haushalts verrichten, wird fast nie als besondere Leistung betrachtet, sondern gilt als bloßes Mittel, Geld zu verdienen; die meisten Berufe, die Frauen zur Verfügung stehen, beuten die Verhaltensweisen aus, die ihnen seit früher Kindheit anerzogen werden, nämlich unterwürfig zu sein, sowohl anderen eine Stütze als auch Parasit, Abenteuern abgeneigt. Sie dürfen niedrige, einfache Arbeiten in der Leichtindustrie und im Dienstleistungssektor übernehmen, die sich als Gradmesser für Erfolg ebenso wenig anbieten wie die Hausarbeit. Sie dürfen Sekretärin sein, Büroangestellte, Verkäuferin, Hausmädchen, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kellnerin, Sozialarbeiterin, Prostituierte, Krankenschwester, Lehrerin, Telefonistin — öffentliche Umschreibungen der dienenden und nährenden Rolle, die Frauen im Familienleben ausfüllen. Frauen haben kaum leitende Funktionen inne, werden nur selten für geeignet befunden, in Wirtschaft oder Politik verantwortungsvolle Posten zu übernehmen, und auch in den freien Berufen (von der Lehre einmal abgesehen) sind sie nur in geringer Zahl vertreten. Von Tätigkeiten, die den fachkundigen Umgang mit Maschinen oder massiven Körpereinsatz erfordern, die ein Gesundheitsrisiko in sich bergen oder eine gewisse Abenteuerlust voraussetzen, sind sie praktisch ausgeschlossen. Die Tätigkeiten, die in unserer Gesellschaft als angemessen für eine Frau gelten, sind »ruhige« Hilfsarbeiten, die zu den von Männern ausgeübten Berufen nicht in Konkurrenz treten, sondern diese unterstützen. Abgesehen von der schlechteren Bezahlung bieten die Berufe, die Frauen zur Verfügung stehen, geringere Aufstiegschancen und kaum Gelegenheit, einen normal ausgeprägten Wunsch nach Macht auszuleben. Alle herausragenden Leistungen von Frauen in unserer Gesellschaft werden unentgeltlich erbracht — die meisten Frauen lassen sich durch die gesellschaftliche Missbilligung von ehrgeizigem, offensivem Verhalten bei Frauen zu sehr einschüchtern. Dementsprechend bleibt ihnen die dumpfe Panik von Männern mittleren Alters erspart, denen ihre »Errungenschaften« dürftig erscheinen, die das Gefühl haben, auf der Karriereleiter nicht voranzukommen, oder befürchten, von einem Jüngerem aus ihrer Position verdrängt zu werden. Doch zugleich bleibt den Frauen eben auch die echte Befriedigung verwehrt, die ein Mann aus seiner Arbeit ziehen kann — eine Befriedigung, die mit fortschreitendem Alter tatsächlich oft zunimmt.
Dass beim Altern mit zweierlei Maß gemessen wird, zeigt sich am schonungslosesten an den Konventionen im Bereich des Sexualempfindens, denn hier wird eine Ungleichheit zwischen Mann und Frau unterstellt, die sich permanent zulasten der Frau auswirkt. Im akzeptierten Gang der Dinge kann eine Frau von ihren späten Teenagerjahren bis Mitte, Ende zwanzig damit rechnen, einen mehr oder weniger gleichaltrigen Mann zu finden. (Idealerweise sollte er zumindest etwas älter sein als sie.) Sie heiraten und gründen eine Familie. Wenn ihr Mann jedoch nach einigen Ehejahren eine Affäre hat, ist die andere Frau üblicherweise deutlich jünger als seine Ehefrau. Nehmen wir an, die Eheleute sind Ende vierzig, Anfang fünfzig und lassen sich scheiden. Der Mann hat beste Aussichten, wieder zu heiraten, wahrscheinlich eine jüngere Frau. Für seine Ex-Frau dagegen gestaltet es sich schwierig, einen neuen Ehepartner zu finden. Dass sich ein Mann, der jünger ist als sie, für sie interessiert, ist nicht zu erwarten, und selbst um einen Gleichaltrigen zu finden, muss sie Glück haben — wahrscheinlich wird sie sich mit einem erheblich Älteren zufriedengeben müssen, einem Mann in seinen Sechzigern oder Siebzigern. Frauen kommen viel früher als Männer für eine sexuelle und eheliche Beziehung nicht mehr infrage. Ein Mann, selbst ein hässlicher, kann bis ins hohe Alter infrage kommen. Er ist ein akzeptabler Partner für eine junge, attraktive Frau. Frauen, selbst gut aussehende, kommen dagegen schon in viel jüngerem Alter nicht mehr infrage (außer als Partnerinnen sehr alter Männer).
Das Älterwerden stellt also für die meisten Frauen einen erniedrigenden Prozess allmählicher sexueller Abwertung dar. Da Frauen in ihren jungen Jahren als maximal begehrenswerte Sexualpartnerinnen gelten und danach stetig an Wert verlieren, haben bereits junge Frauen das Gefühl, sich in einem verzweifelten Wettlauf mit der Zeit zu befinden. Kaum sind sie nicht mehr ganz jung, sind sie schon alt. Manche Mädchen machen sich bereits in ihren späten Teenagerjahren sorgenvolle Gedanken übers Heiraten. Jungen und junge Männer hingegen haben wenig Grund, Schwierigkeiten aufgrund ihres Älterwerdens zu befürchten. Was Männer für Frauen begehrenswert macht, hängt keineswegs mit dem Alter zusammen. Ganz im Gegenteil wirkt sich das Älterwerden für Männer (in den ersten paar Jahrzehnten) zu ihren Gunsten aus, denn ihr Wert als Liebhaber und Ehemann wird eher durch ihr Tun als durch ihr Aussehen bestimmt. Viele Männer sind in der Liebe mit vierzig erfolgreicher als mit zwanzig oder fünfundzwanzig: Ruhm, Geld und vor allem Macht steigern ihren Sex-Appeal. (Eine Frau, die in einem stark leistungsorientierten Beruf aufsteigt und Macht erlangt, hat keine größere, sondern eine geringere sexuelle Anziehungskraft. Die meisten Männer gestehen ein, dass sie sich von einer solchen Frau eingeschüchtert und sexuell eher abgestoßen fühlen — natürlich deshalb, weil sie sich schlechter als »Sexualobjekt« behandeln lässt.) Männer mögen mit fortschreitendem Alter anfangen, sich um ihre Potenz zu sorgen, und ein Nachlassen ihrer sexuellen Leistungsfähigkeit oder gar die Impotenz befürchten, aber sie kommen nicht weniger als Sexualpartner infrage, nur weil sie älter werden. Männer bleiben sexuell möglich, solange sie den Liebesakt noch vollziehen können. Frauen sind im Nachteil, denn sie müssen als Kandidatin für eine sexuelle Beziehung viel strengere »Bedingungen« hinsichtlich Alter und Aussehen erfüllen.
Da man Frauen ein viel begrenzteres Sexualleben zuschreibt als Männern, wird eine Frau, die nie verheiratet war, bemitleidet. Sie ist für nicht annehmbar befunden worden, und man geht davon aus, dass ihr restliches Leben diese ihre Unannehmbarkeit bestätigen wird. Der unterstellte Mangel an Gelegenheiten, ihre Sexualität auszuleben, wird als peinlich empfunden. Über einen Mann, der Junggeselle bleibt, wird lange nicht so krass geurteilt. Bei ihm geht man davon aus, dass er in jeglichem Alter noch ein Sexualleben hat — oder jedenfalls haben kann. Ein Schicksal, das dem demütigenden Status der alten Jungfer vergleichbar wäre, droht Männern nicht. Die Anrede »Mr.« gilt von Kindesbeinen bis zum Grab und erspart Männern somit das Stigma, das jeder nicht mehr ganz jungen Frau anhaftet, die noch »Miss« ist. (Die Tatsache, dass Frauen in »Mrs.« und »Miss« unterschieden werden, was die Aufmerksamkeit unerbittlich auf ihren Familienstand lenkt, ist Ausdruck der Überzeugung, dass es für Frauen eine viel größere Rolle spielt, ob sie ledig oder verheiratet sind.)
Bei einer nicht mehr ganz jungen Frau stellt sich zweifelsohne eine gewisse Erleichterung ein, wenn sie schließlich und endlich einen Ehepartner gefunden hat. Verheiratet zu sein lindert ihren Kummer über die verfliegenden Jahre ein wenig. Aber ihre Anspannung löst sich nie restlos, denn sie weiß, dass sie im Falle einer späteren Rückkehr auf den Sexualmarkt — weil die Ehe geschieden wurde oder der Partner gestorben ist oder sie ein erotisches Abenteuer sucht — viel schlechtere Karten haben wird als jeglicher Mann ihres Alters (ganz gleich, wie alt sie ist), mag sie auch noch so gut aussehen. Beruflicher Erfolg, falls sie erwerbstätig ist, nützt ihr nichts. Das letzte Wort hat immer der Kalender.
Wobei dieser Kalender von Land zu Land variiert. In Spanien, Portugal und den lateinamerikanischen Ländern hält man Frauen zu einem früheren Zeitpunkt für körperlich nicht mehr begehrenswert als in den Vereinigten Staaten. In Frankreich etwas später. Die dortigen Konventionen im Bereich des Sexualempfindens weisen der Frau zwischen fünfunddreißig und fünfundvierzig eine eigene, gleichsam offizielle Position zu. Ihre Aufgabe ist es, einen unerfahrenen oder schüchternen jungen Mann in die körperliche Liebe einzuführen, woraufhin sie natürlich durch ein junges Mädchen ersetzt wird. (Colettes Roman Chéri ist die bekannteste fiktionale Darstellung einer solchen Beziehung, in den Biografien über Balzac wiederum findet man ein gut dokumentiertes Beispiel aus dem wahren Leben.) Dieser sexuelle Mythos macht es den Französinnen ein bisschen erträglicher, vierzig zu werden. Aber das Grundprinzip, dass Frauen viel früher als Männern ein Sexualleben abgesprochen wird, gilt in all diesen Ländern gleichermaßen.
Das Altern unterscheidet sich auch nach gesellschaftlichem Stand. Arme sehen viel früher alt aus als Reiche. Zugleich ist die Angst vor dem Älterwerden bei Frauen aus der Mittel- und Oberschicht eindeutig ausgeprägter und weiter verbreitet als bei jenen aus der Arbeiterklasse. Wirtschaftlich benachteiligte Frauen in unserer Gesellschaft begegnen dem Älterwerden fatalistischer, sie können es sich schlicht nicht leisten, den kosmetischen Kampf gegen das Alter so lange und so hartnäckig zu führen wie die Bessergestellten. Dass gerade diejenigen Frauen, die sich ihr jugendliches Aussehen am längsten bewahren können — weil sie ein entspanntes, wohlbehütetes Leben führen, sich gesund ernähren, nicht an der medizinischen Versorgung sparen müssen und wenige oder gar keine Kinder haben —, das Älterwerden als besonders niederschmetternd empfinden, ist der beste Beweis dafür, dass es sich um ein eingebildetes Problem handelt. Das Altern macht sich weit mehr als verinnerlichter gesellschaftlicher Maßstab denn als tatsächliche biologische Gegebenheit bemerkbar. Viel weitreichender als das krasse Verlustgefühl bei Eintritt der Menopause (der im Zuge der steigenden Lebenserwartung immer später erfolgt) sind die depressiven Zustände angesichts des Älterwerdens, die gar keinen konkreten Auslöser im Leben einer Frau benötigen, sondern die Folge einer Art fixer Idee sind, die ihren Ursprung in den gesellschaftlichen Verhältnissen hat — in den Beschränkungen nämlich, die einer Frau in unserer Gesellschaft hinsichtlich der freien Gestaltung ihres Selbstbildes auferlegt werden.
Ein Paradebeispiel für die Krise, die durchs Älterwerden verursacht wird, findet sich in Richard Strauss’ ironisch-sentimentaler Oper Der Rosenkavalier, deren Heldin, eine reiche, glamouröse, verheiratete Frau, beschließt, der romantischen Liebe zu entsagen. Nach einer Nacht mit ihrem hingebungsvollen jungen Liebhaber wird die Marschallin plötzlich und unerwartet mit sich selbst konfrontiert. Es geschieht gegen Ende des ersten Akts, Octavian ist gerade gegangen. Allein in ihrem Schlafzimmer, setzt sie sich, wie jeden Morgen, an ihren Toilettentisch. Es ist das tägliche Ritual der Selbstbegutachtung, das alle Frauen vollziehen. Sie betrachtet sich und bricht entsetzt in Tränen aus. Ihre Jugend ist vorbei. Man beachte, dass die Marschallin beim Blick in den Spiegel nicht etwa feststellt, dass sie hässlich ist. Sie ist so schön wie eh und je. Ihre Entdeckung ist moralischer Natur — das heißt, sie findet nur in ihrer Vorstellung statt, da ist nichts, was sie tatsächlich sehen könnte. Aber das macht die Entdeckung nicht weniger niederschmetternd. Tapfer trifft die Marschallin ihre schmerzliche, noble Entscheidung. Sie wird dafür sorgen, dass ihr geliebter Octavian sich in ein gleichaltriges Mädchen verliebt. Sie muss realistisch sein. Sie kommt nicht mehr infrage. Sie ist jetzt »die alte Marschallin«.
Strauss hat die Oper 1910 komponiert. Für das heutige Opernpublikum ist es oft ein kleiner Schock, festzustellen, dass die Marschallin dem Libretto zufolge gerade mal vierunddreißig Jahre alt ist — heutzutage wird die Rolle oft von einer Sopranistin Ende vierzig oder Anfang fünfzig gesungen. Von einer attraktiven Vierunddreißigjährigen dargeboten, würde der Kummer der Marschallin heute neurotisch oder schlicht lächerlich wirken. Mit vierunddreißig Jahren hält sich in unseren Tagen kaum eine Frau für so alt, dass eine Liebesbeziehung nicht mehr denkbar wäre. Das Rentenalter ist angestiegen, parallel zur markanten Zunahme der Lebenserwartung über die letzten paar Generationen. Doch das Prinzip, nach dem Frauen ihr Leben wahrnehmen, bleibt das gleiche. Unaufhaltsam naht der Moment, wo sie sich damit abfinden müssen, »zu alt« zu sein. Und dieser Moment kommt — objektiv betrachtet — immer vor der Zeit.
In früheren Generationen erfolgte der Verzicht noch zeitiger. Vor fünfzig Jahren war eine Vierzigjährige keine älter werdende Frau, sondern alt, erledigt. Sich dagegen zu wehren war schlicht nicht möglich. Heute gibt es keinen festgelegten Zeitpunkt, ab dem sich Frauen dem Älterwerden ergeben. Die durchs Älterwerden verursachte Krise (ich spreche hier nur von Frauen in wohlhabenden Ländern) beginnt früher und dauert länger an, sie zieht sich durch den größten Teil des Frauenlebens. Schon lange bevor sie nach irgendeinem vernünftigen Maßstab als alt gelten könnten, fangen Frauen an, sich wegen ihres Alters zu sorgen und womöglich zu lügen oder zumindest den Impuls dazu zu verspüren. Wann genau das losgeht, wird durch eine Mischung aus persönlicher (»neurotischer«) Verletzlichkeit und dem jeweiligen Stand der gesellschaftlichen Konventionen bestimmt. Manche Frauen erleben erst mit dreißig ihre erste Krise. Vierzig zu werden ist dann für alle ein lähmender Schock. Jeder Geburtstag, umso mehr, wenn er ein neues Lebensjahrzehnt einläutet — runde Zahlen haben eine besondere Autorität —, verkündet eine weitere Niederlage. Die bange Erwartung ist dabei kaum weniger quälend als das reale Ereignis. Neunundzwanzig ist ein unbehagliches Alter, seit das offizielle Ende der Jugend vor etwa einer Generation auf dreißig verschoben wurde. Auch neununddreißig zu sein ist hart: ein ganzes Jahr, in dem man in bedrückter Verwunderung darüber sinnieren kann, dass man an der Schwelle zum mittleren Alter steht. Die Grenzen sind willkürlich gezogen, aber deshalb nicht weniger lebendig. Obwohl eine Frau an ihrem vierzigsten Geburtstag kaum anders sein wird als mit neununddreißig, erscheint ihr der Tag als Wendepunkt. Doch schon lange bevor sie zur Vierzigjährigen wurde, hat sie sich gegen die Niedergeschlagenheit gewappnet, die sie empfinden wird. Es ist eine der größten Tragödien im Leben einer Frau, dass sie älter wird — und ohne Zweifel ist es die Tragöde, die am längsten währt.
Das Älterwerden ist ein bewegliches Verhängnis. Es ist eine Krise, die sich nie erschöpft, denn die Bangigkeit verbraucht sich nicht. Da die Krise nicht »real«, sondern eingebildet ist, wiederholt sie sich immer wieder. Das Gebiet des Älterwerdens hat (im Gegensatz zu dem des Alters) keine festen Grenzen. Bis zu einem gewissen Grad kann es nach Belieben definiert werden. Ein sympathischer, verzweifelter Selbsterhaltungsdrang ermöglicht es vielen Frauen, beim Beginn eines neuen Lebensjahrzehnts — nachdem der erste Schock überwunden ist —, die Grenzen bis zum Ende des angebrochenen Jahrzehnts auszudehnen. In der Jugend und im jungen Erwachsenenalter erscheint einem dreißig wie das Ende des Lebens. Ist man dreißig, verschiebt man das Verdikt auf vierzig. Mit vierzig gibt man sich noch einmal zehn Jahre.
Ich erinnere mich, wie meine engste Collegefreundin an ihrem einundzwanzigsten Geburtstag schluchzte: »Der beste Teil meines Lebens ist vorbei. Jetzt bin ich nicht mehr jung.« Sie stand kurz vor der Abschlussprüfung. Ich war Studienanfängerin, eine frühreife Sechzehnjährige. In meiner Verblüffung versuchte ich lahm, sie zu trösten, und sagte, so alt sei sie mit einundzwanzig doch auch wieder nicht. Tatsächlich begriff ich überhaupt nicht, was so demoralisierend daran sein sollte, einundzwanzig zu werden. Ich sah nur Vorteile: selbst über das eigene Leben bestimmen zu können, frei zu sein. Mit sechzehn war ich noch zu jung, um die seltsam vage, ambivalente Art und Weise, in der unsere Gesellschaft verlangt, man solle sich nicht mehr als Mädchen, sondern als Frau betrachten, zu bemerken und mich davon irritieren zu lassen. (In Amerika kann man sich diesem Ansinnen mittlerweile bis zum dreißigsten Lebensjahr oder sogar noch länger entziehen.) Doch auch wenn ich ihren Kummer absurd fand, muss mir bewusst gewesen sein, dass bei einem Jungen ihres Alters ein solcher Kummer nicht nur absurd, sondern schlicht undenkbar gewesen wäre. Nur Frauen grämen sich mit dieser Mischung aus Dümmlichkeit und Pathos wegen ihres Alters. Und wie bei allen Krisen, die tatsächlich keine sind und deshalb zwanghaft wiederkehren (weil die Gefahr größtenteils imaginär ist, ein schleichendes Gift in der Vorstellung), erlebte meine Freundin die gleiche Krise wieder und wieder, jedes Mal so, als wäre es das erste Mal.
Ich war auch dabei, als sie ihren dreißigsten Geburtstag feierte. Sie hatte zahlreiche Liebesbeziehungen hinter sich, hatte ihre Zwanziger überwiegend im Ausland verbracht und war gerade erst in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Zu Beginn unserer Bekanntschaft hatte sie gut ausgesehen, jetzt war sie eine Schönheit. Ich neckte sie wegen der Tränen, die sie an ihrem einundzwanzigsten Geburtstag vergossen hatte. Sie lachte und behauptete, daran erinnere sie sich nicht. Aber dreißig, sagte sie wehmütig, das sei nun wirklich das Ende. Wenig später heiratete sie. Meine Freundin ist jetzt vierundvierzig. Sie ist nicht mehr das, was man landläufig als schön bezeichnet, aber sie sieht toll aus, ist charmant und vital. Sie ist Grundschullehrerin; ihr Mann, zwanzig Jahre älter als sie, ist Seemann bei der Handelsmarine. Sie haben ein Kind, das jetzt neun ist. Wenn ihr Mann unterwegs ist, nimmt sie sich manchmal einen Liebhaber. Kürzlich hat sie mir erzählt, dass ihr vierzigster Geburtstag für sie der schlimmste gewesen sei (bei dieser Feier war ich nicht dabei), und auch wenn ihr nur noch wenige Jahre blieben, gedenke sie, diese nach Kräften zu genießen. Sie ist zu einer jener Frauen geworden, die in Unterhaltungen jede Gelegenheit nutzen, ihr wirkliches Alter kundzutun, und zwar mit einer Mischung aus demonstrativem Trotz und Selbstmitleid, die sich nicht allzu sehr vom Gestus jener Frauen unterscheidet, die regelmäßig über ihr Alter lügen. Tatsächlich macht sie sich heute jedoch weniger Sorgen übers Älterwerden als vor zwanzig Jahren. Ein Kind zu bekommen, und das relativ spät, nämlich mit über dreißig, hat sie zweifellos mit ihrem Alter versöhnt. Ich vermute mal, dass sie mit fünfzig den Zeitpunkt der Resignation noch beherzter aufschieben wird.
Meine Freundin ist eines der robusteren, vom Glück durchaus begünstigten Opfer der durchs Älterwerden verursachten Krise. Die wenigsten Frauen durchleiden die Krise mit solchem Schwung oder auch solch unschuldiger Komik. Aber fast alle erleiden sie in irgendeiner Form: Eine wiederkehrende Zwangsvorstellung, die meist schon in recht jungen Jahren erstmals auftritt und dazu führt, dass sie sich in eine Verlustrechnung hineinprojizieren. Die Regeln unserer Gesellschaft sind Frauen gegenüber grausam. Dazu erzogen, nie ganz erwachsen zu werden, gelten Frauen früher als Männer als obsolet. Tatsächlich können die meisten Frauen ihre Sexualität erst in ihren Dreißigern relativ frei leben und auskosten. (Wobei Frauen nicht aus biologischen Gründen so spät sexuelle Reife erlangen — zweifellos viel später als Männer —, sondern weil unsere Kultur Frauen in ihrer Entwicklung hemmt. Männer haben verschiedene Möglichkeiten, ihre sexuelle Energie auszuleben, die Frauen größtenteils verwehrt sind, deshalb brauchen manche Frauen so lange, um zumindest einige ihrer Hemmungen abzulegen.) Somit beginnt die Abwertung der Frau als Sexualpartnerin zu einer Zeit, da sie sexuell gerade erst erwachsen geworden ist. Weil beim Altern mit zweierlei Maß gemessen wird, werden die Frauen um genau die Jahre betrogen — die Zeit zwischen fünfunddreißig und fünfzig —, die vermutlich die besten in ihrem Sexualleben sind.